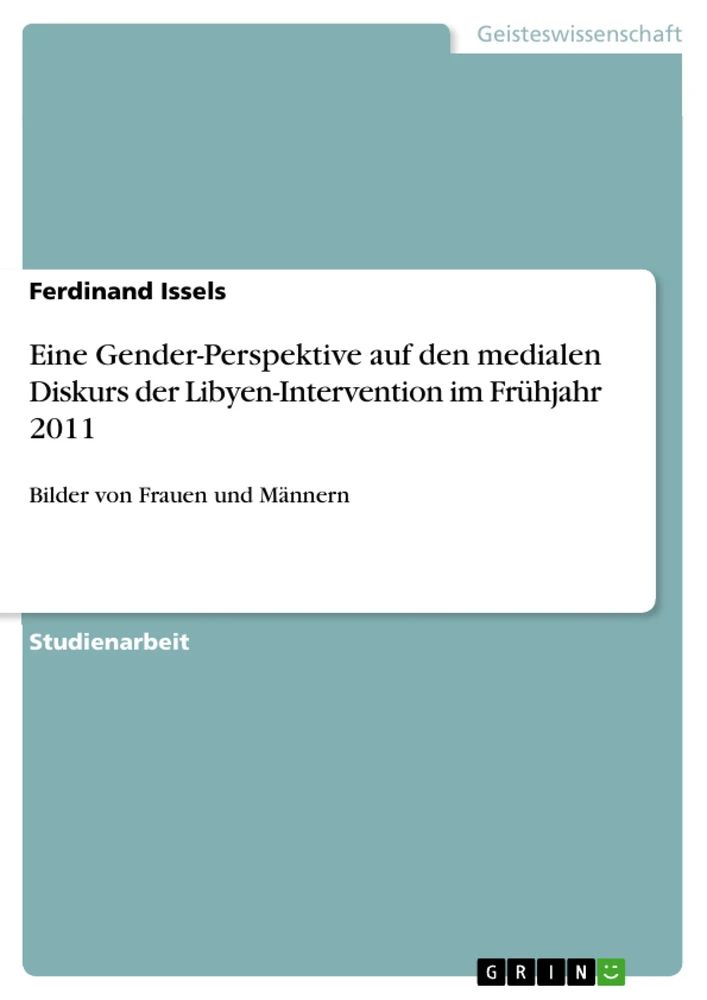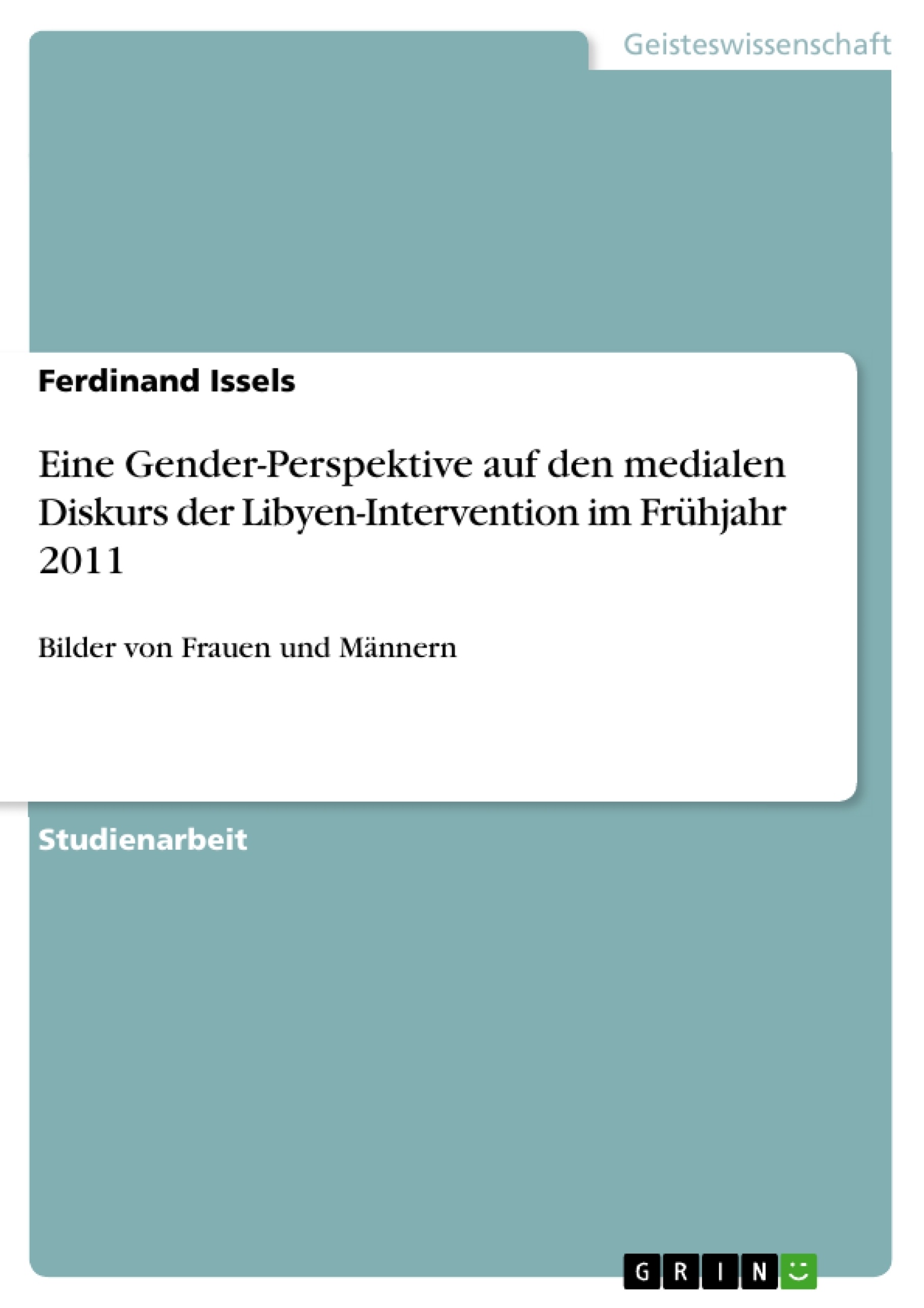Im ersten Abschnitt werden Belege dafür angeführt, dass Frauen für die Legitimation der Intervention von Bedeutung waren.
Im Anschluss wird anhand von Bildern im Kontext der Libyen-Intervention gezeigt, wie Frauen und Männer darauf wirken. Abbildungen von Männern symbolisierten demnach Stärke, Entschlossenheit und Aktivität. Diejenigen von Frauen lassen sie schwach, passiv und schutzbedürftig erscheinen. Insbesondere der diskursmächtige Fall Iman al-Obeidis vermittelt eindrücklich die Opferrolle der Frau.
Im dritten Abschnitt werden diese Befunde problematisiert. Dazu wird bewusst gemacht, dass Männer und Frauen ganz vielfältige Rollen im Bürgerkrieg spielten und Frauen in diversen Funktionen aktiv und engagiert am Widerstand beteiligt waren.
Angesichts dieser Tatsache sind sie auf den Bildern des Krieges massiv unterrepräsentiert. Die vorhandenen Bilder sind darüber hinaus falsch proportioniert, sodass ein verzerrter Eindruck des Schicksals von Frauen entsteht, der nicht der Wirklichkeit entspricht. Zudem wird gezeigt, dass sich die auf den Bildern konstruierten Geschlechter durch dichotome Schemata auszeichnen. Sie sind besonders problematisch, weil die Eigenschaften von Frauen durchweg negativ konnotiert sind. Somit tragen sie zur Reproduktion hierarchischer Geschlechterverhältnisse in der Gesellschaft bei.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie und Methoden
- 2.1 Theorieteil
- 2.2 Methodenteil
- 3. Durchführung
- 3.1 Die Bedeutung von Frauen und ihren Darstellungen für die Legitimation der Intervention
- 3.2 Die Bilder von Frauen und Männern im Kontext der Intervention
- 3.3 Die Problematik der Darstellungen von Männern und Frauen
- 4. Résumé
- 5. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den medialen Diskurs der Libyen-Intervention im Frühjahr 2011 unter einer Gender-Perspektive. Sie zielt darauf ab, die Bedeutung von Frauen und ihren Darstellungen im Kontext der Legitimation der Intervention aufzuzeigen und die Problematik der Stereotypisierung von Frauen im medialen Diskurs zu analysieren.
- Die Rolle von Frauenbildern in der Legitimation militärischer Interventionen
- Die Darstellung von Frauen und Männern im medialen Diskurs der Libyen-Intervention
- Die Problematik der Stereotypisierung von Frauen in medialen Darstellungen
- Der Einsatz des Postmodernen Feminismus als analytisches Werkzeug
- Die Bedeutung von visuellen Abbildungen in der Konstruktion von Gender und Krieg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Kontext der Libyen-Intervention und der Frage nach der Legitimation humanitärer Interventionen. Sie beleuchtet die Bedeutung von Frauen und ihren Darstellungen in der Debatte über Krieg und Frieden. Das zweite Kapitel beschreibt die theoretischen und methodischen Grundlagen der Arbeit, insbesondere die Anwendung des Postmodernen Feminismus auf den medialen Diskurs. Das dritte Kapitel untersucht empirisch die Darstellung von Frauen und Männern im Kontext der Libyen-Intervention, indem es auf Beispiele aus den Medien zurückgreift. Im Fokus steht dabei die Frage, ob und wie die Darstellung von Frauen zur Legitimation der Intervention beiträgt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Gender, medialer Diskurs, Libyen-Intervention, Postmoderner Feminismus, Stereotypisierung, visuelle Abbildungen, Krieg und Frieden. Die Arbeit untersucht, wie Frauen und Männer im medialen Diskurs dargestellt werden und welche Auswirkungen diese Darstellungen auf die Legitimation politischer Entscheidungen haben.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurden Frauen im medialen Diskurs der Libyen-Intervention dargestellt?
Frauen wurden oft als schwach, passiv und schutzbedürftig dargestellt, um die Notwendigkeit einer humanitären Intervention moralisch zu rechtfertigen.
Dienten Frauenbilder zur Legitimation des Krieges?
Ja, die Darstellung von Frauen als Opfer (wie im Fall von Iman al-Obeidi) wurde genutzt, um eine militärische Intervention als Rettungsaktion zu legitimieren.
Entsprachen die Medienbilder der Realität vor Ort?
Nein, die Arbeit zeigt, dass Frauen tatsächlich vielfältige und aktive Rollen im Widerstand spielten, in den Medien jedoch massiv unterrepräsentiert oder stereotypisiert wurden.
Was ist die Gefahr dieser stereotypen Darstellungen?
Sie tragen zur Reproduktion hierarchischer Geschlechterverhältnisse bei, indem sie Männern Stärke und Aktivität zuschreiben, während Frauen auf eine passive Opferrolle reduziert werden.
Welche Rolle spielt der postmoderne Feminismus in der Arbeit?
Der postmoderne Feminismus dient als analytisches Werkzeug, um die Konstruktion von Gender in Kriegsdiskursen zu dekonstruieren und die Machtverhältnisse hinter den Bildern aufzudecken.
- Arbeit zitieren
- Ferdinand Issels (Autor:in), 2012, Eine Gender-Perspektive auf den medialen Diskurs der Libyen-Intervention im Frühjahr 2011, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196193