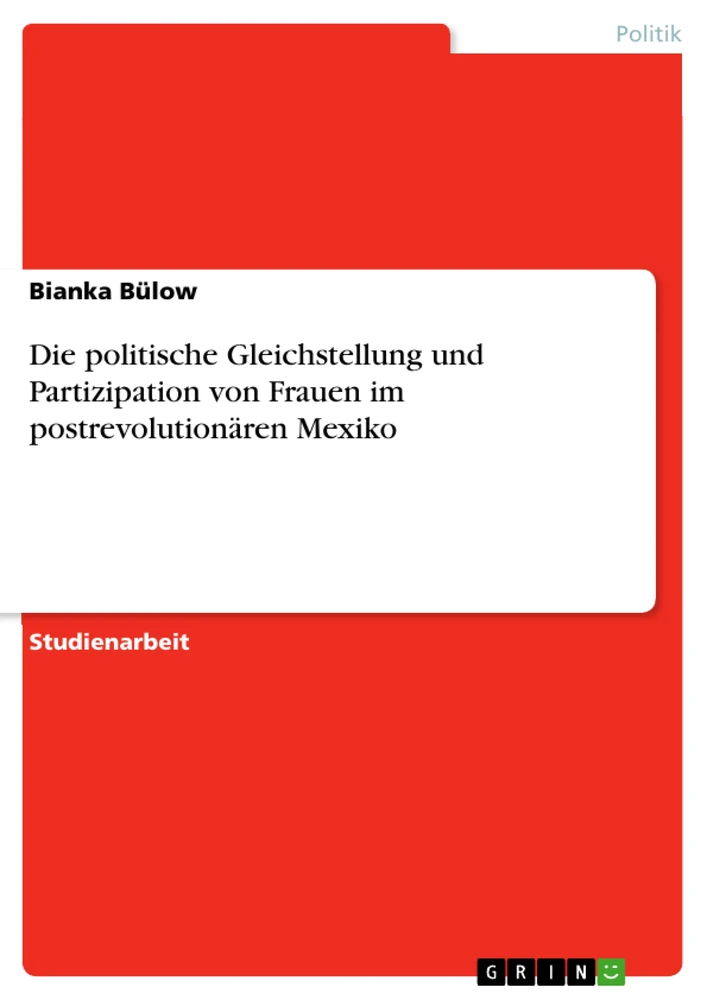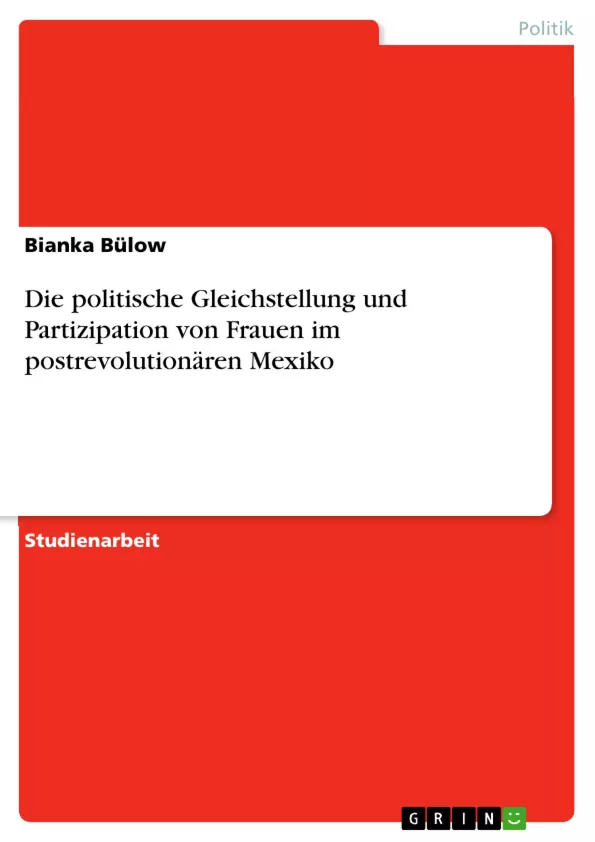Traditioneller Weise ist die Kultur in Mexiko männerdominiert und wird durch das Patriarchat und den lateinamerikanischen Machismo bestimmt. Der Mann gilt als Patron und unangefochtener Herrscher der Familie. Im Verlauf der 40er und 50er Jahre vermischte sich der mexikanische Männlichkeitskult zudem mit dem entstehenden Nationalismus, wodurch ‚Mexikaner sein‘ gleichbedeutend mit ‚Macho‘ und ‚Patron‘ wurde (vgl. Zapata Galindo 2001: 241). Die Kombination von Staat, Nation, Maskulinität und Herrscher stellte lange Zeit für Frauen eine unüberwindbare Hürde dar, sich politisch einzubringen. Das Politische gehörte ganz klar in die männliche Hemisphäre und eine Beteiligung von Frauen in Konferenzen und bei Entscheidungsprozessen war undenkbar. Frauen konnten in dieser Gesellschaft nur über die Rolle der keuschen Jungfrau oder fürsorglichen und gehorsamen Mutter bzw. Ehegattin zu sozialem Ansehen gelangen.
Seit der Mexikanischen Revolution Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich jedoch viel gewandelt. Feministinnen und soziale Bewegungen haben aktiv für die Promotion von Frauenrechten, die Gleichstellung der Geschlechter und die Beteiligung von Frauen am gesellschaftlichen Leben geworben.
Doch bis heute lässt der Gegensatz der dominanten, männlichen Kultur zur erstarkenden Frauenbewegung den Kampf um Gleichberechtigung zu einem besonderen Spannungsfeld gesellschaftlicher Interessen werden. In dieser Arbeit soll daher nicht nur das Ergebnis des Kampfes um Anerkennung betrachtet werden, sondern auch der Prozess an sich. Es soll der schrittweisen politischen Geschlechtergleichstellung nachgespürt werden. Da die Politik als traditionell (rein-) männliche Sphäre die Widerstände, Kämpfe und Versuche um Anerkennung sehr stark wiederspiegelt. Zentrale Fragen werden sein: Wo steht die Gleichberechtigung und politische Partizipation von Frauen heute und wie viel Wandel hat tatsächlich stattgefunden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Anfänge politischer Geschlechtergleichstellung: Von der Mexikanischen Revolution bis zum vollen Wahlrecht für Frauen (1910 - 1953)
- Die Entwicklungen der politisch-juristischen Gleichstellung der Geschlechter und ihre Promotoren nach 1953
- Nationale und internationale Politik
- Feministische Bewegungen und wissenschaftliche Diskurse
- Frauen in der Politik ab 1953 – eine Bestandsaufnahme der Partizipation
- Die Bundesebene
- Die Regionalregierungen und Munizipien
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklungen der politischen Gleichstellung und Partizipation von Frauen im postrevolutionären Mexiko. Die Analyse betrachtet die historischen Wurzeln des Problems, die Fortschritte in der politischen und juristischen Gleichstellung sowie die Rolle von feministischen Bewegungen und wissenschaftlichen Diskursen. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit die aktuelle Situation der weiblichen Partizipation auf Bundes- und Regionalebene.
- Historische Entwicklungen der politischen Geschlechtergleichstellung in Mexiko
- Rolle des mexikanischen Machismo und seine Auswirkungen auf die politische Partizipation von Frauen
- Fortschritte in der politischen und juristischen Gleichstellung von Frauen nach 1953
- Einfluss von feministischen Bewegungen und wissenschaftlichen Diskursen auf die Gleichstellung der Geschlechter
- Aktuelle Situation der politischen Partizipation von Frauen auf Bundes- und Regionalebene
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema der politischen Gleichstellung und Partizipation von Frauen im postrevolutionären Mexiko ein und skizziert die dominanten kulturellen und historischen Einflüsse, die die Rolle der Frau in der Gesellschaft prägten. Dabei wird insbesondere auf den Einfluss des mexikanischen Machismo und die Auswirkungen auf die politische Einbindung von Frauen eingegangen.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die Anfänge politischer Geschlechtergleichstellung in Mexiko und zeichnet die Entwicklungen vom Beginn der Mexikanischen Revolution bis zur Einführung des vollen Wahlrechts für Frauen im Jahr 1953 nach. Es werden wichtige Meilensteine und die Rolle von Schlüsselpersonen in diesem Prozess hervorgehoben.
- Das dritte Kapitel untersucht die Entwicklungen der politisch-juristischen Gleichstellung der Geschlechter nach 1953 und analysiert die Rolle nationaler und internationaler Politik, feministischer Bewegungen und wissenschaftlicher Diskurse in diesem Prozess. Das Kapitel beleuchtet wichtige politische und gesellschaftliche Veränderungen, die die Gleichstellung von Frauen beeinflussten und die Auswirkungen auf die politische und soziale Landschaft Mexikos.
- Das vierte Kapitel bietet eine Bestandsaufnahme der Partizipation von Frauen in der Politik ab 1953 und betrachtet die Situation auf Bundesebene und in den Regionalregierungen und Munizipien. Es werden konkrete Zahlen und Statistiken zu weiblicher Repräsentation in politischen Gremien und Entscheidungspositionen präsentiert und die Gründe für die Unterschiede in der Partizipation auf verschiedenen Ebenen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Mexiko, politische Gleichstellung, Geschlechtergleichstellung, Partizipation von Frauen, mexikanischer Machismo, feministische Bewegungen, wissenschaftliche Diskurse, politische Repräsentation, Bundesebene, Regionalregierungen, Munizipien, Wahlrecht, Feminizide, Frauenrechte.
Häufig gestellte Fragen
Wann erhielten Frauen in Mexiko das volle Wahlrecht?
Frauen erhielten in Mexiko im Jahr 1953 das volle aktive und passive Wahlrecht auf Bundesebene.
Was ist der "Machismo" und wie beeinflusst er die Politik?
Machismo ist ein Männlichkeitskult, der den Mann als unangefochtenen Herrscher sieht. In Mexiko erschwerte dies Frauen lange Zeit den Zugang zu politischen Entscheidungsprozessen.
Welche Rolle spielte die Mexikanische Revolution für Frauenrechte?
Die Revolution Anfang des 20. Jahrhunderts war der Startschuss für soziale Bewegungen und Feministinnen, die verstärkt für Gleichstellung und Partizipation kämpften.
Wie sieht die politische Partizipation von Frauen heute in Mexiko aus?
Es gibt Fortschritte auf Bundesebene, jedoch bestehen auf regionaler Ebene und in Munizipien weiterhin große Widerstände durch traditionelle patriarchale Strukturen.
Welche Faktoren fördern die Gleichstellung in Mexiko?
Internationale Politik, feministische Bewegungen und wissenschaftliche Diskurse sind wesentliche Promotoren für die juristische und soziale Gleichstellung.
- Citar trabajo
- Bianka Bülow (Autor), 2012, Die politische Gleichstellung und Partizipation von Frauen im postrevolutionären Mexiko , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196221