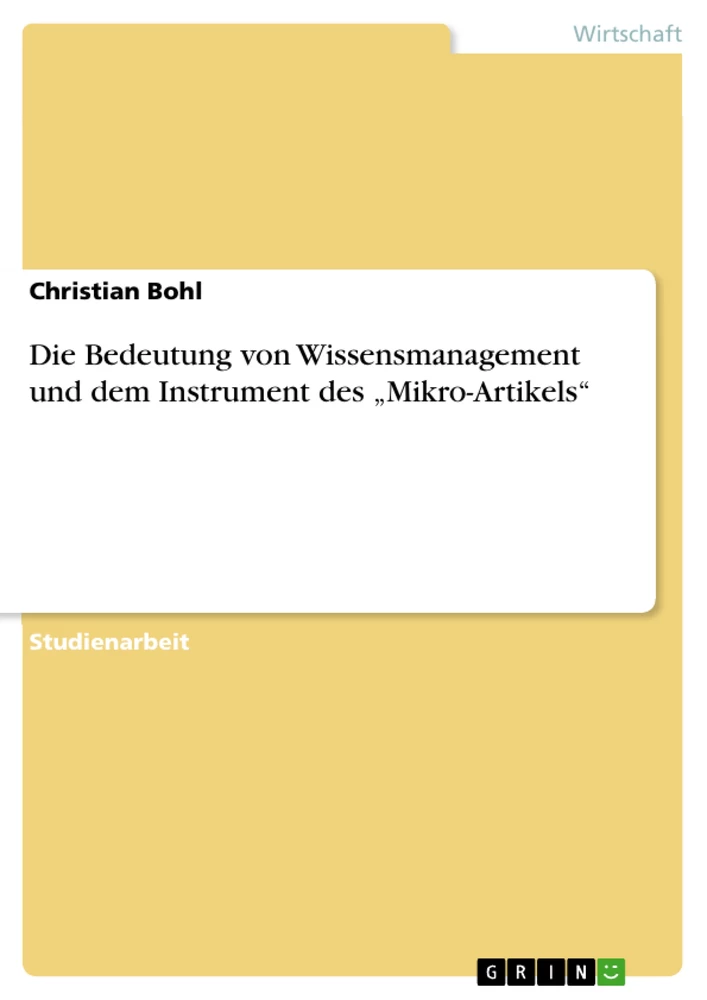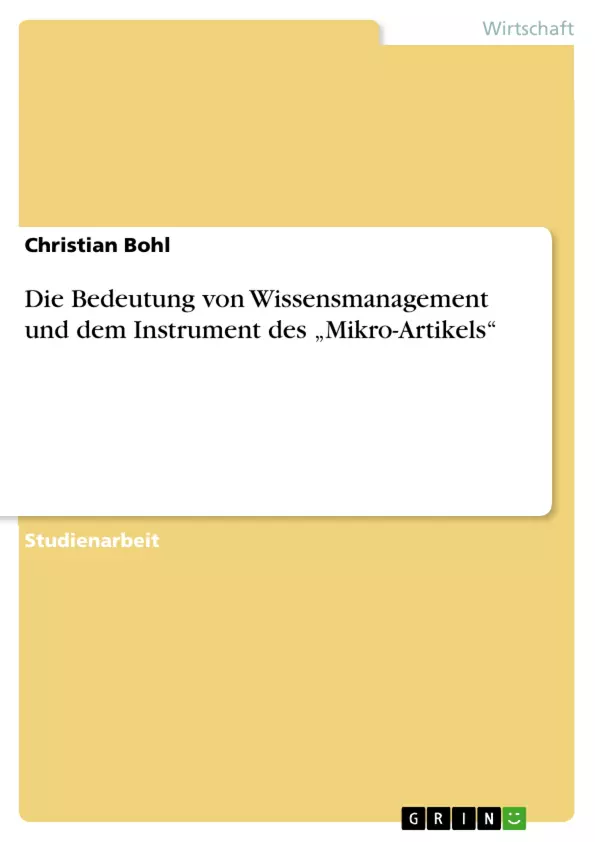Wenn man sich mit dem Begriff des „Wissensmanagements“ beschäftigt, so wird man auf zwei japanische Autoren stoßen (Takeuchi und Nonaka).
Als Mitbegründer des Wissensmanagements können die Japaner Ikujiro Nonaka und Hirotaka Takeuchi mit ihrem 1995 veröffentlichtem Buch „The Knowledge Creating Company“ (deutsch 1997 als „Die Organisation des Wissens“) angesehen werden (Wissensmanagement, (http://de.wikepedia.org/wiki/Wissensmanagement).
Sie haben den Begriff „Wissensmanagement“ definiert als “ den Prozess der kontinuierlichen Erzeugung von Wissen, seiner weiten organisationalen Verbreitung, und dessen rascher Verkörperung in neuen Produkten, Dienstleistungen und Systemen“(vgl. Takeuchi, Hirotaka., Nonaka, Ikujiro, & Hitotsubashi-Daigaku. (2004). Hitotsubashi on knowledge management. Singapore: 9).Bei der Entwicklung des Begriffes ging es hauptsächlich um das Verwalten und Aufbereiten von Wissen für industrielle Unternehmen.
Heutzutage findet seine Anwendung nicht nur in der Industrie statt, sondern der Begriff des „Wissensmanagements“ wird in den verschiedensten Bereichen verwendet. In der wissenschaflichen Arbeit hat er sich mittlerweile sehr stark etabliert und ist nicht mehr wegzudenken.
Da sich die Gesellschaft von der Industriegesellschaft zu einer Wissensgesellschaft entwickelt hat, ist das „Wissen“ zu einer der wichtigsten Ressourcen geworden (vgl. Wilke, H.: Einführung in das systemische Wissensmanagement.2004. Heidelberg: 27). Mit dem „Wissen“ als wichtigstem Kapital einer Gesellschafft stellt sich eine Vielfallt an Fragen zur Speicherung, dem Umgang, der Standardisierung und der Weitergabe des persönlichen, firmenbasierten und gesellschaftlichen Wissens. Mit Hilfe des Wissensmanagements wird versucht, dem oft verwendeten Begriff der „Informationsflut“ und deren inhaltlichen Auswirkungen entgegen zu wirken. Dem einzelnen Individuum soll mit Hilfe des Wissensmanagements geholfen werden, sein eigenes spezielles Wissen genauer zu strukturieren, genauer zu speichern und genauer abrufen zu können. Firmen nutzen Methoden, Techniken und Instrumente des „Wissensmanagement“, um ihr spezielles Wissen optimaler weiterzugeben und es besser nutzen zu können.
Im weiteren Verlauf werde ich mich hauptsächlich auf Helmut Wilke und dessen Werk „Einführung in das systemische Wissensmanagement“ beziehen.[...]
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Positionierung
1.2 Helmut Wilke
2. Wissensmanagement
2.1 Der Nutzen von Wissensmanagement
3. Der Mikroartikel als Instrument im Wissensmanagement
3.1 Aufbau des Mikroartikels
3.1.1 Thema
3.1.2 Geschichte
3.1.3 Einsichten
3.1.4 Schlussfolgerungen
3.1.5 Anschlussfragen
3.2 Verfassen eines eigenen MikroArtikels
4. Zusammenfassung
5. Literaturverzeichnis und Quellen
- Arbeit zitieren
- Christian Bohl (Autor:in), 2009, Die Bedeutung von Wissensmanagement und dem Instrument des „Mikro-Artikels“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196244