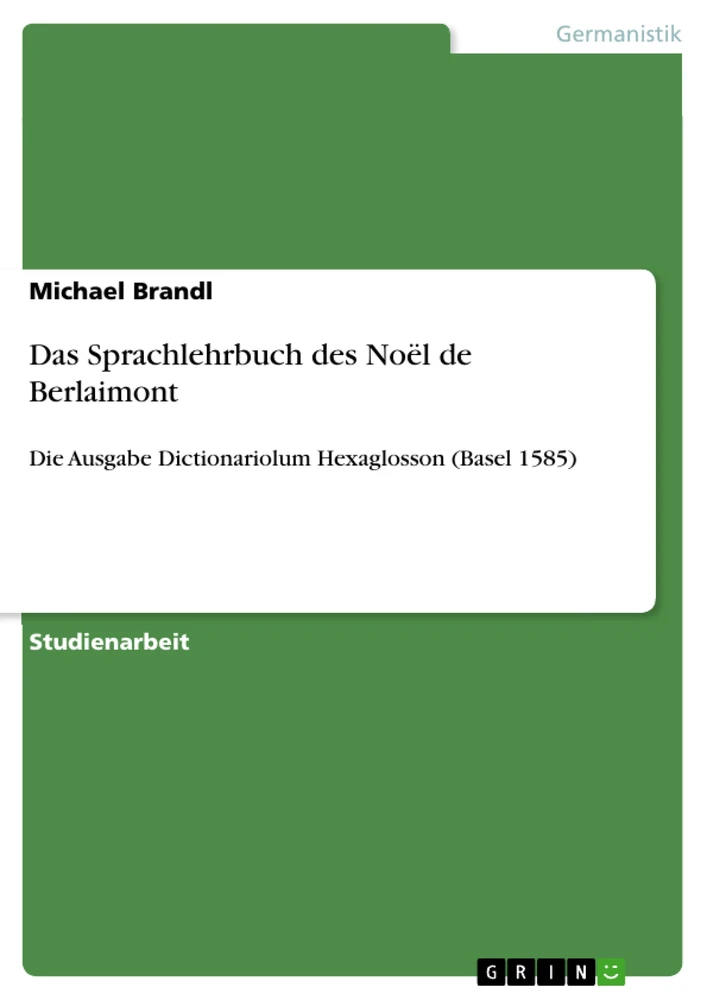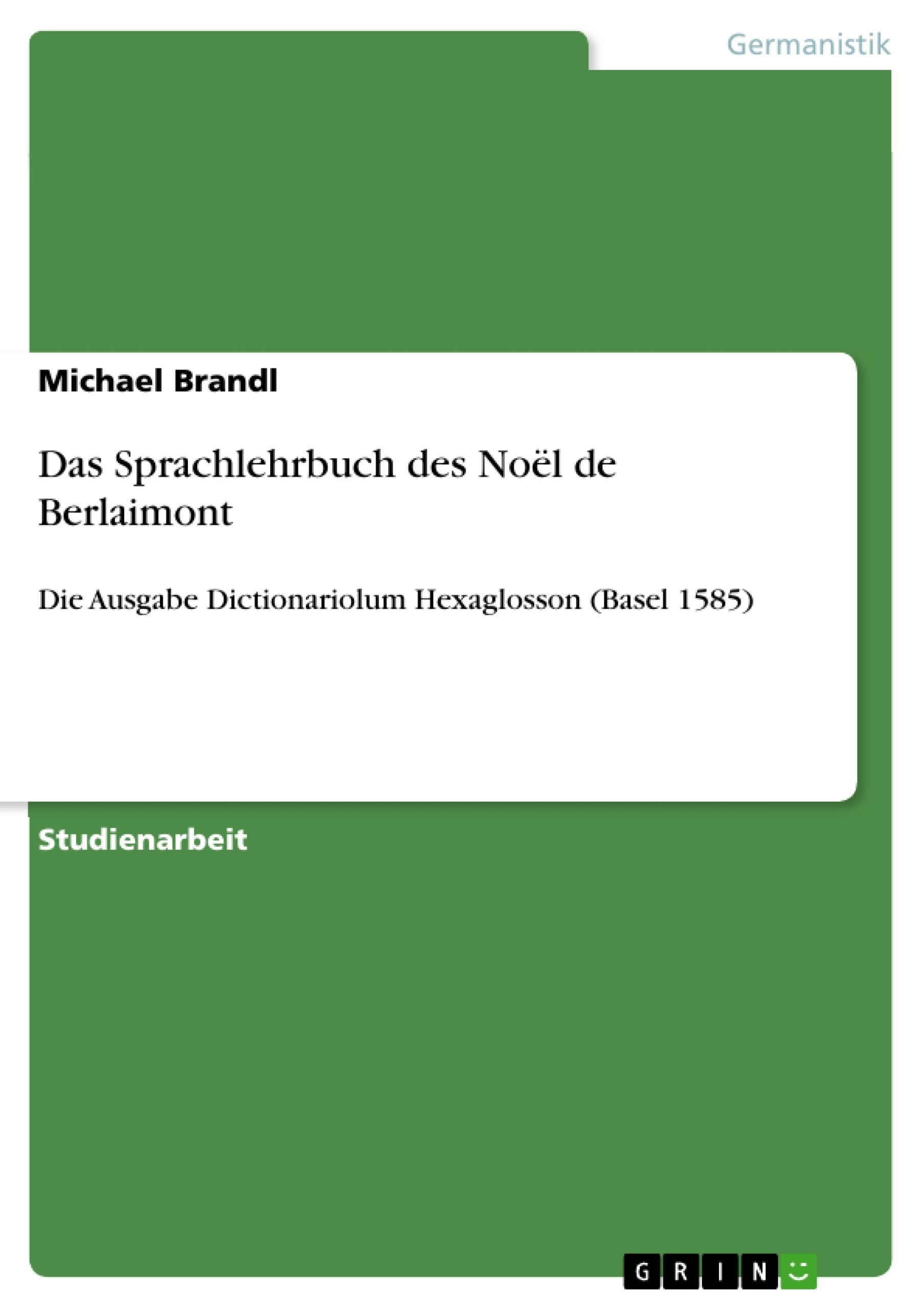Wer heutzutage eine Fremdsprache lernen möchte, dem bieten sich unterschiedlichste Möglichkeiten. Ob in der Schule, in Fremdsprachenkursen oder autodidaktisch mit Hilfe von moderner Computersoftware – selbst exotische Sprachen können so relativ prob-lemlos einstudiert werden.
Blickt man jedoch einige hundert Jahre in der Geschichte zurück, dann kann festgestellt werden, dass sich Fremdsprachenerwerb im Mittelalter und in der frühen Neuzeit nicht ganz so einfach gestaltete. Nicht jedem Interessierten war es ohne Weiteres möglich, eine beliebige Fremdsprache zu erlernen, da dieses Privileg meist nur Wohlhabenden offen stand. Trotz allem bestand häufig ein Bedürfnis danach, in anderen Sprachen, als der eigenen, gebildet zu sein – sei es aus wirtschaftlichen oder politischen Motiven. Immer mehr fand sich dabei auch das Bemühen, das Deutsche als Sprache zu erlernen. Besonders seit dem 15. Jahrhundert zeigten viele Autoren ihr Bestreben, Lehrbücher dafür zu verfassen.
Das Dictionariolum Hexaglosson, das „zu einer Gruppe von vor allem im niederländi-schen Sprachraum gedruckten Werken (…), die auf das niederländisch-französische Vocabulare des Antwerpener schoolmeesters Noël de Berlaimont (gest. 1531) zurück-gehen“ , gehört, steht in der Tradition dieser sog. Sprachlehrbücher des Mittelalters und der frühen Neuzeit. In verschiedenen Mustergesprächen und mit Hilfe unterschiedlicher Übersichten und Übungen sollte zweckmäßiger Spracherwerb ermöglicht werden. Das Deutsche nahm dabei keine zentrale Rolle ein, sondern stand – in diesem Fall - neben fünf weiteren Sprachen.
Im Verlauf dieser Arbeit möchte ich mich nun näher mit diesem Sprachführer-Vokabular, das 1585 in Bern gedruckt wurde, auseinandersetzen und einer Gesamt-vorstellung des Werks eine genauere Analyse folgen lassen. Dabei soll primär auch der Frage nachgegangen werden, für wen dieses Sprachlehrbuch überhaupt konzipiert wurde und wie hilfreich es letztlich für den Erwerb des Deutschen gewesen sein könnte. Daher erscheint es sinnvoll, zunächst zu erläutern, aus welchen Gründen Deutsch im Mittelalter gelernt wurde um das Dictionariolum Hexaglosson besser in den historischen Kontext einordnen zu können, bevor Aufbau und Analyse des Buchs anschließen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Gründe für Fremdsprachenerwerb
- Fernhandel und „deutsche Schulen“
- Handwerkerwanderungen
- Schüleraustausch und Fernheirat
- Fernreisen
- Akademische Wanderungen
- Die Kavalierstour
- Fahrendes Volk
- Migration und Sprachwechsel
- Zusammenfassung
- Das Dictionariolum Hexaglosson
- Allgemeines
- Aufbau
- Analyse
- Mustergespräche
- Zahlen und Wochentage
- Brief und Schuldverschreibung
- Vokabular
- Konjugationsübungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit dem Dictionariolum Hexaglosson, einem Sprachlehrbuch aus dem 16. Jahrhundert, das in sechs Sprachen - Deutsch, Latein, Niederländisch, Französisch, Spanisch und Italienisch - abgefasst ist. Das Hauptziel der Arbeit ist es, den Aufbau und die Inhalte des Werks zu analysieren und die Zielgruppe sowie den didaktischen Wert des Buches im historischen Kontext zu beleuchten. Im Fokus stehen dabei die Frage nach dem für wen das Lehrbuch konzipiert wurde, wie hilfreich es für den Erwerb der deutschen Sprache gewesen sein könnte und welche didaktischen Schwächen es aufweist.
- Gründe für den Erwerb der deutschen Sprache im Mittelalter und der frühen Neuzeit
- Aufbau und Struktur des Dictionariolum Hexaglosson
- Didaktische Analyse der Mustergespräche, Tabellen und Übungseinheiten
- Die Zielgruppe des Werks und der Einsatz des Lateinischen als Lemmasprache
- Bewertung des didaktischen Werts des Lehrbuchs im Hinblick auf den Erwerb der deutschen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel beleuchtet die verschiedenen Gründe, warum Deutsch im Mittelalter und der frühen Neuzeit als Fremdsprache gelernt wurde. Es werden verschiedene soziale Gruppen wie Kaufleute, Handwerker, Studenten und Reisende betrachtet, die aus unterschiedlichen Motiven heraus Fremdsprachenkenntnisse erlangten. Das zweite Kapitel widmet sich dem Dictionariolum Hexaglosson. Zunächst wird das Werk in seinen historischen Kontext eingeordnet und seine Entstehung sowie die zahlreichen Auflagen in unterschiedlichen Sprachkombinationen betrachtet. Im Anschluss wird der Aufbau des Buches in seine beiden Teile (Mustergespräche und Vokabular) vorgestellt, die jeweils auf unterschiedliche Kommunikationsbereiche abzielen. Die Mustergespräche, die verschiedene Alltagssituationen wie Tischgespräche, Kaufhandlungen oder den Schriftverkehr simulieren, werden anschließend genauer analysiert. Dabei wird auch die Frage nach dem didaktischen Wert dieser Übungseinheiten beleuchtet. Ebenso werden die Tabellen mit Zahlen und Wochentagen sowie die Vorlagen für Briefe und Schuldverschreibungen näher betrachtet. Das Vokabular, das unabhängig von den Mustergesprächen als Wortschatzspeicher dienen soll, wird hinsichtlich seiner alphabetischen Anordnung und dem Einsatz des Lateinischen als Lemmasprache untersucht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Erwerb des Deutschen als Fremdsprache im Mittelalter und der frühen Neuzeit, insbesondere mit dem Dictionariolum Hexaglosson, einem Sprachlehrbuch aus dem 16. Jahrhundert. Die Schwerpunkte der Arbeit liegen auf der Analyse des Aufbaus und der Inhalte des Buches, der Identifizierung der Zielgruppe und der Bewertung des didaktischen Werts des Werks. Zentral sind dabei die Frage nach der didaktischen Gestaltung, dem Einsatz des Lateinischen als Lemmasprache und den Möglichkeiten des Fremdsprachenerwerbs mit Hilfe des Dictionariolum Hexaglosson.
Häufig gestellte Fragen zum Dictionariolum Hexaglosson
Was ist das Dictionariolum Hexaglosson?
Ein sechssprachiges Lehrbuch aus dem 16. Jahrhundert, das Reisenden und Kaufleuten beim Erlernen von Fremdsprachen (u.a. Deutsch) half.
Warum lernte man im Mittelalter Deutsch?
Gründe waren primär der Fernhandel, Handwerkerwanderungen, diplomatische Reisen oder akademische Wanderungen von Studenten.
Wie war das Sprachlehrbuch aufgebaut?
Es enthielt Mustergespräche für Alltagssituationen (Essen, Handel), Vokabellisten, Zahlen sowie Vorlagen für Briefe und Schuldverschreibungen.
Welche Sprachen waren im Hexaglosson enthalten?
In der Regel Deutsch, Latein, Niederländisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.
Wie effektiv war das Buch für den Spracherwerb?
Es bot praktische Phrasen für den Alltag, hatte jedoch didaktische Schwächen, da Grammatik nur oberflächlich (z.B. Konjugationstabellen) behandelt wurde.
- Arbeit zitieren
- Michael Brandl (Autor:in), 2011, Das Sprachlehrbuch des Noël de Berlaimont, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196301