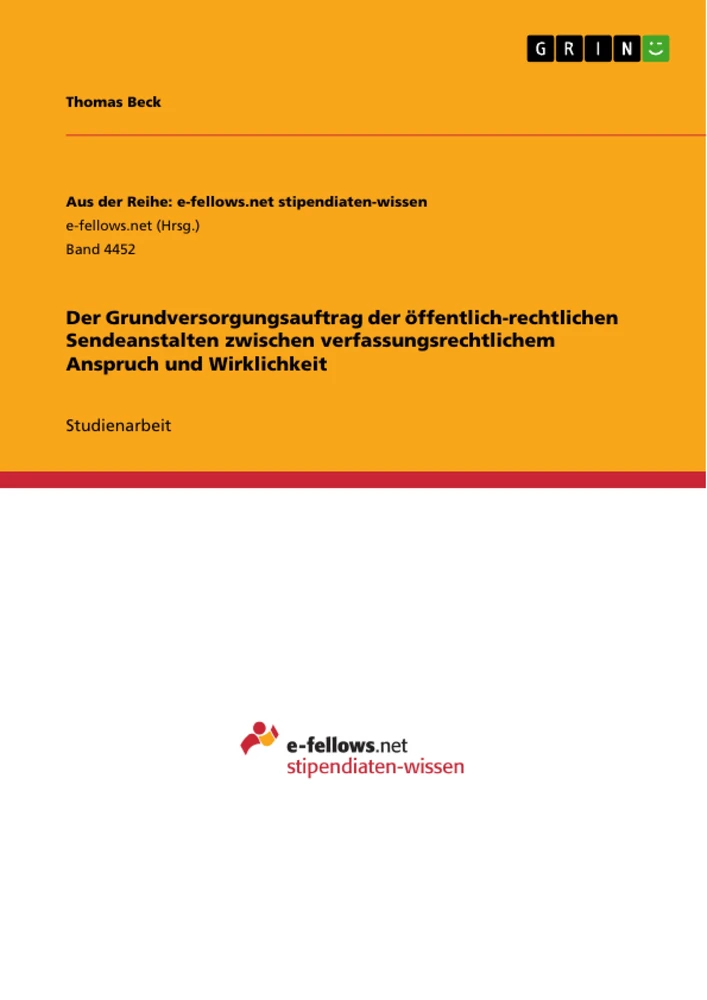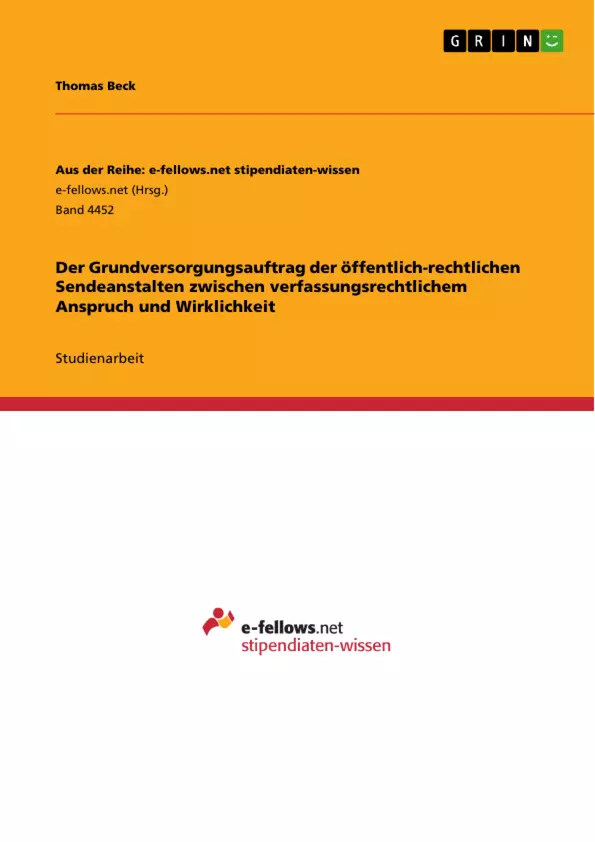„Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk (...) scheint es gut zu gehen“ , konstatiert der Autor Jens Jessen im Juli 2010 in einem Leitartikel der renommierten Wochenzeitung Die ZEIT. Nicht nur habe er jüngst ein Gesetz ertrotz, dass es ihm gestatte die Rundfunkgebühr pauschal in jedem Haushalt zu erheben, sondern er expandiere auch noch ungehemmt und gegen alle Widerstände im Internet. Gerade diese politischen und juristischen Siege seien es allerdings - so die Pointe -, welche die Legitimationskrise eines Systems verschärfen würden, das in Wahrheit nur noch wenig von dem liefere, was seine Gebührenfinanzierung noch rechtfertigen könne. Legitimationskrise ist also das entscheidende Stichwort. Wer Bruce-Darnell über die Frankfurter Laufstege dahinschweben sieht oder den neusten Pop-Klängen der bayerischen Rundfunksender lauscht wird sich zu recht selbst schon einmal die Frage gestellt haben: Warum das alles? Wie kann es einem mittels Gebühren finanziertem Rundfunk gestattet sein Sendungen anzubieten, die private Anbieter ohne weiteres auch selbst offerieren könnten? Inwiefern unterscheidet er sich eigentlich noch von seinen Gegenspielern? Kurz: Welche Aufgabe wird dem öffentlich-rechtlichem Rundfunk im dualen System zuteil, wie umfangreich darf sein Angebot sein und sind so manche programmliche Auswüchse mit seinem ursprünglichen Auftrag überhaupt noch vereinbar?
Auf eben jene Fragen versucht diese Arbeit die richtigen Antworten zu geben. Ihr Ziel ist es, möglichst allgemeinverständlich und überblicksartig den besonderen, aus dem Grundgesetz abgeleiteten Versorgungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten zu erklären und in seinen vielfältigen Facetten nachvollziehbar darzustellen. Zu den wichtigsten literarischen Referenzpunkten zählen hierbei die Dissertationen von Juliane Lindschau (Berlin 2007), Roland Scheble (Berlin 1994), wie auch Jörn Witt (Berlin 2006). Auch die Vorgehensweise lässt sich mithilfe einer klassischen Trias darstellen. Zuerst wird der Grundversorgungsauftrag in seiner historischen Dimension hinreichend lokalisiert und anhand der Chronologie der Karlsruher Rechtssprechung entsprechend kontextualisiert. Darauf folgt eine Episode der Präzisierung mittels Ableitung der Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichtes aus Art 5. GG, der Erfassung der Rechtssprechungslogik des Niedersachsenurteils und der Aufschlüsselung des Grundversorgungsauftrages in seine drei Elemente nebst funktionaler Komponente.
Inhaltsverzeichnis
- PROLOG
- HISTORISCHER KONTEXT UND CHRONOLOGIE DER RECHTSSPRECHUNG
- VOM MONOPOLISTISCHEN STAATSFERNSEHEN ZUM DUALEN RUNDFUNKSYSTEM
- NIEDERSACHSEN-URTEIL ALS GEBURTSSTUNDE DES GRUNDVERSORGUNGSAUFTRAGES
- WEITERE KONKRETISIERUNGEN IM BADEN-WÜRTTEMBERG-BESCHLUSS UND WDR-URTEIL
- DER GRUNDVERSORGUNGSAUFTRAG
- VERFASSUNGSRECHTLICHER REFERENZRAHMEN
- ARGUMENTATIONSLOGIK HÖCHSTRICHTERLICHER RECHTSSPRECHUNG
- DREI SÄULEN DES GRUNDVERSORGUNGSAUFTRAGES
- KOPPELUNG AN DIE BESTANDS- UND ENTWICKLUNGSGARANTIE
- ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG
- INTERNETANGEBOTE ALS BESTANDTEIL DER GRUNDVERSORGUNG
- RECHTSGRUNDLAGE UND GENEHMIGUNGSVERFAHREN
- ,,NEUE DIENSTE“ ALS NEBENPRODUKT DES KLASSISCHEN RUNDFUNKAUFTRAGES?
- GEBÜHRENFINANZIERUNG ALS UNIVERSELLE KONFLIKTQUELLE
- DAS ARGUMENT DER WETTBEWERBSVERZERRUNG AUS DER PERSPEKTIVE DES EU-RECHTS
- EPILOG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, den Grundversorgungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten im dualen Rundfunksystem in seiner historischen Entwicklung und rechtlichen Grundlage zu beleuchten. Sie analysiert die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, die diesen Auftrag prägen und beleuchtet die Herausforderungen, die sich durch die Digitalisierung und das Internet ergeben.
- Der historische Kontext der Entwicklung des dualen Rundfunksystems
- Die rechtliche Grundlage des Grundversorgungsauftrags im Grundgesetz
- Die drei Säulen des Grundversorgungsauftrags: Information, Bildung und Unterhaltung
- Die Rolle des Internet im Rahmen der Grundversorgung
- Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Der Prolog erläutert den aktuellen Stand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Kontext der Legitimationskrise und stellt die Forschungsfrage nach der Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im dualen System.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel zeichnet die Entwicklung des Grundversorgungsauftrages im Laufe der Geschichte nach, beginnend mit dem monopolistischen Staatsfernsehen bis hin zur Einführung des dualen Rundfunksystems.
- Kapitel 3: Dieser Abschnitt beleuchtet den verfassungsrechtlichen Rahmen des Grundversorgungsauftrags, analysiert die Argumentationslogik der Rechtsprechung und erklärt die drei Säulen des Auftrags.
- Kapitel 4: Das Kapitel diskutiert die Herausforderungen, die sich aus der Digitalisierung und dem Internet für den Grundversorgungsauftrag ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Grundversorgungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, dem dualen Rundfunksystem, dem Verfassungsrecht, dem Niedersachsen-Urteil, dem Baden-Württemberg-Beschluss, dem WDR-Urteil, dem Internet, den neuen Diensten, der Gebührenfinanzierung, dem Wettbewerb und dem EU-Recht.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Grundversorgungsauftrag?
Es ist die verfassungsrechtlich verankerte Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die Bevölkerung mit Information, Bildung und Unterhaltung zu versorgen.
Auf welcher rechtlichen Basis beruht dieser Auftrag?
Die Grundlage bildet Artikel 5 des Grundgesetzes sowie die maßgebliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (z. B. das Niedersachsen-Urteil).
Dürfen öffentlich-rechtliche Sender auch im Internet expandieren?
Ja, das Internet wird zunehmend als Teil der Grundversorgung gesehen, was jedoch oft zu Konflikten mit privaten Anbietern führt.
Warum steht die Gebührenfinanzierung in der Kritik?
Kritiker bemängeln eine „Legitimationskrise“, wenn öffentlich-rechtliche Inhalte sich kaum noch von denen privater Anbieter unterscheiden.
Was sind die „drei Säulen“ des Grundversorgungsauftrages?
Die Säulen umfassen die umfassende Information, die kulturelle Bildung sowie die Unterhaltung mit einem gewissen Qualitätsanspruch.
- Arbeit zitieren
- Thomas Beck (Autor:in), 2011, Der Grundversorgungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten zwischen verfassungsrechtlichem Anspruch und Wirklichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196352