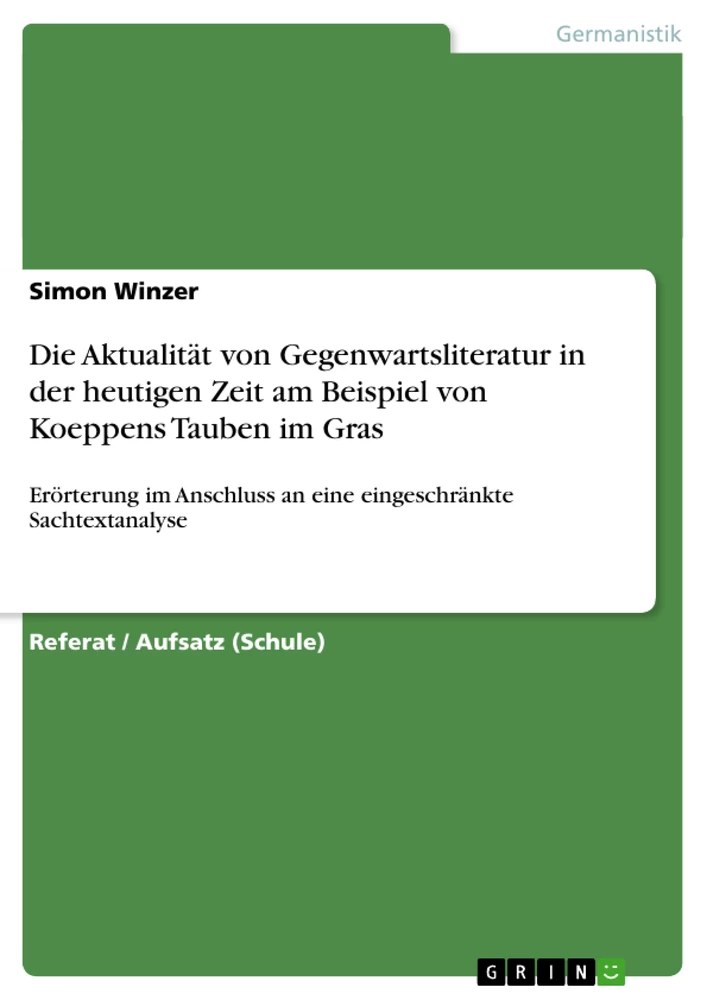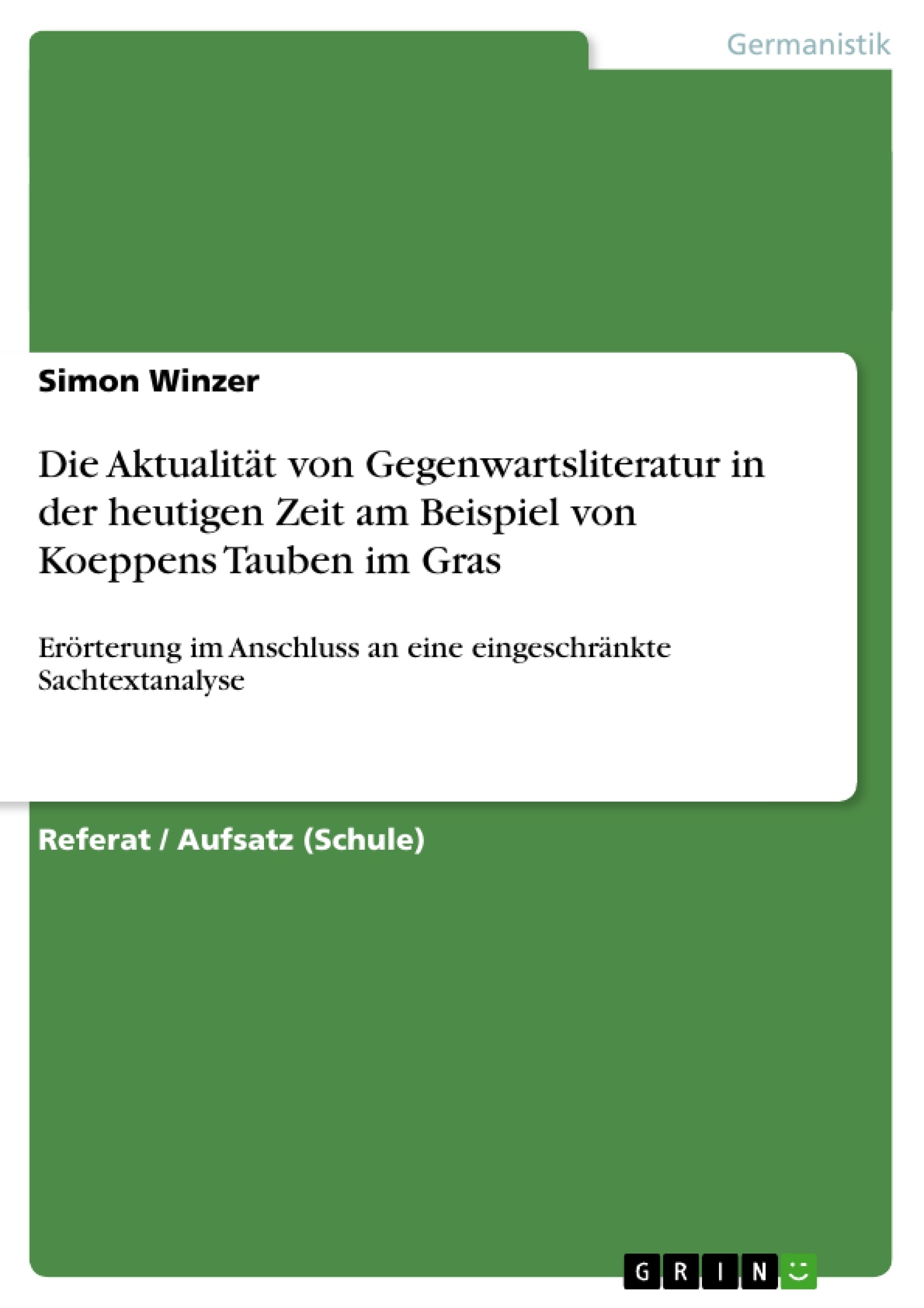Diese Arbeit behandelt die Aktualität von der Gegenwartsliteratur Wolfgang Koeppens. Zunächst kommt es zu einer eingeschränkten Sachtextanalyse aus einem Auszug des Literarhistorischen Jochen Vogt, der die Werke Koeppens beurteilt und auf deren Aktualität eingeht. Im Anschluss daran kommt es zu der Erörterung der Frage, wie aktuell Koeppen wirklich ist, am Beispiel seines Romans „Tauben im Gras“, das streng genommen eine Trilogie mit den Werken „Das Treibhaus“ und „Der Tod in Rom“ bildet.
Auch wird sie aufzeigen, dass Gegenwartsliteratur noch heute, auch wenn auf einem anderen Medium, immer noch aktuell und modern ist.
Einleitung
Diese Arbeit behandelt die Aktualität von der Gegenwartsliteratur Wolfgang Koeppens. Zunächst kommt es zu einer eingeschränkten Sachtextanalyse aus einem Auszug des Literarhistorischen Jochen Vogt, der die Werke Koeppens beurteilt und auf deren Aktualität eingeht. Im Anschluss daran kommt es zu der Erörterung der Frage, wie aktuell Koeppen wirklich ist, am Beispiel seines Romans „Tauben im Gras“, das streng genommen eine Trilogie mit den Werken „Das Treibhaus“ und „Der Tod in Rom“ bildet.
Auch wird sie aufzeigen, dass Gegenwartsliteratur noch heute, auch wenn auf einem anderen Medium, immer noch aktuell und modern ist.
Die Frage nach der Aktualität von Koeppens „Tauben im Gras“
Der Aufsatz und Sachtext „Modelle nonkonformistischen Erzählens - Wolfgang Koeppens Romane“ von Jochen Vogt, erschienen 1986 beim „Carl Hanser Verlag“ in München, handelt von einer Kritik zu Wolfgang Koeppens Roman „Tauben im Gras“, beinhaltet aber auch einen Vergleich des Werkes zu den Schriftstücken anderer Autoren.
In seinem Aufsatz stellt Vogt die Hypothese auf, dass „Tauben im Gras“ zwar ein sehr guter Roman ist, der modern und den Schriften der Künstler seiner Zeit weit voraus gewesen ist, das Buch sich in der damaligen Zeit aber keiner großen Beliebtheit erfreut habe und oft zu Unrecht kritisiert worden sei. Der Sachtext Vogts lässt sich in vier Sinnabschnitte einteilen:
1. Einleitung und (positive) Kritik des Romans (Z. 1-29)
2. Die Personengruppen des Romans und ihre Bedeutungen (Z. 30-50)
3. Die Technik und der Schreibstil des Romans (Z. 51 - 63)
4. Die Meinung in der Öffentlichkeit (Z. 64-77)
Zu Beginn des ersten Abschnitts leitet Vogt seinen Text ein. Hier erwähnt der Verfasser, Koeppen habe 1934 und 1935 bereits zwei kaum beachtete Romane geschrieben, die größtenteils unbekannt gewesen seien, bevor es zwischen 1951 und 1954 zu der Veröffentlichung seiner bekanntesten drei Werke (darunter auch „Tauben im Gras“) gekommen sei.
Im weiteren Verlauf des ersten Sinnabschnittes rezensiert Jochen Vogt die Arbeit Koeppens. Der Kritiker lobt die Werke, da sich „Tauben im Gras“ zum Beispiel mit den „Fall des eisernen Vorhanges“, aber auch noch mit dem Verbleibt des Faschismus auseinandersetze und Koeppen sich im Gegensatz zu anderen Schriftstellern nicht um die Distanz zu den Erlebnissen des Zweiten Weltkrieges bemühe.
„Die Nachkriegsjahre, Wiederaufschwung und Wohlleben versprechend […]“ (Z. 12 f.).
Mit dieser Aufzählung drückt Vogt lobend aus, auf was für eine Vielzahl an Aspekten Wolfgang Koeppen in seinen Büchern eingeht. Auch ist Vogt über die Interpretationsgabe Koeppens begeistert. So habe dieser die Vorkriegszeit mit Korea durchschaut und den bleibenden Hass gegen andere Völker als Gefahr für die Zukunft gesehen.
Auch findet die Tatsache Erwähnung, dass Koeppen aufgrund seines Alters auch seine Erfahrung aus seinem Leben mit in seine Literatur einbezieht und er aufgrund einer engen Verknüpfung zu damals modernen Schriftstellern stilistisch sehr moderne Werke geschaffen habe. Die Ergebnisse seiner Kritik untermauert Vogt mit einem Zitat von Erhard Schütz am Ende des Absatzes.
Im zweiten Absatz geht Vogt auf die verschiedenen Gruppenarten der Charaktere ein. So sei der Charakter Odysseus Cotton in Verbindung mit einem Roman Joyces entstand, auch wenn es dort anders als bei „Tauben im Gras“ weniger als zwanzig Personen gebe, die von der Wichtigkeit her alle gleich, ansonsten aber sehr unterschiedlich seien. Das verdeutlicht Vogt mit einer Aufzählung, in der er die ganzen Personengruppen, von verarmten Großbürgertöchtern bis zu väterlosen Kindern, nennt. In diesem Bezug lobt Vogt die Technik, mit der zwischen den Charakteren gewechselt wird, aber auch das „soziologische Fazit“ (Z. 49), das Koeppen durch die Figurenkonstellation entstehen lässt.
Die Technik und den Schreibstil, überwiegend aber die Inszenierung der Personenrede, beschreibt Jochen Vogt im dritten Abschnitt. Mit geschickter Anwendung von Montagetechnik, Zitaten aus der Literatur oder Bewusstseinsstromtechniken, die der Verfasser allesamt aufzählt, schaffe Koeppen es, die Charaktere zu isolieren. Für Vogt ist ein auktorialer Erzähler vorhanden, der den „stream-of-consciousness“ verwendet.
Im vierten und letzten Abschnitt befasst sich Jochen Vogt mit der Wirkung des Buches auf die Gesellschaft, die meist ablehnend gewesen sei, teilweise aber auch unberechtigt. Laut Ansicht des Autors sei dies darauf zurückzuführen, dass man „Tauben im Gras“ fehlende Moral vorwürft, was im Zusammenhang mit Politik und Triebstruktur stehen könne.
Aus der eingeschränkten Sachtextanalyse lässt sich die Position des Autors [Vogt] erkennen. Dieser vertritt in allen Bereichen eine positive Ansicht über „Tauben im Gras“, wenngleich er einräumt, dass das Buch in der Öffentlichkeit kritisiert worden sei, was er allerdings in vielen Bereichen als unbegründet abweist. Da sich die Sachtextanalyse bereits ausführlich mit der Position des Autors befasst, nehme ich direkt Stellung zu seiner Position, wobei ich mich aspektgeleitet mit der Kritik des Autors befasse und mich anschließend mit der Figurenkonstellation und der Technik beschäftige.
Zunächst beziehe ich mich auf die Kritik des Autors. Diese fällt ausschließlich lobend aus, da Koeppen sich auf aktuelle Ereignisse bezogen und diese zutreffend interpretiert habe. Zudem lobt er die Modernität des Schreibstils, die er mit Baudelaire und Joyce vergleicht.
Die Behauptung des Autors kann ich nur untermauern. Die Aktualität des Textes in der damaligen Zeit, die Vogt so lobt, kann man am besten an der faschistischen Einstellung ausmachen, die bei den verschiedenen Charakteren herrscht. Frau Behrend ist antisemitisch und verurteilt ihre Tochter Carla, die von einem schwarzen Soldaten aus Amerika schwanger geworden ist und der seinen schwarzen Kameraden in anderen Kasernen untergebracht ist als seine weißen Kollegen von den Vereinigten Staaten. Koeppen diagnostiziert hier die Rassentrennung, die in den USA noch lange herrschen sollte, erkennt aber auch, dass Deutschland Probleme in der Zukunft aufgrund des bleibenden Rechtsextremismusses bekommen würde, was man zehn Jahre nach Erscheinen des Buches mit der Wahl Kiesingers als Bundeskanzler (und der Ohrfeige von Beate Klarsfeld) und den Studentenrevolten, aber auch mit der Gründung der RAF erkennen konnte. Auch das erkennt Vogt, sodass ich ihm nur beipflichten kann. Und dass seine [Koeppens] Werke modern waren, erkennt man auch heute, denn so verwendet Christoph Buggert in seinem Roman „Deutschlandbesuch“ fast die selben Techniken.
Auch von den Figurenkonstellationen und den verwendeten Techniken her ist die Position Vogts nachvollziehbar. So erkennt man in seiner Aufzählung als „verarmte Großbürgertochter“ Emilia, im „vaterlosen Halbwüchsigen“ Heinz, im „nonkonformistischen Intellektuellen“ Philipp oder im „farbigen Besatzungssoldaten“ Washington wieder, die durch die Montagetechnik voneinander isoliert werden, wie Vogt zutreffend formuliert, denn in den insgesamt 105 Abschnitten des Romans erkennt man die Zusammenhänge und Beziehungen zwischen den Charakteren erst im späteren Verlauf des Buches, sodass man von einer wirklichen Isolation der Charaktere sprechen kann. Auch die Behauptung, das Buch sei meist (zu unrecht) abgelehnt worden, lässt sich nur bestätigen.
„[...] und kaum ein nonkonformistischer Erzähler wird in der Folgezeit vom Pornografievorwurf verschont bleiben, wenn er - wie begründet auch immer seinen Blick auf den Zusammenhang von Politik und Triebstruktur richtet“ (Z. 72- 77).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Wolfgang Koeppens Roman „Tauben im Gras“?
Der Roman thematisiert die deutsche Nachkriegsgesellschaft Anfang der 1950er Jahre. Er beleuchtet Probleme wie Rassentrennung, den verbleibenden Faschismus und die Isolation des Individuums in einer sich wandelnden Welt.
Welche modernen Erzähltechniken verwendet Koeppen?
Koeppen nutzt die Montagetechnik, den „stream-of-consciousness“ (Bewusstseinsstrom) und Zitate aus der Weltliteratur, um die Isolation seiner Charaktere darzustellen.
Warum wurde der Roman in den 1950er Jahren kritisiert?
Dem Buch wurde oft fehlende Moral vorgeworfen. Die Gesellschaft der Nachkriegszeit war zudem oft noch nicht bereit für Koeppens schonungslose Analyse von Politik und Triebstruktur.
Wie aktuell ist Koeppens Werk heute noch?
Die Arbeit zeigt auf, dass Themen wie Rechtsextremismus und Rassismus, die Koeppen bereits 1951 diagnostizierte, auch in der heutigen Zeit und Literatur (z. B. bei Christoph Buggert) relevant bleiben.
Wer ist Jochen Vogt und welche Rolle spielt er für diese Arbeit?
Jochen Vogt ist ein Literarhistoriker, dessen Aufsatz „Modelle nonkonformistischen Erzählens“ als Grundlage für die Sachtextanalyse dient, um Koeppens Modernität zu belegen.
Gehört „Tauben im Gras“ zu einer Trilogie?
Ja, zusammen mit den Werken „Das Treibhaus“ und „Der Tod in Rom“ bildet der Roman Koeppens sogenannte „Trilogie des Scheiterns“.
- Quote paper
- Simon Winzer (Author), 2012, Die Aktualität von Gegenwartsliteratur in der heutigen Zeit am Beispiel von Koeppens Tauben im Gras, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196412