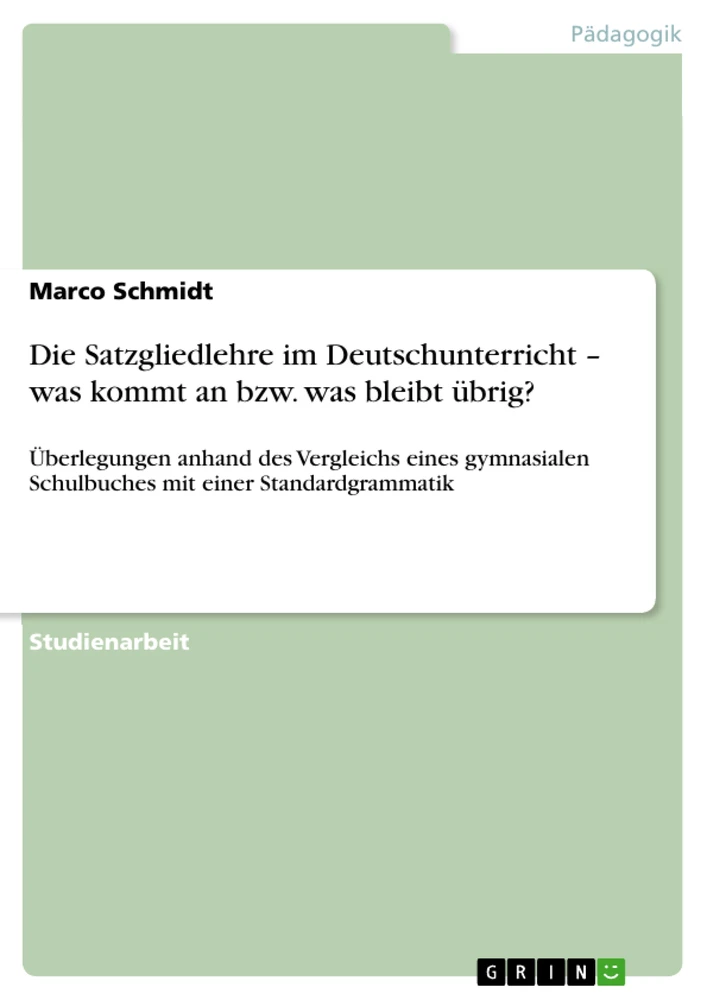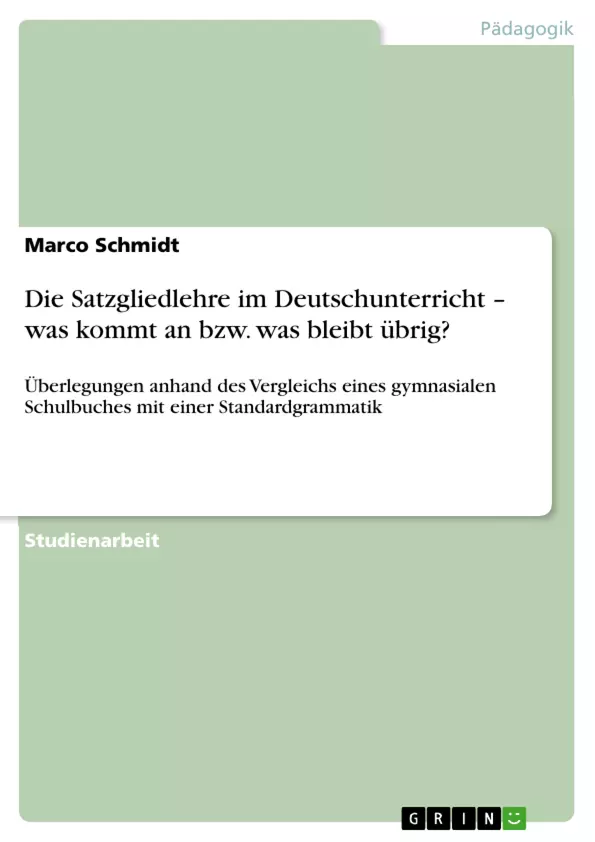Grammatik – ein Ausdruck, der bei vielen Schülerinnen und Schülern Entsetzen auslöst. Zu langweilig ist die Materie, so ein gängiges Vorurteil. Auch unter Sprachdidaktikern scheint man seit den 70-er Jahren vom traditionellen Grammatikunterricht abgekommen zu sein. Begriffe wie „Sprachreflexion“, „Funktionalität“ und „situationsorientierter Grammatikunterricht“ stehen inzwischen im Vordergrund.
Auf der anderen Seite konstatieren Sprachwissenschaftler zunehmend einen mangelnden Kenntnisstand hinsichtlich grammatischer Phänomene, u.a. bei Studienanfängern der Germanistik. So veröffentlichte Ulrich Schmitz, Professor an der Universität Duisburg-Essen, die Ergebnisse eines Tests, in dem Studierende nach der Bedeutung grammatischer Fachausdrücke befragt wurden. Es zeigte sich, dass nur fünf von circa 200 Studierenden mehr als 50 Prozent der Fragen richtig beantworten konnten. (Schmitz 2003:452-458, zitiert nach: Dürscheid i. E.)
Christa Dürscheid schreibt gar:
„Daraus resultiert […], dass im muttersprachlichen Unterricht […] kein systematisches Grammatikwissen aufgebaut wird. So können sich viele Studenten auf Nachfrage nicht mehr daran erinnern, dass ein grammatischer Terminus in ihrer Schulzeit jemals eingeführt wurde.“ (Dürscheid i. E.)
Es scheint ein trauriges Bild zu sein, das hier auf die Sprachwissenschaft und die Sprachdidaktik geworfen wird. Sollte die Auseinandersetzung mit der deutschen Grammatik bald eine elitäre Spezialwissenschaft weniger Fachkundiger sein?
Das „Verzeichnis grundlegender grammatischer Fachausdrücke“ – letztmalig am 26.02.1982 von der Kultusministerkonferenz herausgegeben – gab eine Art allgemeinen Kanon grammatischen Wissens vor, wobei unklar bleibt, inwiefern dieser tatsächlich maßgebend für den Deutschunterricht an Schulen war. In den neuen „Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Mittleren Schulabschluss“ (2003), die im Schuljahr 2004/05 in Kraft getreten sind, wird nicht mehr explizit auf dieses Verzeichnis verwiesen (Dürscheid i. E.) - ein weiterer Hinweis darauf, dass sich die Grammatik im Rückzug befindet?
Aber wie sieht sie nun tatsächlich aus, die Grammatik der deutschen Sprache, die Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse heute an einem Gymnasium lernen? Was kommt an bzw. was bleibt übrig von den Ansätzen, Regeln und Festlegungen zur Grammatik aus Sicht der Sprachwissenschaft bzw. der wissenschaftlichen Sprachdidaktik?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vergleich Deutschbuch 5 – Helbig/Buscha-Grammatik
- Definition und Beschreibung von Satzgliedern
- Darstellung in der Helbig/Buscha-Grammatik (2001:444-447)
- Darstellung im Deutschbuch 5 (1997:117f.)
- Das Prädikat
- Darstellung in der Helbig/Buscha-Grammatik (2001:448-454)
- Das finite Verb (Helbig/Buscha-Grammatik 2001:448)
- Der grammatische Prädikatsteil (Helbig/Buscha-Grammatik 2001:448 f.)
- Der lexikalische Prädikatsteil (Helbig/Buscha-Grammatik 2001:449 f.)
- Das Subjektsprädikativ bei Kopulaverben (Helbig/Buscha-Grammatik 2001:450 f.)
- Darstellung im Deutschbuch 5 (1997:118-120)
- Darstellung in der Helbig/Buscha-Grammatik (2001:448-454)
- Das Subjekt
- Darstellung in der Helbig/Buscha-Grammatik (2001:454f.)
- Darstellung im Deutschbuch 5 (1997:120-122)
- Das Objekt
- Darstellung in der Helbig/Buscha-Grammatik (2001:456-459)
- Das Akkusativobjekt (Helbig/Buscha-Grammatik 2001:457)
- Das Dativobjekt (Helbig/Buscha-Grammatik 2001:457f.)
- Das Genitivobjekt (Helbig/Buscha-Grammatik 2001:458)
- Das Präpositionalobjekt (Helbig/Buscha-Grammatik 2001:458)
- Das Objekt zum Prädikativ (Helbig/Buscha-Grammatik 2001:458 f.)
- Darstellung im Deutschbuch 5 (1997:123-125)
- Darstellung in der Helbig/Buscha-Grammatik (2001:456-459)
- Die graphische Darstellung
- Resümee
- Zusammenfassung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern die Satzgliedlehre im Deutschunterricht an Gymnasien heute gelehrt wird, und wie sich die Ansätze und Festlegungen der wissenschaftlichen Sprachdidaktik darin widerspiegeln. Hierfür wird ein Vergleich des Schulbuches „Deutschbuch 5“ (1997) mit der „Helbig/Buscha-Grammatik“ (2001) durchgeführt.
- Der aktuelle Stand der Grammatikvermittlung im Deutschunterricht
- Der Vergleich der Darstellung der Satzgliedlehre in einem Schulbuch und einer Standardgrammatik
- Die Analyse der Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Definition und Beschreibung von Satzgliedern
- Die Rolle der grammatischen Fachbegriffe im schulischen Kontext
- Die Herausforderungen der Grammatikvermittlung im heutigen Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Situation der Grammatikvermittlung im Deutschunterricht und die Debatte um die Rolle der traditionellen Grammatik. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Satzgliedlehre im Vergleich zwischen dem Schulbuch „Deutschbuch 5“ (1997) und der „Helbig/Buscha-Grammatik“ (2001). In Kapitel 2 werden zunächst die Definitionen und Beschreibungen von Satzgliedern in beiden Werken betrachtet, gefolgt von einer detaillierten Analyse des Prädikats, des Subjekts und des Objekts.
Kapitel 3 widmet sich der graphischen Darstellung der Satzgliedlehre in den beiden Lehrwerken und setzt sich schließlich mit den Erkenntnissen aus dem Vergleich auseinander. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Werke beleuchtet und es werden weitere Fragestellungen aufgeworfen, die sich aus der Arbeit ergeben.
Schlüsselwörter
Satzgliedlehre, Deutschunterricht, Schulbuch, Standardgrammatik, Helbig/Buscha-Grammatik, „Deutschbuch 5“, Prädikat, Subjekt, Objekt, graphische Darstellung, Grammatikvermittlung, Sprachreflexion, Funktionalität, situationsorientierter Grammatikunterricht.
Häufig gestellte Fragen
Warum haben Schüler oft Probleme mit der deutschen Grammatik?
Die Materie gilt oft als zu trocken. Zudem zeigt die Forschung, dass im Unterricht oft kein systematisches Grammatikwissen aufgebaut wird, was zu Lücken bei Studienanfängern führt.
Was ist der Unterschied zwischen Schulgrammatik und wissenschaftlicher Grammatik?
Die Arbeit vergleicht das "Deutschbuch 5" mit der "Helbig/Buscha-Grammatik". Wissenschaftliche Grammatiken sind detaillierter (z. B. bei der Definition des Prädikats), während Schulbücher Begriffe oft didaktisch reduzieren.
Was bedeutet "situationsorientierter Grammatikunterricht"?
Anstatt Regeln starr auswendig zu lernen, steht die Sprachreflexion und die funktionale Anwendung von Grammatik in konkreten Kommunikationssituationen im Vordergrund.
Wie wird die Satzgliedlehre heute grafisch dargestellt?
Es gibt Unterschiede in der Visualisierung zwischen Lehrwerken. Die Arbeit analysiert, wie Subjekt, Prädikat und Objekt grafisch aufbereitet werden, um das Verständnis zu fördern.
Welche Rolle spielen Fachbegriffe im Deutschunterricht?
Obwohl Fachbegriffe essentiell sind, zeigt die Arbeit, dass viele Studenten sich kaum an die Einführung dieser Termini in ihrer Schulzeit erinnern können, was auf mangelnde Nachhaltigkeit hindeutet.
- Definition und Beschreibung von Satzgliedern
- Arbeit zitieren
- Marco Schmidt (Autor:in), 2009, Die Satzgliedlehre im Deutschunterricht – was kommt an bzw. was bleibt übrig?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196494