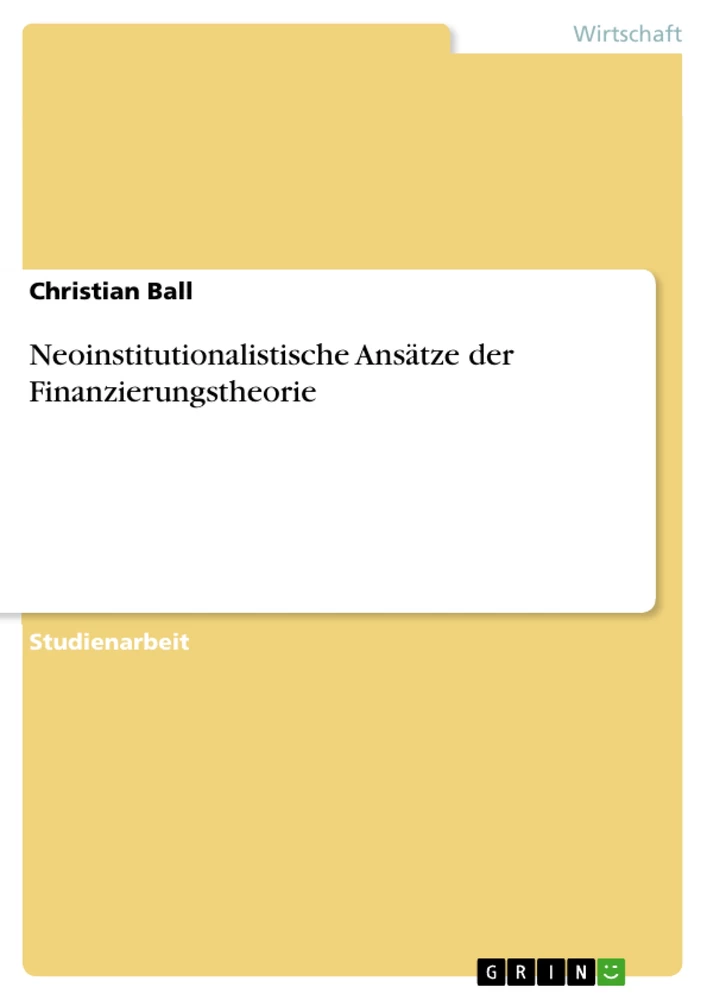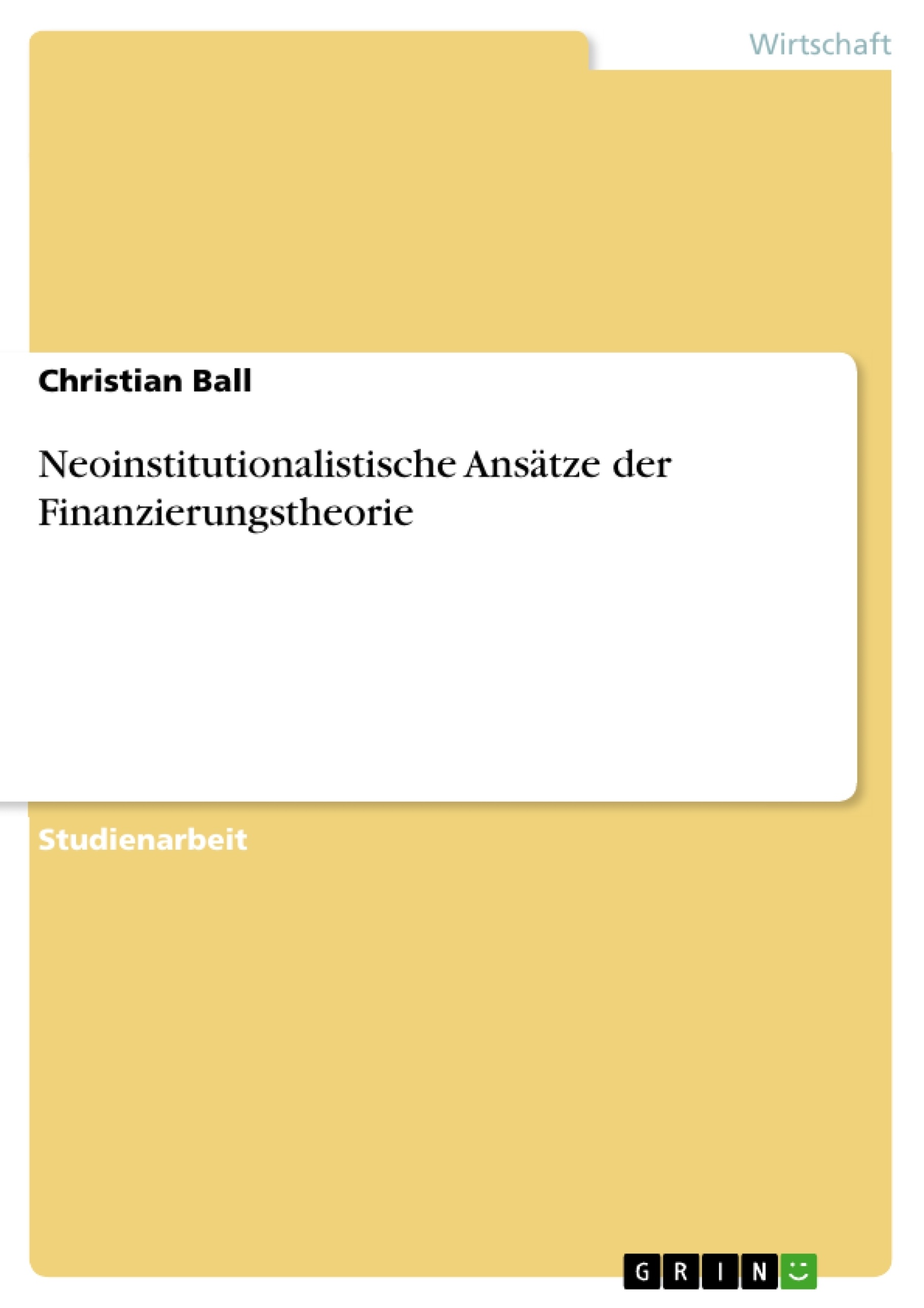Wissenschaftliche Betrachtungsfelder unterliegen einer stetigen Veränderung. In diesem Kontext fanden immer neue Theorien Einzug in die Finanzierungstheorie. Mit Hilfe dieser Kategorien wurde der Versuch unternommen die Marktmechanismen zu durchleuchten um somit Grundlagen für finanzpolitische Entscheidungen festlegen zu können. Dieses Werk befasst sich speziell mit der neo-institutionalistischen Finanzierungstheorie. Aufbauend auf den Grundzügen der Entwicklung hin zu diesem theoretischen Ansatz, werden die einzelnen Elemente näher erläutert. Der Versuch eine größere Realitätsnähe zu erreichen sowie die Implementierung institutioneller Maßnahmen sind grundlegende Zielsetzungen. Die hieraus entwickelten Erklärungsmodelle werden in die Praxis übertragen um folgernd den Stellenwert der theoretischen Forschung zu ermitteln.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
1. Problemstellung und Zielsetzung
2. überblick finanztheoretischer Entwicklung
2.1 Die Klassische Finanzierungstheorie
2.2 Die moderne Finanzierungstheorie
2.2.1 Die Neoklassische Finanzierungstheorie
2.2.2 Die Neo-institutionalistische Finanzierungstheorie
3. Elemente neo-institutionalistischer Finanzierungstheorie
3.1 Der Institutionsbegriff
3.2 Opportunismus als Triebfeder
3.3 Die asymmetrische Verteilung von Informationen
3.4 Das Auftreten von Transaktionskosten
4. Ansätze neo-institutionalistischer Finanzierungstheorie
4.1 Die Informationsökonomie als Hintergrund
4.1.1 hidden information / hidden characteristics
4.1.2 hidden action
4.1.3 hidden intention
4.2 Die Agency-Theorie
4.3 Die Property-Rights-Theorie
4.4 Der Transaktionskostenansatz
5. Betrachtung von Finanzierungsformen in der Realität
5.1 Eigenfinanzierung
5.2 Fremdfinanzierung
5.3 Dritte im Kontext der Finanzierungsentscheidungen
6. Fazit
Literaturverzeichnis
- Citar trabajo
- Christian Ball (Autor), 2012, Neoinstitutionalistische Ansätze der Finanzierungstheorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196522