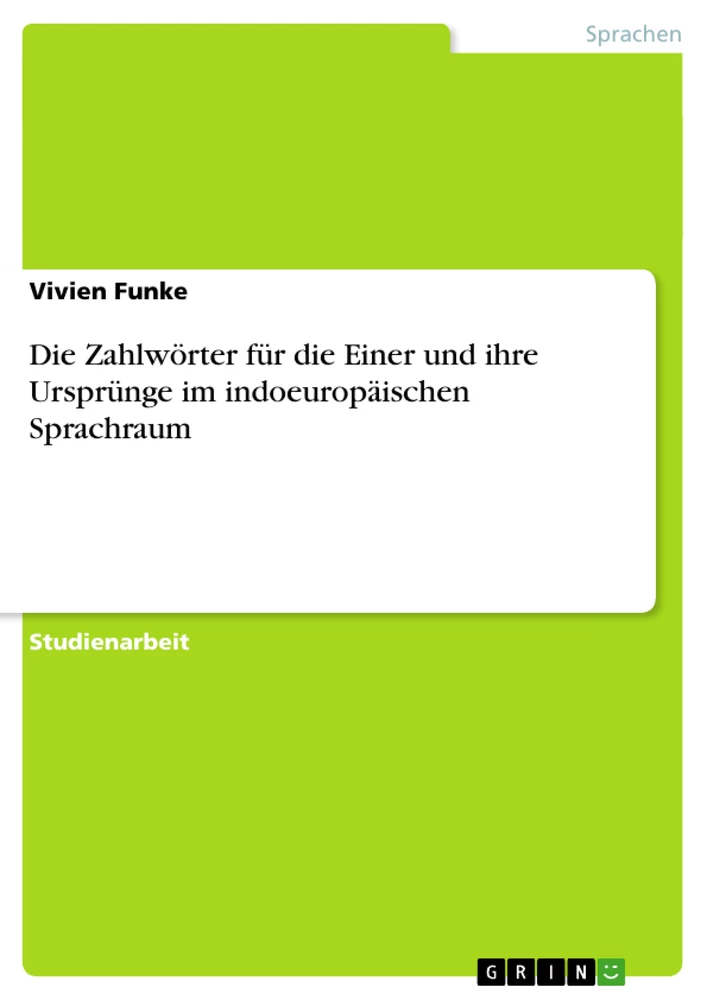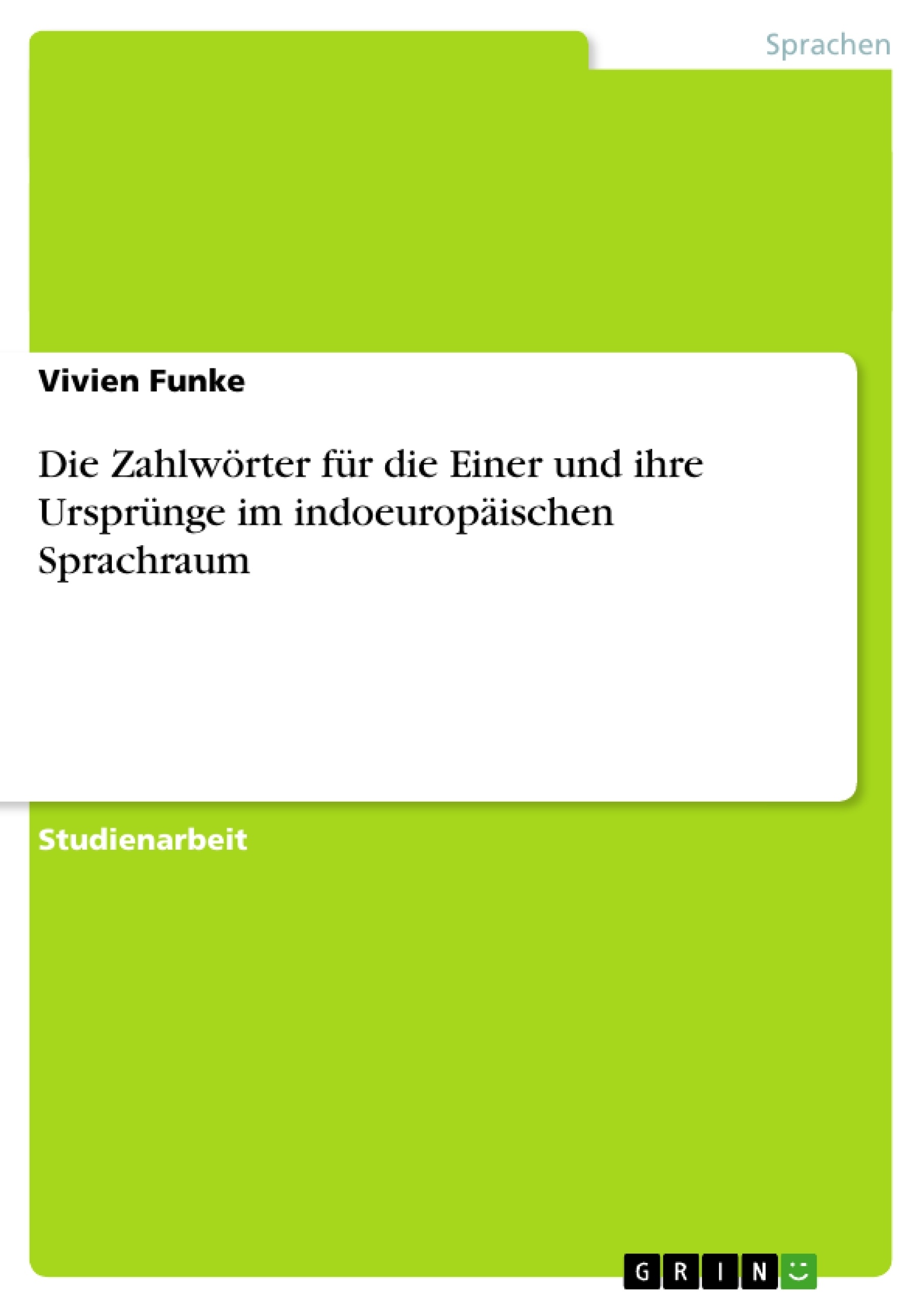Die Erschließung und Rekonstruktion von gemeinindoeuropäischen Wortformen beruht auf
dem Vergleich der erhaltenen bzw. nachgewiesenen Wörter – insbesondere des
Grundwortschatzes (Wörter für nahe Verwandte, Körperteile etc.) – der zur indoeuropäischen
Sprachfamilie zählenden Einzelsprachen. Die ebenfalls zum Basiswortschatz zählenden
Kardinalzahlwörter erregten diesbezüglich besonderes Interesse, da hier Wortgleichungen in
hohem Maße festgestellt werden konnten und sich zudem die jeweilige Wortgleichung auch
mit wenigen Ausnahmen durch alle indoeuropäischen Sprachen erstreckt.1 Dies ist wohl
darauf zurückzuführen, daß die Kardinalzahlwörter schnell ihre eigentliche Bedeutung
verloren und somit annähernd statisch wurden: „Die Zahlwörter gehören zu den
widerstandsfähigsten Wörtern einer Sprache.“2 Diese Wortgruppe stellt also
eine wichtige Quelle zur theoretischen Ermittlung gemeinindoeuropäischer Formen dar.
Besonders gilt dies für die Grundzahlwörter von ‚1’-‚9’ und ‚10’. Die Zahlwörter von ‚1’-‚9’
lassen sich aufgrund ihrer nicht-komplexen Bildung als „simple atoms“ klassifizieren.3 Sie
bilden innerhalb des in der indoeuropäischen Sprachfamilie vorherrschenden Dezimalsystems
zusammen mit den Wörtern für die Zahl ‚10’, welche sich als „main base“ bezeichnen läßt,4
die Grundlage für die Bildung der höheren Zahlen und verdienen daher eine gesonderte
Untersuchung.
Betrachtet man in den Einzelsprachen die Zahlwörter für die Einer, scheinen diese
unmotiviert zu sein. Es ist jedoch davon auszugehen, daß die Zahlwörter nicht „aus heiterem
Himmel fielen“, sondern eine Motivation hatten. Zudem müssen die Zahlwörter für die Einer
und für ‚10’ früher als die nachfolgenden Kardinalzahlwörter ausgebildet gewesen sein, da
letztere auf diesen aufbauen oder aus diesen hervorgegangen sind.
Im Folgenden soll nun ein Einblick in die Forschung bezüglich der Entstehung der Zahlwörter
für die Einer und ihrer Motivation in der indoeuropäischen Gemeinsprache gegeben sowie
ihre mögliche Entwicklung und die Entstehung der Zahlenreihe untersucht werden. [...]
1 Vgl. Menninger, K.: Zahlwort und Zifffer. Eine Kulturgeschichte der Zahl. Bd. 1. 2., neubearb. und erw. Aufl.
Göttingen 1958. (Künftig zitiert: Menninger 1958.) S. 110.
2 ebd.
3 Vgl. Luján Martínez, E.R.: The Indo-European system of numerals from ‘1’ to ‘10’. In: J. Gvozdanović
(Hrsg.): Numeral Types and Changes Worldwide. Berlin, New York 1999. (Künftig zitiert: Luján Martínez
1999.) S. 199.
4 Vgl. ebd.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Zahlwörter für ‚1’-,9' in den indoeuropäischen Sprachen
- Allgemeines
- Das Zahlwort für ‚1’
- Das Zahlwort für ‚2’
- Das Zahlwort für ‚3’
- Das Zahlwort für ‚4’
- Das Zahlwort für ‚5’
- Das Zahlwort für ‚6’
- Das Zahlwort für ‚7’
- Das Zahlwort für ‚8’
- Das Zahlwort für ‚9’
- Gruppierung
- Die Entwicklung der Zahlenreihe
- Schlußbetrachtungen
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der Zahlwörter für die Einer (1-9) im indoeuropäischen Sprachraum. Ziel ist es, die Motivation hinter diesen Zahlwörtern zu beleuchten und ihre mögliche Entwicklung innerhalb des dezimalen Systems nachzuvollziehen. Dabei wird der Fokus auf die ältesten Sprachstufen gelegt und der Einfluss der Zahlwörter aufeinander betrachtet.
- Die Rekonstruktion gemeinindoeuropäischer Zahlwörter
- Die Flexion und Deklination der Zahlwörter (Deklinabilia vs. Indeklinabilia)
- Der Einfluss des Zahlworts für '10' auf die Bildung anderer Zahlwörter
- Die Entwicklung des Zahlensystems und die Veränderung der Beziehungen zwischen den Zahlwörtern
- Die semantische Entwicklung und die "Motivation" der Zahlwörter
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit befasst sich mit der Erforschung der Ursprünge der Zahlwörter für die Einer (1-9) im indoeuropäischen Sprachraum. Sie betont die Bedeutung dieser Zahlwörter als Teil des Grundwortschatzes und ihre relative Stabilität im Laufe der Sprachentwicklung. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Forschungsergebnisse, insbesondere die Arbeit von Luján Martínez (1999), um die Entstehung der Zahlenreihe nachzuvollziehen und die "Motivation" hinter den scheinbar unmotivierten Zahlwörtern zu entschlüsseln. Die Komplexität des Themas und die umfangreiche vorhandene Literatur werden angesprochen.
Die Zahlwörter für ‚1’-,9' in den indoeuropäischen Sprachen: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Zahlwörter für 1 bis 9 in verschiedenen Zweigen der indoeuropäischen Sprachfamilie. Es werden sowohl die deklinierbaren (1-4) als auch die nicht deklinierbaren (5-9) Zahlwörter betrachtet, inklusive ihrer morphologischen und grammatikalischen Eigenschaften. Das Kapitel beleuchtet die Auswirkungen von Analogiebildungen und die gegenseitigen Einflüsse der Zahlwörter aufeinander, z.B. den Einfluss des Zahlworts für 10 auf die Form der Zahlwörter für 9 in den slawischen Sprachen. Es werden exemplarisch Zahlwörter aus verschiedenen Sprachzweigen angeführt um die Verwandtschaft und Entwicklung aufzuzeigen.
Die Entwicklung der Zahlenreihe: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des indoeuropäischen Zahlensystems und analysiert die Veränderungen der Beziehung zwischen den Zahlwörtern. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Zahlenreihe und den zugrundeliegenden Prinzipien. Die Arbeit verdeutlicht wie das dezimale System aufgebaut ist und welche Rolle die Zahlwörter für 1-9 und 10 dabei spielen. Es wird auf Veränderungen der Basis und die daraus resultierenden Transformationen im Zahlensystem eingegangen, unter Einbezug relevanter Forschungsliteratur.
Schlüsselwörter
Indogermanisch, Zahlwörter, Einer, Dezimalsystem, Sprachvergleich, Etymologisches Wörterbuch, Rekonstruktion, Wortbildung, Flexion, Deklination, Analogiebildung, Sprachentwicklung, Numerale, Luján Martínez.
Häufig gestellte Fragen zu: Entwicklung der Zahlwörter für die Einer (1-9) im Indogermanischen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der Zahlwörter für die Einer (1-9) im indoeuropäischen Sprachraum. Sie beleuchtet die Motivation hinter diesen Zahlwörtern und deren Entwicklung innerhalb des dezimalen Systems, mit Fokus auf die ältesten Sprachstufen und den gegenseitigen Einfluss der Zahlwörter.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rekonstruktion gemeinindoeuropäischer Zahlwörter, deren Flexion und Deklination (Deklinabilia vs. Indeklinabilia), den Einfluss des Zahlworts für '10', die Entwicklung des Zahlensystems und die Veränderung der Beziehungen zwischen den Zahlwörtern sowie die semantische Entwicklung und die "Motivation" der Zahlwörter.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Zahlwörter für 1-9 in den indoeuropäischen Sprachen, ein Kapitel über die Entwicklung der Zahlenreihe, Schlussbetrachtungen und ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung betont die Bedeutung der Zahlwörter als Teil des Grundwortschatzes und die Komplexität des Themas. Das Kapitel zu den Zahlwörtern für 1-9 bietet einen umfassenden Überblick über deren morphologische und grammatikalische Eigenschaften in verschiedenen Zweigen der indoeuropäischen Sprachfamilie. Das Kapitel zur Entwicklung der Zahlenreihe analysiert die Veränderungen der Beziehungen zwischen den Zahlwörtern und die Entwicklung des dezimalen Systems.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit analysiert vorhandene Forschungsergebnisse, insbesondere die Arbeit von Luján Martínez (1999), um die Entstehung der Zahlenreihe nachzuvollziehen und die "Motivation" hinter den Zahlwörtern zu entschlüsseln. Es wird ein sprachvergleichender Ansatz verwendet, der verschiedene indoeuropäische Sprachzweige umfasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Indogermanisch, Zahlwörter, Einer, Dezimalsystem, Sprachvergleich, Etymologisches Wörterbuch, Rekonstruktion, Wortbildung, Flexion, Deklination, Analogiebildung, Sprachentwicklung, Numerale, Luján Martínez.
Welche Sprachen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Zweige der indoeuropäischen Sprachfamilie, um die Verwandtschaft und Entwicklung der Zahlwörter aufzuzeigen. Konkrete Beispiele aus einzelnen Sprachen werden im Kapitel über die Zahlwörter für 1-9 angeführt.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung der Zahlwörter für die Einer (1-9) im indoeuropäischen Sprachraum zu verstehen und die Motivation hinter diesen scheinbar oft unmotivierten Wörtern zu beleuchten.
Wo finde ich die vollständige Arbeit?
Die vollständige Arbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieses Dokument dient lediglich als Zusammenfassung und Übersicht.
- Citar trabajo
- Vivien Funke (Autor), 2002, Die Zahlwörter für die Einer und ihre Ursprünge im indoeuropäischen Sprachraum, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19655