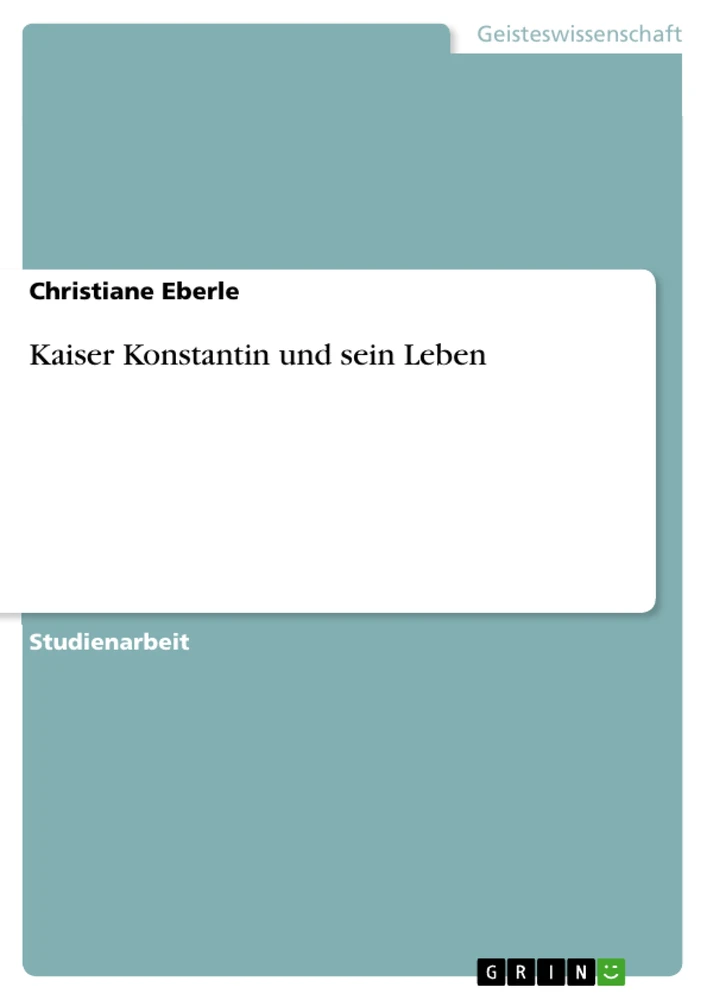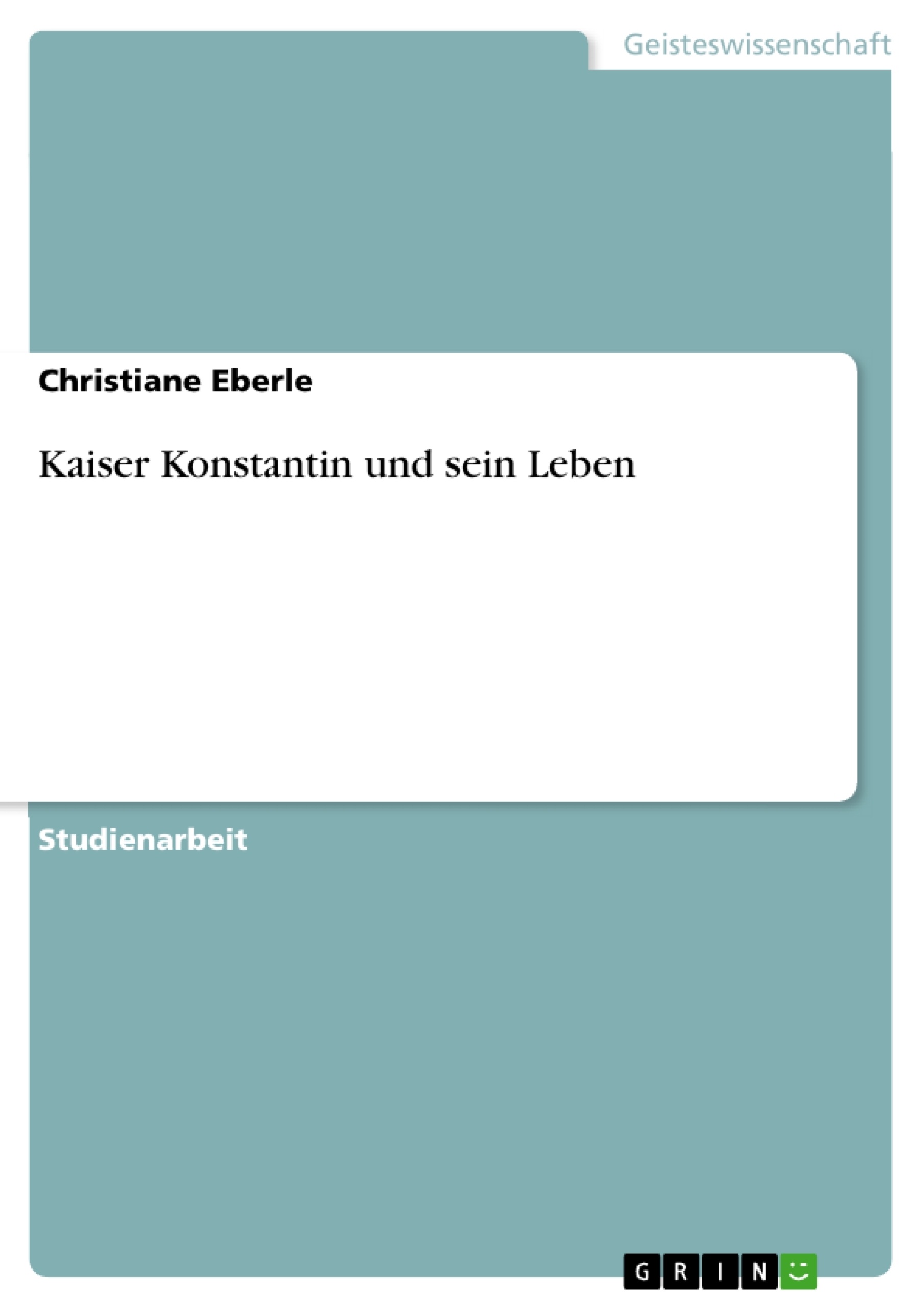Konstantin der Große ist einer der wohl bekanntesten, aber auch umstrittensten römischen Kaiser. Bei der ersten intensiveren Auseinandersetzung und Literaturrecherchen wurde schnell deutlich, dass zahlreiche Kontroversen mit Konstantin und seiner Person verbunden sind.
Dies mag daran liegen, dass die Darstellung seines Lebens und die Beurteilung seiner Aktivitäten stark geprägt sind von den grundsätzlichen Vorstellungen und Konzepten der einzelnen Kunsthistoriker.
Christliche Autoren wie Eusebius von Caesara und Laktanz, die bedeutenden Konstantinbiographen, unterstellten dem Kaiser recht früh eine Hinwendung zum Christentum. Konträr dazu wurde derselbe Kaiser von den Heiden etwa als berechnender Machtmensch gezeigt, der geprägt von politischen Berechnungen war. Man hat also sorgfältig aus den verschiedenen Divergenzen auszuwählen, welche Elemente aus den Darstellungen als zuverlässig gelten. Die einzig unumstößliche Tatsache auf die sich sowohl antike als auch moderne Autoren einigen können ist, dass Konstantin der erste christliche Kaiser im römischen Reich war.
In der vorliegenden Arbeit werden zunächst die ersten Lebensjahre Konstantins bis zu seiner Kaisererhebung im Jahre 306 chronologisch behandelt/ rekonstruiert.
Zum besseren Verständnis wird direkt zu Beginn das Herrschaftssystem der dokletianischen Tetrarchie am Beispiel des Konstantius Chlorus, Konstantins Vater, erläutert.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf dem Weg den Konstantin bis zu seiner tatsächlichen Alleinherrschaft zurücklegt. Es wird beschrieben, wie ein Soldatensohn trotz des diocletianischen Herrschaftssystems zum alleinigen Herrscher des gesamten römischen Imperiums wurde, und somit das Ende der Tetrarchie und die Rückkehr zu einer älteren Traditionslinie einleitete. Die konstantinische Wende wird kurz angesprochen, um dem Leser einen Einblick in die Problematik zu ermöglichen, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Das Leben des jungen Konstantin
- 2. Kaiser Anfänge
- 2.1 Konstantin besiegt Maxentius- eine Bekehrung?
- 2.2 frühe Gesetzgebung und Kirchenpolitik
- 2.3 Das Mailänder Toleranzedikt
- 3. Konstantins Weg zum Alleinherrscher
- 4. Gesetzgebung und Leben als Alleinherrscher
- 5. Konstantinopel
- 6. Taufe und Tod Konstantins
- 7. Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, den Lebensweg Kaiser Konstantins bis zu seiner Alleinherrschaft nachzuzeichnen und seine Bedeutung für das Römische Reich zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Rekonstruktion seiner frühen Jahre, seiner Machtergreifung im Kontext der Tetrarchie, und seiner Rolle in der Entwicklung der frühen christlichen Kirche.
- Konstantins Aufstieg zur Macht im Kontext der Diokletianischen Tetrarchie
- Die Rolle des Militärs in Konstantins Karriere
- Konstantins Verhältnis zum Christentum und seine Kirchenpolitik
- Die Entwicklung des Römischen Reiches unter Konstantin
- Die Gründung Konstantinopels
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und hebt die umstrittene Persönlichkeit Konstantins hervor. Sie benennt die unterschiedlichen Perspektiven christlicher und heidnischer Autoren auf sein Leben und Wirken und betont die Schwierigkeit, eine objektive Darstellung zu erstellen. Die Arbeit konzentriert sich auf Konstantins Weg zur Alleinherrschaft und seine Rolle im Kontext der frühen christlichen Kirche.
1. Das Leben des jungen Konstantin: Dieses Kapitel beschreibt die frühen Lebensjahre Konstantins, seinen Aufstieg am Hof Diokletians und seine militärische Ausbildung. Es beleuchtet die komplexe politische Situation der Tetrarchie und die familiären Verbindungen Konstantins, die seine Karriere prägten. Der Mangel an zuverlässigen Informationen wird hervorgehoben, und die Konstantin-Biographie des Eusebius von Caesarea wird als bedeutende, aber parteiische Quelle eingeführt.
2. Kaiser Anfänge: Dieses Kapitel behandelt die Zeit nach dem Tod Konstantins des Vaters und die ersten Schritte Konstantins als Kaiser. Der Konflikt um die Anerkennung seines Kaisertums durch die anderen Tetrarchen wird detailliert geschildert, ebenso wie seine strategischen Ehen und militärische Auseinandersetzungen. Die Rolle Maximians und Maxentius wird erörtert, und es wird auf die politische Instabilität des Reiches in dieser Phase hingewiesen.
Schlüsselwörter
Kaiser Konstantin, Tetrarchie, Römisches Reich, Christentum, Kirchenpolitik, Konstantinopel, Gesetzgebung, Machtpolitik, Eusebius von Caesarea.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kaiser Konstantin – Ein Lebensweg
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit zeichnet den Lebensweg Kaiser Konstantins bis zu seiner Alleinherrschaft nach und beleuchtet seine Bedeutung für das Römische Reich. Der Fokus liegt auf seinen frühen Jahren, seiner Machtergreifung im Kontext der Tetrarchie und seiner Rolle in der Entwicklung der frühen christlichen Kirche. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel über Konstantins Leben, seine Kaiserzeit, seine Gesetzgebung, Konstantinopel, seine Taufe und seinen Tod, sowie einen Schlussteil. Zusätzlich werden Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter bereitgestellt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Konstantins Aufstieg zur Macht innerhalb der Diokletianischen Tetrarchie, die Rolle des Militärs in seiner Karriere, sein Verhältnis zum Christentum und seine Kirchenpolitik, die Entwicklung des Römischen Reiches unter seiner Herrschaft und die Gründung Konstantinopels.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit erwähnt explizit die Konstantin-Biographie des Eusebius von Caesarea als bedeutende, wenn auch parteiische Quelle. Der Mangel an zuverlässigen Informationen für bestimmte Zeitabschnitte wird ebenfalls angesprochen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und endend mit einem Schlussteil. Die Kapitel behandeln chronologisch Konstantins Leben, von seinen frühen Jahren bis zu seinem Tod. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel kurz beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Kaiser Konstantin, Tetrarchie, Römisches Reich, Christentum, Kirchenpolitik, Konstantinopel, Gesetzgebung, Machtpolitik, Eusebius von Caesarea.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Konstantins Lebensweg bis zu seiner Alleinherrschaft nachzuzeichnen und seine Bedeutung für das Römische Reich zu beleuchten. Sie will seine frühen Jahre, seine Machtergreifung und seine Rolle in der Entwicklung der frühen christlichen Kirche rekonstruieren.
Welche Kapitel gibt es?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: 0. Einleitung, 1. Das Leben des jungen Konstantin, 2. Kaiser Anfänge (mit Unterkapiteln), 3. Konstantins Weg zum Alleinherrscher, 4. Gesetzgebung und Leben als Alleinherrscher, 5. Konstantinopel, 6. Taufe und Tod Konstantins, 7. Schlussteil.
Wie wird die Persönlichkeit Konstantins dargestellt?
Die Einleitung hebt die umstrittene Persönlichkeit Konstantins hervor und betont die unterschiedlichen Perspektiven christlicher und heidnischer Autoren auf sein Leben und Wirken. Die Schwierigkeit, eine objektive Darstellung zu erstellen, wird ebenfalls betont.
- Arbeit zitieren
- Christiane Eberle (Autor:in), 2005, Kaiser Konstantin und sein Leben, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196603