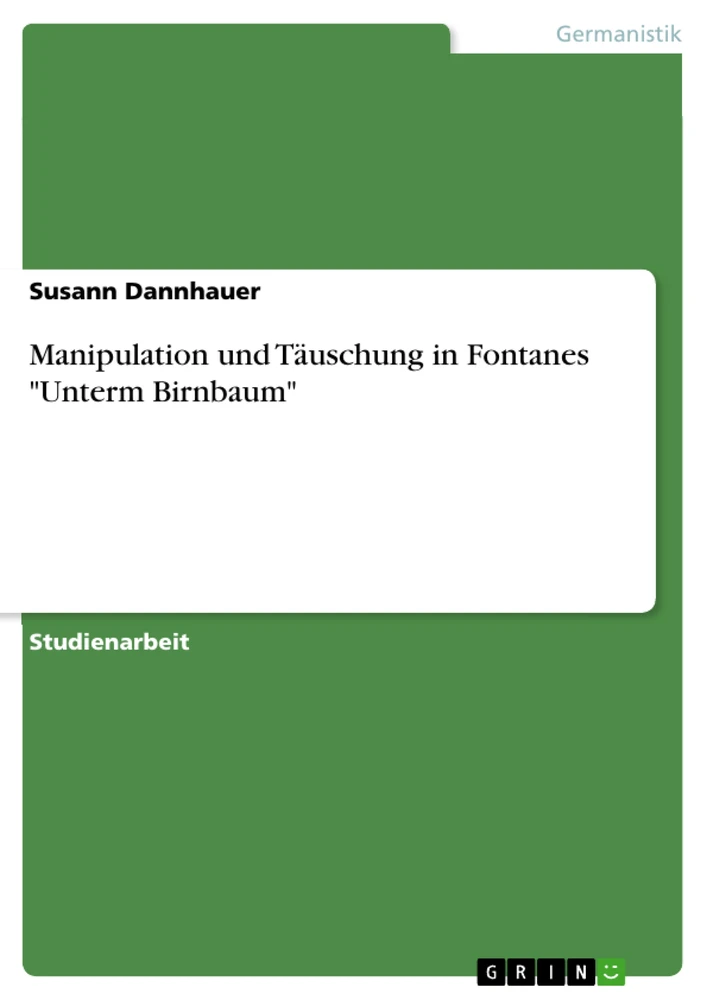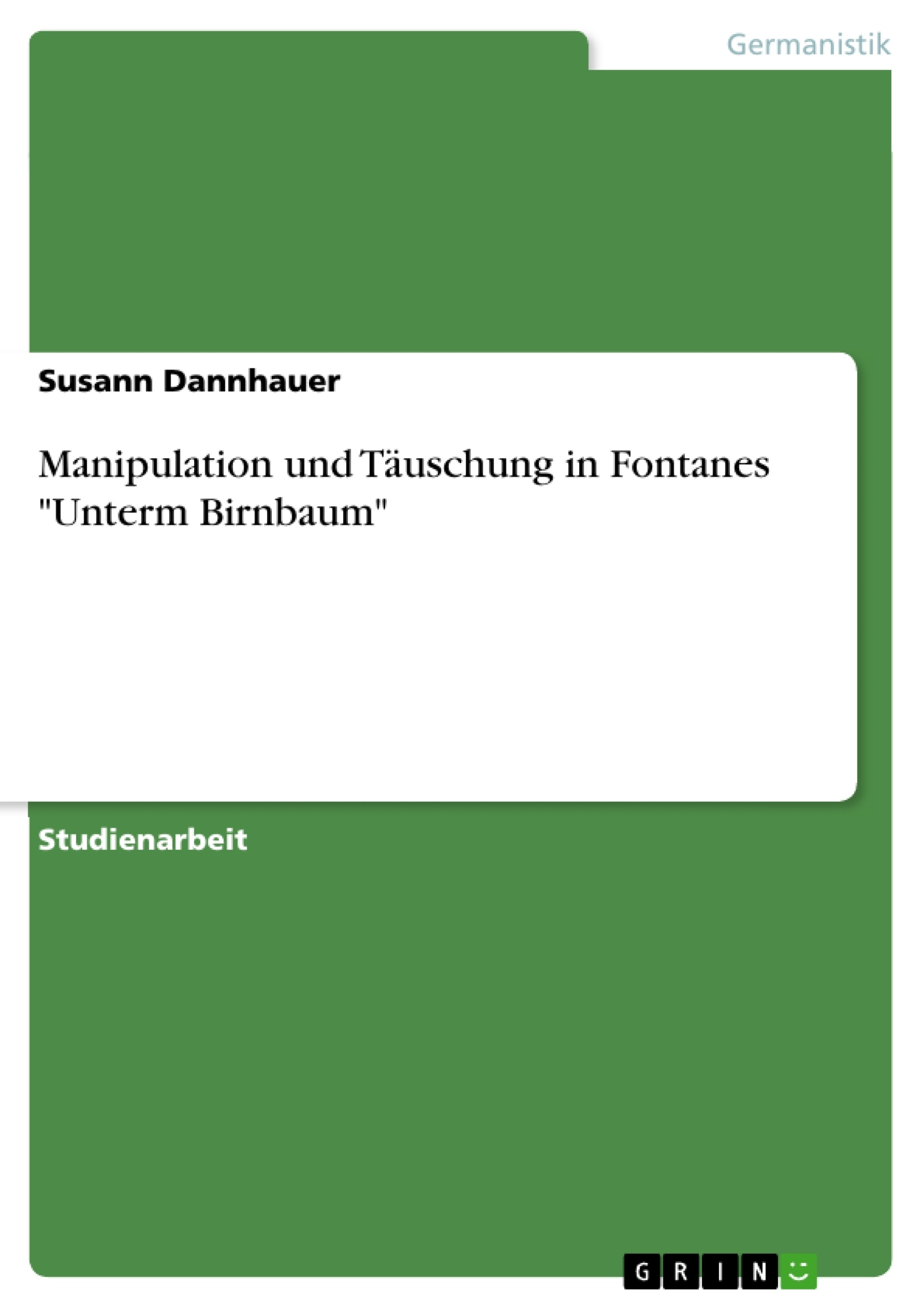Theodor Fontanes Unterm Birnbaum ist eine als Roman ausgewiesene Kriminalgeschichte, die heute als Kriminalnovelle verstanden wird. Fontane, als Vertreter des poetologischen Realismus, hat eine ganz eigene Vorstellung von dem, was Realismus ist. Realismus ist für ihn nicht „das nackte Wiedergeben alltäglichen Lebens, am wenigsten seines Elends und seiner Schattenseiten“, sondern das Herausgreifen interessanter Aspekte und die Darstellung dieser mit künstlerischer Hand. Fontane greift in Unterm Birnbaum reale Geschehnisse seiner Zeit auf und setzt sie in überhöhter Form zu einer Geschichte zusammen. Mit dieser künstlerischen Schöpfung entspricht er seinem eigenen Konzept von Realismus. In Abgrenzung zu dem, was Realismus nicht ist, definiert Fontane was er ist folgendermaßen:
"Der Realismus will nicht die bloße Sinnenwelt und nichts als diese; er will am allerwenigsten das bloß Handgreifliche, aber er will das Wahre. Er schließt nichts aus als die Lüge, das Forcierte, das Nebelhafte, das Abgestorbene – vier Dinge, mit denen wir glauben, eine ganze Literaturepoche bezeichnet zu haben."
Auch im Sinne der Aussage damit was Realismus ist, erfolgt eine Auseinandersetzung in der Novelle, nämlich auf inhaltlicher und erzähltechnischer Ebene. Es handelt sich um eine „literarische Umsetzung einer Kritik von Interpretations- und Kompositionshaltung“ , die das Schlussfolgern einer Wirklichkeit aus der „Verfolgung gegenständlicher Indizien“ ablehnt. Das Handgreifliche wird hierbei als das Wahre gedeutet und nicht hinterfragt – ein Konzept, „dessen Ästhetisierung der Realismus explizit ablehnt“ . Das Urteilen nach oberflächlichen, naheliegenden Fakten ist es, was kritisiert wird und genau mit dieser Interpretationshaltung spielt Fontane. In der Novelle wird manipuliert und getäuscht, sodass es einer Änderung in der Rezeptionshaltung bedarf, damit das Wahre erkannt werden kann. Wie genau Manipulation und Täuschung aussehen und wie darauf reagiert wird, soll nun folgend am Text untersucht werden. Abschließend soll dann genauer betrachtet werden, wie durch Manipulation / Täuschung Wahrscheinlichkeiten entstehen, ob diese schließlich auch in das Wahre überführt werden können und welcher Rezeptionshaltung es dazu bedarf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhaltliche Täuschung / Manipulation
- Hradschecks Plan – Inszenierte Zeichen und Theatralität
- Gerede, Vorurteile und Verdacht – Die Rolle der Dorfgemeinschaft
- Erzähltechnische Täuschung / Manipulation
- Titel
- Erzählperspektive
- Die Verwendung von Substituten
- Konstruktion von Wahrscheinlichkeit und Wirklichkeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht, wie Theodor Fontane in seiner Novelle „Unterm Birnbaum“ Manipulation und Täuschung als Mittel einsetzt, um ein kritisches Bild der Gesellschaft und der menschlichen Wahrnehmung zu zeichnen. Dabei analysiert sie sowohl die inhaltliche als auch die erzähltechnische Ebene der Novelle.
- Die Darstellung von Manipulation und Täuschung in Fontanes „Unterm Birnbaum“
- Die Rolle des Scheinens und der Oberflächlichkeit in der Dorfgemeinschaft Tschechin
- Die Konstruktion von Wahrscheinlichkeit und Wirklichkeit durch die Figuren und den Erzähler
- Fontanes Kritik an der Rezeptionshaltung und der oberflächlichen Interpretation von Ereignissen
- Die literarische Umsetzung von Realismus in Fontanes Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Manipulation und Täuschung in Fontanes „Unterm Birnbaum“ ein. Dabei wird der Fokus auf die Verbindung von Realität und Fiktion in Fontanes Realismuskonzept gelegt.
Das Kapitel „Inhaltliche Täuschung / Manipulation“ untersucht Hradschecks Plan, seinen Mord als Unfall darzustellen. Hierbei wird die Rolle von Inszenierungen, falschen Fährten und dem Streben nach Reichtum in der Dorfgemeinschaft Tschechin analysiert.
Das Kapitel „Erzähltechnische Täuschung / Manipulation“ analysiert verschiedene Erzähltechniken, die Fontane zur Täuschung des Lesers einsetzt. Dabei werden der Titel, die Erzählperspektive und die Verwendung von Substituten genauer betrachtet.
Das Kapitel „Konstruktion von Wahrscheinlichkeit und Wirklichkeit“ befasst sich mit der Frage, wie durch Manipulation und Täuschung Wahrscheinlichkeiten entstehen und wie diese von den Figuren interpretiert werden. Hierbei wird Fontanes Kritik an oberflächlichen Interpretationen und der Suche nach dem „Wahren“ hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter der vorliegenden Arbeit sind: Theodor Fontane, „Unterm Birnbaum“, Realismus, Manipulation, Täuschung, Dorfgemeinschaft, Wahrnehmung, Rezeptionshaltung, Schein, Wirklichkeit, Wahrscheinlichkeit, Interpretation, Theatralität.
- Arbeit zitieren
- Susann Dannhauer (Autor:in), 2012, Manipulation und Täuschung in Fontanes "Unterm Birnbaum", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196627