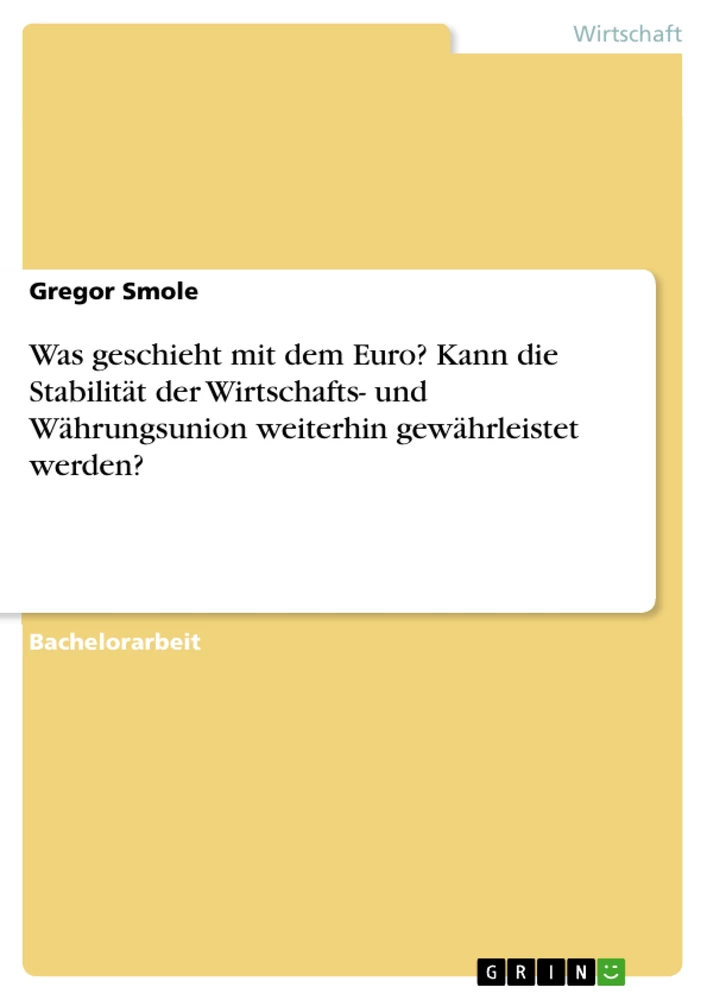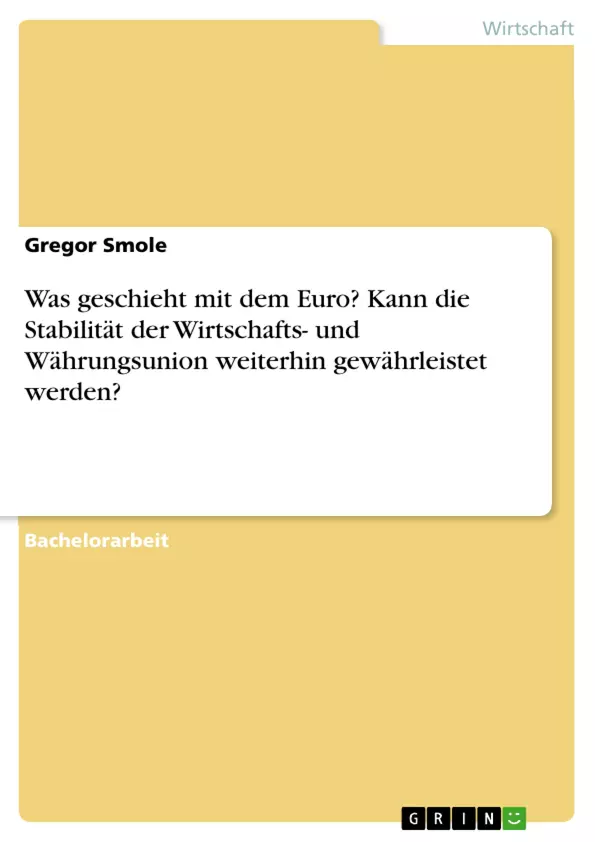Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, einerseits die aktuelle Situation des Euro und damit zusammenhängend der Europäischen Union zu analysieren und andererseits aufzuzeigen, ob das Währungssystem der Europäischen Union (EU) in der derzeitigen Form weiterhin bestehen kann, oder ob Anpassungen von Nöten sind.
Des Weiteren wird sich diese Arbeit mit den zur Krisenbewältigung gesetzten Maßnahmen der Organe der EU, z. B. der Europäischen Zentralbank (EZB), befassen. Insbesondere auf folgende Punkte soll eingegangen werden. Den befristeten Rettungsschirm European Financial Stability Facility (EFSF), den ab 2013 fix installierten Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und den mit diesen beiden Punkten zusammenhängenden Artikel 125 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), der No-Bail-out Klausel. Ebenso wird auf den Euro-Plus-Pakt, den Six-Pack und die Strategie 2020 der EU eingegangen. Dem werden weitere diskutierte Maßnahmen aus diversen wissenschaftlichen Werken gegenübergestellt.
Ein wichtiger Aspekt in Hinblick auf die Weltwährungsordnung und den ESM stellt der US-Dollar (USD), welcher als derzeitige Leitwährung als Benchmark herangezogen wird, dar. Ebenso die Rolle des Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Möglichkeit eines bereits angedachten und eigens zu schaffenden Europäischen Währungsfonds (EWF). Des Weiteren wird das Augenmerk auf das Finanzmarktsystem gelenkt.
Da kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über die Euro-Krise in diversen Medien berichtet wird, oder führende PolitikerInnen zitiert werden , ist die Aktualität dieses Themas wohl unumstritten. Wobei man sich aus wissenschaftlicher Sicht gesehen, mit der Frage befassen muss, wer oder was überhaupt in einer Krise steckt. Ist es die Europäische Union, der Euro, die Banken oder gar die Finanzmärkte? Oder liegt das eigentliche Problem doch viel tiefer? Ein möglicher Ansatz könnten die Zugangskriterien zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) sein und die Frage ob diese hätten strenger kontrolliert werden sollen.
Während auf die PIIGS-Staaten im Allgemeinen eingegangen wird, wird auf Griechenland und Irland gesondert eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Themenstellung und Relevanz der Themenstellung
1.2 Formulierung der Forschungsfrage
1.3 Stand der Literatur
1.4 Methodische Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
2 Die Geschichte des Finanzsystems
2.1 Goldwährung
2.2 Das Währungssystem von Bretton Woods
2.3 Klassik, Neoklassik & Keynes
2.3.1 Ökonomische Ideengeschichte
2.3.2 Konjunkturtheorien
3 Der Euro
3.1 Wer oder was befindet sich in einer Krise?
3.1.1 Die PIIGS-Staaten
3.1.2 Fiskalkrise und die Macht der Gläubiger
3.1.3 Fehler des Integrationsprojektes?
3.1.4 Krise des Finanzmarktkapitalismus?
3.2 Reaktionen der Europäischen Union
3.2.1 Entwickeln wir uns in Richtung einer Transferunion?
3.2.2 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
3.2.3 Euro-Plus-Pakt, Six-Pack & Strategie Europa
3.3 Diskutierte Maßnahmen zur Krisenbewältigung
4 Weltwährungsordnung
4.1 Währungsreserven
4.2 Feste und flexible Wechselkurse
4.3 Dollar – Federal Reserve System
4.4 Euro – Europäische Zentralbank
4.5 IWF vs. EWF
4.5.1 Internationaler Währungsfonds
4.5.2 Europäischer Währungsfonds
4.6 Finanzmarktsystem
4.6.1 Finanzmärkte und Finanzoligarchen
4.6.2 Das Sonderziehungsrecht
4.6.3 Bancor
4.6.4 International Clearing Union
5 Conclusio
6 Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Gregor Smole (Author), 2012, Was geschieht mit dem Euro? Kann die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion weiterhin gewährleistet werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196710