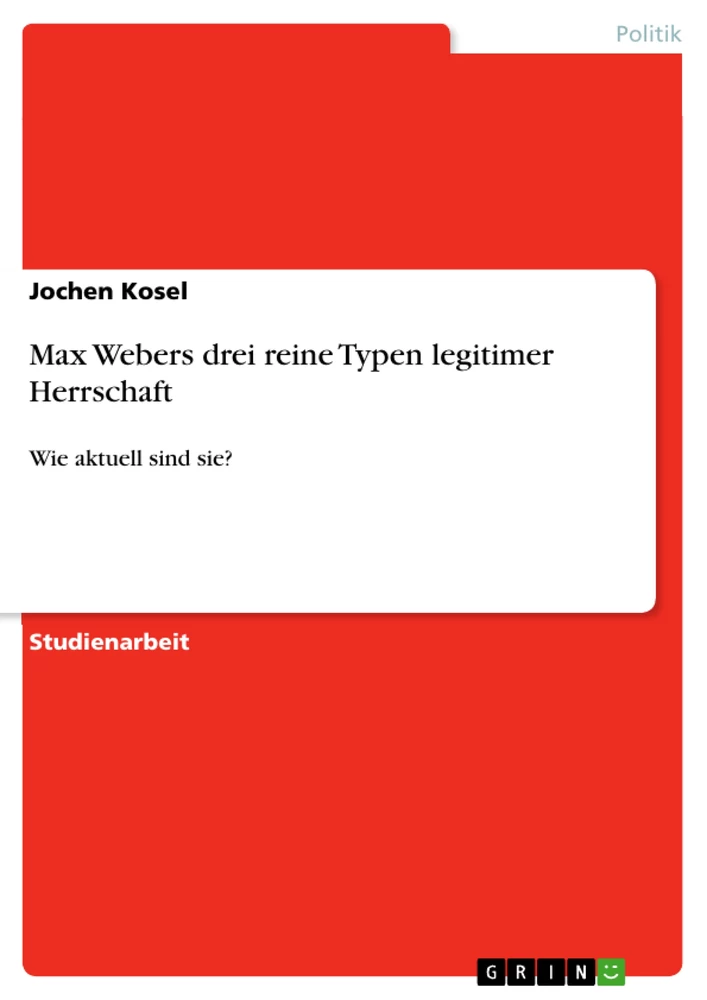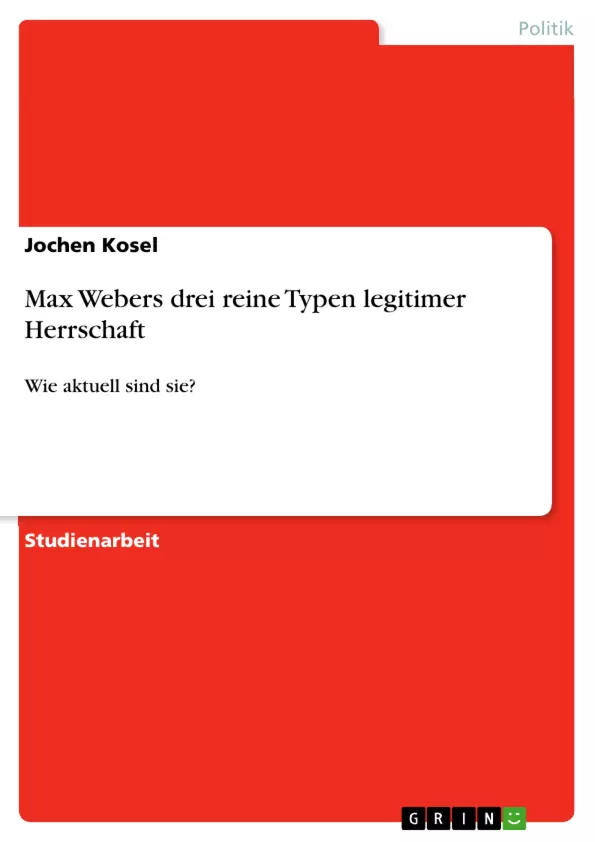Der Begriff der Herrschaft nimmt in Max Webers posthum erschienenem Hauptwerk Wirtschaft und Gesellschaft eine zentrale Position ein. Eine erste kurze Definition er-scheint bereits in den soziologischen Grundbegriffen, die aber, wie die anderen Grund-begriffe auch, nur die Basis für seine weiteren Ausführungen bildet. Ausführlich wid-met sich Weber dem Herrschaftsbegriff im dritten Kapitel, in dem er die drei reinen Typen legitimer Herrschaft definiert und somit die „Grundlagen der modernen Herr-schaftssoziologie […] geschaffen“ hat.
Für Weber bedeutet Herrschaft eine Beziehungsform, die durch Befehle und wider-spruchsfreien Gehorsam gegenüber diesen ausgedrückt wird, die also ein reziprokes Verhältnis zwischen Herrschenden und Beherrschten verkörpert und die sich daher ein-deutig von Webers Machtbegriff unterscheidet. Wenn Weber aber von den drei reinen Typen legitimer Herrschaft spricht, wirft das Fragen auf: Wie unterscheidet Weber Herrschaft von Macht? Was versteht er unter Legitimität? Wann gilt Herrschaft als legi-tim? Woher beziehen diese drei Typen ihren Legitimitätsanspruch und wie unterschei-den sie sich? Wenn Stefan Breuer anmerkt, dass niemand, „der historisch gearbeitet hat, […] den hohen Nutzen der von Weber vorgeschlagenen Typologie der Geltungsgründe verkennen“ wird, muss hinterfragt werden, ob diese Typologie der drei reinen Typen der Herrschaft nur in historischen Konstellationen zu finden ist oder ob sie auch im 21. Jahrhundert sinnvoll ist und sich in aktuellen Herrschaftskonstellationen widerspiegelt.
Daher ist das Ziel dieser Arbeit, Webers Herrschaftstypologie zu analysieren und an Beispielen die These zu belegen:
Die Herrschaftstypologie Max Webers hat bis heute ihre Gültigkeit nicht verloren und findet sich, wenn auch nicht in Reinform, in moder-nen Herrschaftsgebilden wieder.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Macht versus Herrschaft
2.1. Soziales Handeln und soziale Beziehung
2.2. Macht
2.3. Herrschaft
3. Legitimität von Herrschaft
3.1. Die Legitimitätsgeltung
3.2. Der Legitimitätsanspruch
4. Die drei reinen Typen legitimer Herrschaft
4.1. Die legale Herrschaft
4.2. Die traditionale Herrschaft
4.3. Die charismatische Herrschaft
5. Fazit
Bibliographie
- Quote paper
- M.A. Jochen Kosel (Author), 2009, Max Webers drei reine Typen legitimer Herrschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196798