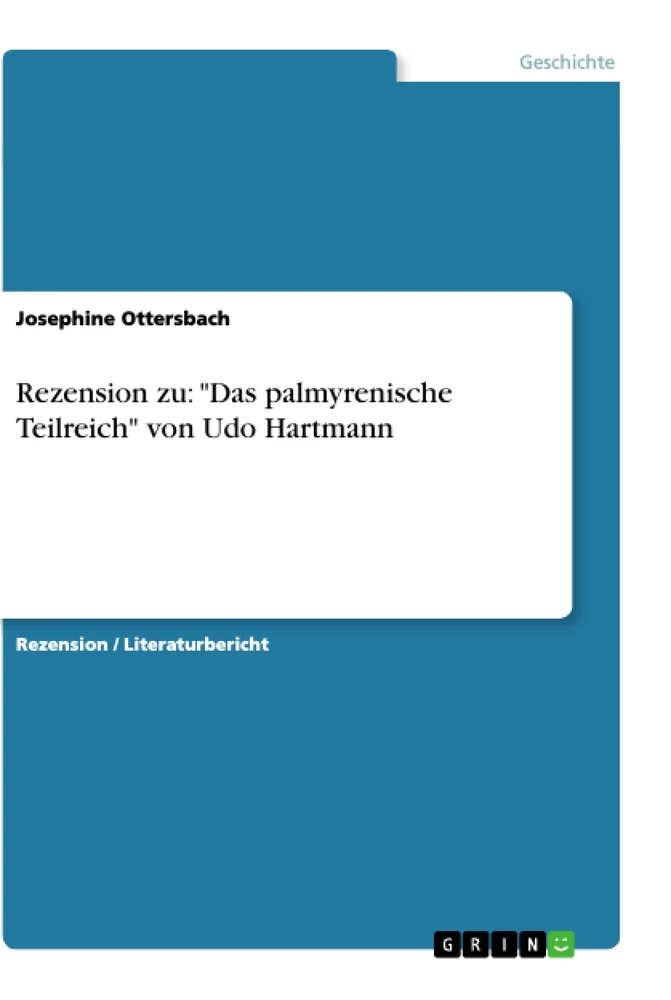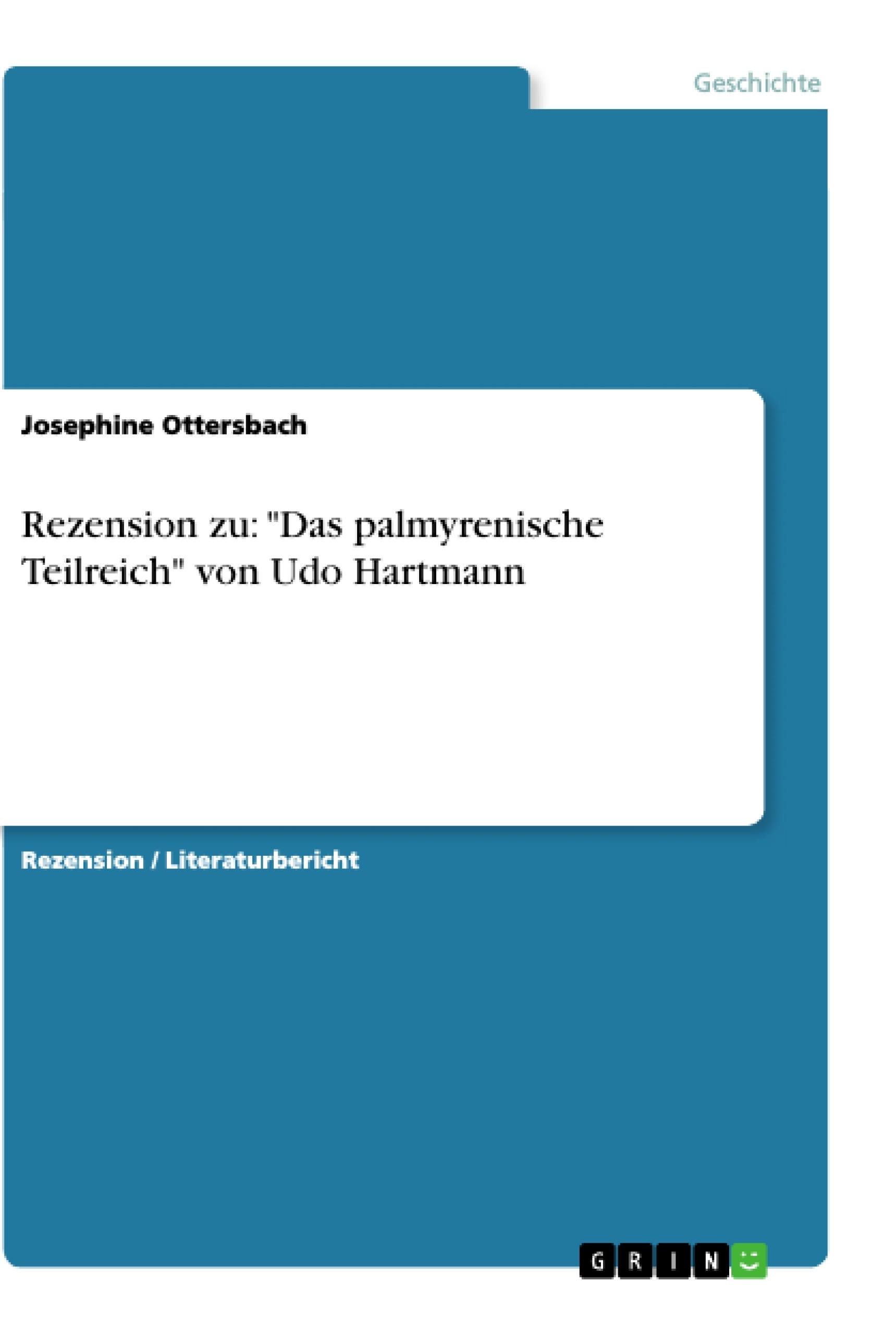Udo Hartmanns Buch “Das palmyrenische Teilreich” ist die überarbeitete Fassung seiner Dissertation, die im Wintersemester 1999/2000 vom Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin angenommen wurde. Die Dissertation behandelt die Entstehung des Sonderreichs der Dynasten aus der syrischen Oasenstadt Palmyra im Osten des Römischen Reiches zur Zeit der Soldatenkaiserzeit (235-285) und bietet eine umfassende Darstellung der Geschichte des palmyrenischen Teilreichs unter den Dynasten Odaenathus und Zenobia. Ziel des Autors ist es, die historische Rolle des Teilreichs in einer Gesamtschau der Krise des 3. Jahrhunderts auszuwerten. Die Krise, in der sich das Römische Reich zum Zeitpunkt der “Gründung” des palmyrenischen Teilreichs befand, war geprägt durch die veränderte Lage an der Ostgrenze, da die Sasaniden eine aggressive Politik gegen Rom führten. Hinzukamen permanente Einfälle äußerer Feinde an unterschiedlichen Grenzen und die Instabilität der kaiserlichen Regierung. Demzufolge fanden zahlreiche Usurpationen und schnelle Herrscherwechsel statt, in deren Zusammenhang sich eine regionale Herrschaft im Orient herausbildete. Im Jahr 260 wird der Romkaiser Valerianus durch den Sasaniden Shapur gefangengenommen; zur gleichen Zeit entsteht das palmyrenische Teilreich. Dieses palmyrenische Teilreich stellt ein Herrschaftsgebiet eines formal legitimierten Machthabers, der unter Anerkennung der Superiorität des Augustus in Rom kaiserliche Aufgaben in einem Reichsteil als Kaiserstellvertreter im Interesse der Sicherheit des Gebietes unternimmt, dar. Daher findet die Regentschaft formal im Auftrag des Kaisers statt. Das palmyrenische Teilreich präsentiert als Sonderreich die Problemlage und Bedrohung an den Grenzen des Römischen Reiches und insbesondere die Schwäche der Zentrale Rom. Um das Thema umfassend zu bearbeiten, nutzt Udo Hartmann die unterschiedlichsten Quellen und wertet die gesamte Forschungsliteratur aus, um eine Rekonstruktion der Ereignisse zu erstellen.
II. Zum Autor
Der Autor des Buches “Das palmyrenische Teilreich”, Udo Hartmann, wurde 1970 geboren. Seinen Studiengängen Geschichte und Philosophie ging er an der Universität in Leipzig und an der Freien Universität Berlin von 1990-1997 nach. Von 1997 bis 1999 arbeitete er an einer Dissertation zur Geschichte des palmyrenischen Teilreiches; hierbei wurde er durch die Studienstiftung des deutschen Volkes gefördert. Am 18. Mai 2000 beendete er schließlich seine Promotion erfolgreich. 1998 erhielt er einen Lehrauftrag an der Freien Universität Berlin und blieb dort bis 1999. Ebenfalls 1998 begann er mit der Mitarbeit an einem Projekt zur Spätantike bei Professor Alexander Demandt, an dem er bis 2001 mitwirkte. Ab 2001 (bis 2007) war er wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Alte Geschichte an der Humboldt Universität Berlin und gleichzeitig Review-Editor für Alte Geschichte bei H-Soz-u-Kult (Humanities Sozial- und Kulturgeschichte). Seit dem Wintersemester 2007/2008 ist er Vertretung der Assistenz für Alte Geschichte an der Technischen Universität Dresden und seit dem Sommersemester 2008 Lehrkraft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel für besondere Aufgaben in Alter Geschichte.
Udo Hartmanns Hauptforschungsgebiet ist die Begegnung orientaler und okzidentaler Kulturen im nahöstlichen Raum. Er ist Mitglied der Arbeitsgruppe Orient und Okzident, die eine Schriftenreihe zur Alten Geschichte erstellt, die sich auf antike Kulturkontakte spezialisiert; sie wurde im Jahr 2000 gegründet. Einige Publikationen Hartmanns sind neben dem palmyrenischen Teilreich “Grenzüberschreitungen. Formen des Kontakts zwischen Orient und Okzident im Altertum”, “Deleto paene imperio Romano. Transformationsprozesse des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert und ihre Rezeption in der Neuzeit” und “Geschlechterdefinitionen und Geschlechtergrenzen in der Antike”. Aktuell beschäftigt er sich mit einem Habilitationsprojekt zu den spätantiken Philosophenviten, arbeitet am Projekt “Die Zeit der Soldatenkaiser. Handbuch zur Geschichte der Reichskrise im 3. Jahrhundert” mit und führt Forschungen zu den Beziehungen zwischen dem Römischen Reich und den Parthern bzw. Sasaniden durch. Schließlich arbeitet er an einem Publikationsprojekt in Zusammenarbeit mit Irene Huber zur Rolle von Frauen am Hof der Arsakiden und Sasaniden.
III. Einleitung
Udo Hartmanns Buch “Das palmyrenische Teilreich” ist die überarbeitete Fassung seiner Dissertation, die im Wintersemester 1999/2000 vom Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin angenommen wurde. Die Dissertation behandelt die Entstehung des Sonderreichs der Dynasten aus der syrischen Oasenstadt Palmyra im Osten des Römischen Reiches zur Zeit der Soldatenkaiserzeit (235-285) und bietet eine umfassende Darstellung der Geschichte des palmyrenischen Teilreichs unter den Dynasten Odaenathus und Zenobia. Ziel des Autors ist es, die historische Rolle des Teilreichs in einer Gesamtschau der Krise des 3. Jahrhunderts auszuwerten. Die Krise, in der sich das Römische Reich zum Zeitpunkt der “Gründung” des palmyrenischen Teilreichs befand, war geprägt durch die veränderte Lage an der Ostgrenze, da die Sasaniden eine aggressive Politik gegen Rom führten. Hinzukamen permanente Einfälle äußerer Feinde an unterschiedlichen Grenzen und die Instabilität der kaiserlichen Regierung. Demzufolge fanden zahlreiche Usurpationen und schnelle Herrscherwechsel statt, in deren Zusammenhang sich eine regionale Herrschaft im Orient herausbildete. Im Jahr 260 wird der Romkaiser Valerianus durch den Sasaniden Shapur gefangengenommen; zur gleichen Zeit entsteht das palmyrenische Teilreich. Dieses palmyrenische Teilreich stellt ein Herrschaftsgebiet eines formal legitimierten Machthabers, der unter Anerkennung der Superiorität des Augustus in Rom kaiserliche Aufgaben in einem Reichsteil als Kaiserstellvertreter im Interesse der Sicherheit des Gebietes unternimmt, dar. Daher findet die Regentschaft formal im Auftrag des Kaisers statt. Das palmyrenische Teilreich präsentiert als Sonderreich die Problemlage und Bedrohung an den Grenzen des Römischen Reiches und insbesondere die Schwäche der Zentrale Rom. Um das Thema umfassend zu bearbeiten, nutzt Udo Hartmann die unterschiedlichsten Quellen und wertet die gesamte Forschungsliteratur aus, um eine Rekonstruktion der Ereignisse zu erstellen.
IV.Aufbau und Inhalt des Buches
Die ersten drei Kapitel des Buches beschäftigen sich mit dem Problem des palmyrenischen Teilreichs, den Überlieferungen antiker Autoren, orientalischer Schriftquellen und Primärquellen sowie mit der Oasenstadt Palmyra. In Kapitel 4 (Der Herrscher von Palmyra) analysiert Udo Hartmann den Aufstieg des Odaenathus zum Herrn in Palmyra und zum Konsular vor dem Hintergrund der Krise der Oasenstadt.
Weiter betrachtet er die Genealogie der Dynastenfamilie. Im fünften Kapitel (Die Machtübernahme des Odaenathus im Orient) untersucht er das krisenhafte Jahr 260, in dem Kaiser Valerianus gefangengenommen wird und Odaenathus die Macht im Orient übernimmt. Kapitel 6 (Der sonnengesandte Löwe) behandelt die Herrschaft des Odaenathus über den Orient, seine Perserzüge, die Annahme des Köingstitels durch den Palmyrener nach dem Sieg über die Sasaniden, den Ausbau seiner Macht und schließlich die Ermordung des Königs. Im darauffolgenden Kapitel (Die Chronologie der Jahre 268- 276) werden die chronologischen Probleme der Jahre zwischen 268-276 geklärt. Im achten Kapitel (Die Regentschaft der Zenobia) beschäftigt sich Udo Hartmann mit den Herrschaftsphasen des Königs Vaballathus unter der Regentschaft von Zenobia 267-272, der Festigung und Ausdehnung der Macht über den römischen Orient, die Strukturen des Teilreichs und die Haltung einzelner Gruppen zu den Dynasten. Kapitel 9 (Aurelianus und Zenobia) handelt von der Auseinandersetzung zwischen Aurelianus und Zenobia im Jahr 272, der Annahme des Augustus Titels durch Vaballathus und der militärischen Niederlage der Zenobia. Das zehnte Kapitel (Der zweite Orientzug des Aurelianus) behandelt die Revolten des Jahres 273, einmal die Usurpation des Antiochius in Palmyra und dann die Unruhen in Ägypten. Kapitel 11 (Der restitutor orbis und die besiegte Königin) beinhaltet die Entstehung des Begriffs “restitutor orbis” für Aurelianus sowie die Analyse der Quellen zum Schicksal der Zenobia nach dem Triumphzug des Aurelianus. Im zwölften und letzten Kapitel (Das palmyrenische Teilreich und die Krise des 3. Jahrhunderts) ist eine Interpretation der Geschichte des palmyrenischen Teilreichs im Rahmen der Krise des 3. Jahrhunderts zum Verständnis der Politik der palmyrenischen Dynasten und der Kaiser vor dem Hintergrund der historischen Situation im Orient zu finden. Hier wird noch einmal die Rolle Palmyras im 3. Jahrhundert bei der Sicherung der Ostgrenze, die Entstehung des Teilreichs, der Spezifische Charakter der Teilreichsherrschaft und die Interpretation der allgemeinen Rolle des Teilreichs erläutert. Ferner wird ein Lösungsversuch für die strukturellen Probleme des Reiches durch die Aufteilung der Verantwortung zwischen den Herrschern im Orient und im Westen (u.a. Gallisches Sonderreich) im Rahmen der Institutionen des Imperium Romanum unternommen.
Die antiken Autoren, deren Quellen Udo Hartmann verwendet, sind: Eutropius, Festus, Aurelius Victor, Hieronymus, Eusebius, Johannes von Antiochia, Orosius, Iordanes, Polemius Silvius, Zosimus, Johannes Malalas, Petrus Patricius, Agathias, Georgios Synkellos, Photius und Johannes Zonaras. Die dazugehörigen Quellen sind u.a.: Scriptores Historiae Augustae, Vita Odenati, Vita Zenobiae, Vita Aureliani, laterculus, Nea historia und das 13. griechische Orakel.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was war das palmyrenische Teilreich?
Es war ein Sonderreich im Osten des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert, das unter den Dynasten Odaenathus und Zenobia eine regionale Eigenständigkeit erlangte.
Wer war Königin Zenobia?
Zenobia war die Regentin von Palmyra, die die Macht über den römischen Orient ausdehnte und sich schließlich offen gegen Rom stellte.
Was löste die Krise des 3. Jahrhunderts aus?
Die Krise war geprägt durch aggressive Sasaniden an der Ostgrenze, germanische Einfälle, Instabilität der Kaiserregierung und zahlreiche Usurpationen.
Wie endete das palmyrenische Sonderreich?
Kaiser Aurelianus besiegte Zenobia im Jahr 272 militärisch und stellte die Einheit des Römischen Reiches wieder her, wofür er den Titel „restitutor orbis“ erhielt.
Welche Rolle spielte Odaenathus?
Er war der Herr von Palmyra, der nach der Gefangennahme Kaiser Valerians die Verteidigung des Orients gegen die Perser übernahm und formal als Kaiserstellvertreter agierte.
Warum ist Udo Hartmanns Forschung wichtig?
Hartmann bietet eine umfassende Rekonstruktion der Ereignisse und analysiert die historische Rolle Palmyras als Pufferstaat und regionales Machtzentrum.
- Citar trabajo
- Josephine Ottersbach (Autor), 2008, Rezension zu: "Das palmyrenische Teilreich" von Udo Hartmann, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196884