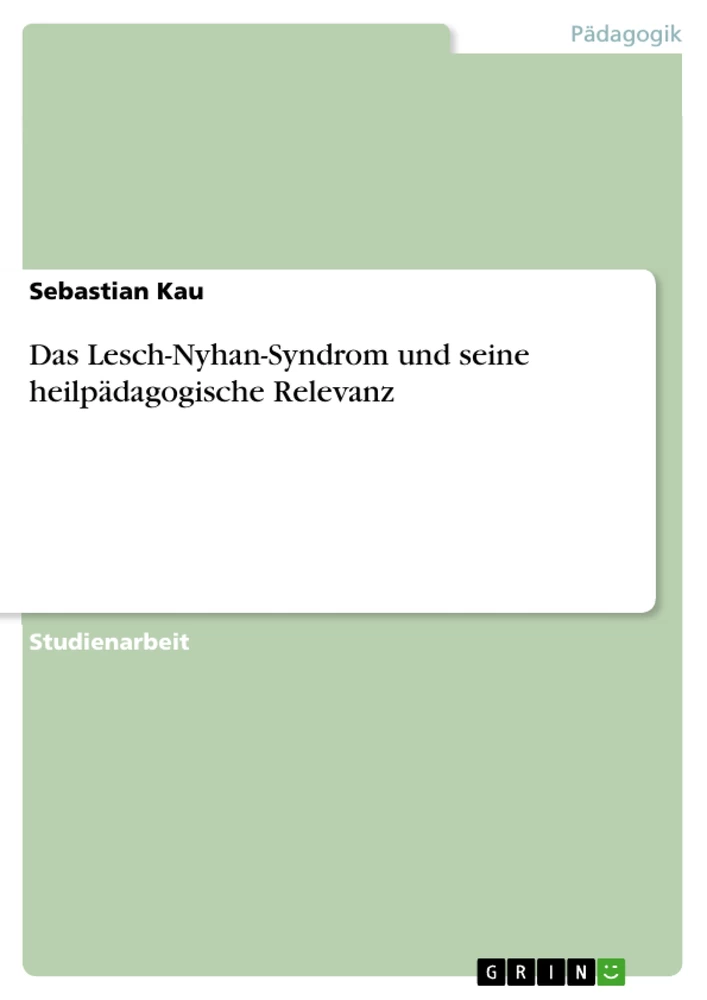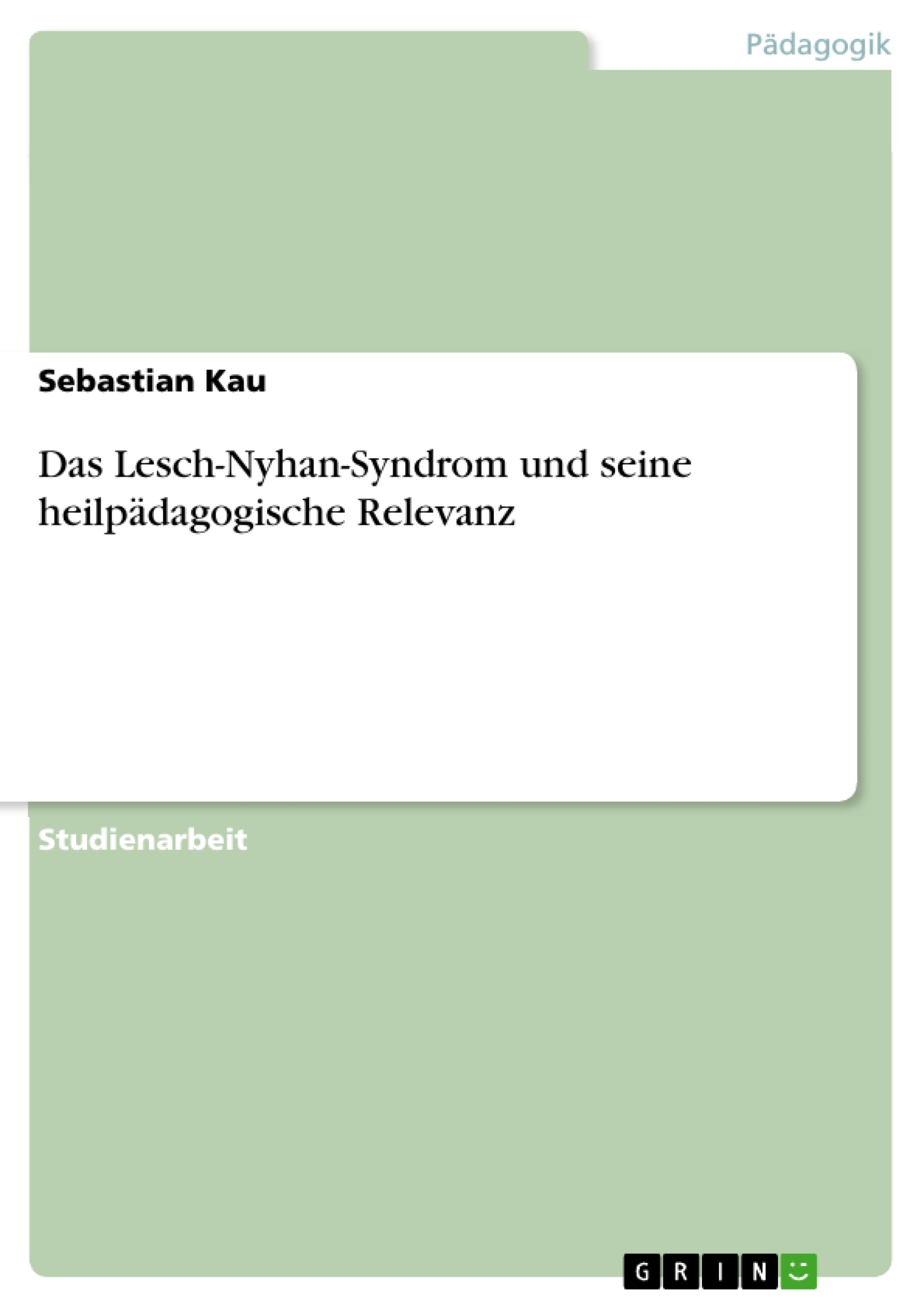Sebastian Kau studiert an der ev. Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum im Studiengang Heilpädagogik.
Mit vorliegender Arbeit hat er sich einem seltenen Behinderungsbild zugewandt, welches in der Fachwelt realtiv wenig diskutiert wird.
In Bezug auf führende U.S. amerikanische Forscher in diesem Gebiet erläutert Kau unter Einbeziehung aktueller Forschungsergebnisse das Krankheitsbild, sowie seine Relevanz im heilpädagigischen Arbeitsfeld.
Das Lesch-Nyhan-Syndrom ist eine prognostisch eher ungünstige Erkrankung, basierend auf einer Störung des Purinstoffwechsels. Auf das Syndrom aufmerksam geworden bin ich durch einen Bericht in der Zeitschrift „Spiegel“ aus dem Jahre 2008. Dort wurde über einen Lesch-Nyhan-Erkrankten berichtet. Durch Tiefenhirnstimulation sollte dem Erkrankten dabei geholfen werden seinen Körper besser kontrollieren zu können. Diese relativ neuen, für mich sehr interessanten Therapieformen, die Tatsache, dass das Lesch-Nyhan Syndrom eine eher seltene Krankheit ist und daher weniger breites Interesse erfahren hat, sowie die mit dem Syndrom einhergehende Grausamkeit für den Betroffenen und dessen Familie haben mein Interesse an der Erkrankung geweckt und mich dazu veranlasst, mich in meiner Hausarbeit mit ihr zu beschäftigen.
Gliederung
1 Einleitung
2 Begriffsdefinition
3 Ätiologie
3.1 Genetik
4 Pathogenese
5 Symptomatik
6 Klassifikation ICD-10 / Diagnose
6.1 Diagnoseverfahren
7 Epidemiologie
7.1 Prävalenz / Inzidenz
8 Prognose
8.1 Therapieformen
9 Heilpädagogische Relevanz und Intervention
10 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Das Lesch-Nyhan-Syndrom ist eine prognostisch eher ungünstige Erkrankung, basierend auf einer Störung des Purinstoffwechsels. Auf das Syndrom aufmerksam geworden bin ich durch einen Bericht in der Zeitschrift „Spiegel“ aus dem Jahre 2008. Dort wurde über einen Lesch-Nyhan-Erkrankten berichtet. Durch Tiefenhirnstimulation sollte dem Erkrankten dabei geholfen werden seinen Körper besser kontrollieren zu können. Diese relativ neuen, für mich sehr interessanten Therapieformen, die Tatsache, dass das Lesch-Nyhan Syndrom eine eher seltene Krankheit ist und daher weniger breites Interesse erfahren hat, sowie die mit dem Syndrom einhergehende Grausamkeit für den Betroffenen und dessen Familie haben mein Interesse an der Erkrankung geweckt und mich dazu veranlasst, mich in meiner Hausarbeit mit ihr zu beschäftigen.
2 Begriffsdefinition
Die Erstbeschreibung des Syndroms stammt von dem Pädiater Dr. William Nyhan und seinem Studenten Michael Lesch. Es handelt sich um eine genetisch vererbbare, x-chromosomal rezessiv bedingte Veränderung des Purinstoffwechsels. Klinisch charakterisiert ist sie durch eine normale Schwangerschaft und eine komplikationslose Geburt. Weiter durch eine zunächst unauffällige Entwicklung in der Neugeborenen- und Säuglingszeit, später durch eine progrediente und vorwiegend dyskinetische Zerebralparese. Ab Mitte des ersten Lebensjahres können bereits erworbene Fähigkeiten wieder verloren gehen und bereits im zweiten Lebensjahr können spezifische Formen der Autoaggression, wie zwanghaftes Beißen an Fingern, Händen, Lippen und Wangenschleimhaut diagnostizierbar sein. Außerdem kommt es zu einer deutlichen psychomotorischen Retardierung.
3 Ätiologie
Das Lesch-Nyhan Syndrom wurde 1964 erstmalig beschrieben. Gicht (als Folge von Hyperurikämie) war schon zu den Zeiten von Hippokrates bekannt, kam jedoch hauptsächlich unter alten Männern vor. Da Hyperurikämie jedoch durch verschiedene Enzymdefekte, beim Lesch-Nyhan Syndrom durch einen Mangel an Hypoxanthin-Guanin-phosphoribosyltransferase (in Eythrozyten, Leber und Zentralnervensystem), hervorgerufen werden kann und die (historische) Literatur keine näheren Angaben dazu macht, bleibt ein erstes Auftreten des Syndroms unbekannt. Im folgenden werden die ausschließlich genetischen Ursachen des Syndroms beschreiben.
3.1 Genetik
Das Lesch-Nyhan Syndrom wird x-chromosomal-rezessiv vererbt. Es handelt sich um eine Mutation des HPRT-1 Gens (Hypoxanthin-Guanin-phosphoribosyltransferase – auch HPGRT genannt) auf dem X-Chromosom (Xq26-q27.2) (~44 kb, 9 Exons; mehr als 70 Allele bekannt), welche zur Folge hat, dass eine unzureichende Funktion des Enzyms HPRT besteht.
4 Pathogenese
Beim HPRT Defekt werden Purinbasen, welche aus Nukleotiden bestehen nicht reutilisiert. Die Bildung von Guanin und GMP aus Nukleosiden ist gehemmt. Guanin und GMP haben wiederum eine hemmende Wirkung auf die De-novo-Synthese von Purin. Diese Wirkung entfällt nun und es kommt zu einer vermehrten Bildung von Hypoxanthin, Xanthin und schlecht löslicher Harnsäure (Abbauprodukt der Purine). Hieraus resultiert Hyperurikämie. Dies hat zur Folge, dass aufgrund der hohen Mengen an Harnsäurekristallen im Blut Schädigungen am Gehirn, am zentralen Nervensystem und an weiteren Organen entstehen, was zu unten beschriebenen Symptomen führen kann.
5 Symptomatik
Das Lesch-Nyhan Syndrom verursacht sehr unterschiedliche Systemkombinationen durch Schädigung unterschiedlicher Organe:
Zentrales Nervensystem: Es kommt zunächst zu einer Entwicklungsverzögerung, welche sich im 3.-6. Lebensmonat manifestiert. Auch kommt es zu zerebralen Bewegungsstörungen wie Spastiken und Choreathetose. Diese sind ab dem 6.-12. Lebensmonat zu beobachten. Im 2.-3. Lebensjahr manifestieren sich meist auto- und fremdaggressive Verhaltensweisen (siehe auch ICD-10: F68.1) mit Automutilation, Selbstverstümmelung, Beißen in Lippen, Hände und Arme (nur auf einer Körperseite), Wangen, Mundschleimhaut bei normalem Schmerzempfinden. Außerdem kommt es neben zerebralen Anfällen zu einer deutlichen psychomotorischen Retardierung (IQ 35-60; bei juvenilen Formen IQ bis etwa 80 (vgl. Emminger 2009) mit dysarthrischer Sprache. Niere: Aufgrund von vermehrten Harnsäurekristallen im Blut (Hyperurikämie) kann es zu sekundären Nierenveränderungen durch Nephrolithiasis (Nierensteine) mit Hämaturie (Blut im Urin) und Nierenfunktionsstörungen, bis hin zu Nierenversagen kommen. Bereits im Säuglingsalter sind orangefarbene Harnsäurekristalle in der Windel zu finden, welche Harnwegsinfekte verursachen können. Gelenke: Eine weitere Folge von Hypeurikämie sind Gichterscheinungen wie Arthropathie und Tophie. Immunsystem und Hämatologie: Aufgrund eines oftmals bestehenden Fohlsäuremangels, hervorgerufen durch vermehrten Folsäurebedarf, bedingt der erhöhten Harnsäureausscheidung, kann es zu einer megaloblastischen Anämie kommen. Eine pathologische Thrombozytenmorphologie, sowie eine eingeschränkte B-Zell- Funktion zeigen sich ferner auch. Sonstiges: Des Weiteren können Minderwuchs, eventuell Typ-IV-Hyperbetalipoproteinanämie und / oder elektope Kalzifikationen auftreten.
Bei juvenilen Formen des Syndroms können ein leichter Verlauf der Hyperurikämie mit Nephrolithiasis, Gichtsymptomatik und höchstens geringen Störungen vorkommen. (vgl. Witkowski 2003)
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Lesch-Nyhan-Syndrom?
Das Lesch-Nyhan-Syndrom (LNS) ist eine seltene, genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung, die auf einem Mangel des Enzyms Hypoxanthin-Guanin-Phosphoribosyltransferase (HPRT) basiert und zu einer Überproduktion von Harnsäure führt.
Welche Symptome sind typisch für LNS?
Typisch sind neurologische Störungen wie Spastiken und Bewegungsstörungen (Choreathetose), psychomotorische Retardierung sowie zwanghafte Autoaggression, insbesondere das Beißen in Lippen und Finger.
Wie wird das Lesch-Nyhan-Syndrom vererbt?
Die Krankheit wird x-chromosomal-rezessiv vererbt. Das bedeutet, dass fast ausschließlich Jungen betroffen sind, während Frauen meist nur Überträgerinnen (Konduktorinnen) sind.
Was ist die Ursache für die Autoaggression bei betroffenen Kindern?
Die genaue Ursache für das zwanghafte selbstverletzende Verhalten ist noch nicht vollständig geklärt, es steht jedoch im Zusammenhang mit der Schädigung des Zentralnervensystems durch den gestörten Purinstoffwechsel.
Welche Rolle spielt die Heilpädagogik bei dieser Erkrankung?
Die Heilpädagogik befasst sich mit Interventionsmöglichkeiten und der Unterstützung der Betroffenen und ihrer Familien im Alltag, um trotz der schweren Symptomatik Lebensqualität und Teilhabe zu fördern.
Gibt es neue Therapieansätze wie die Tiefenhirnstimulation?
Ja, die Arbeit erwähnt neuere Ansätze wie die Tiefenhirnstimulation, die darauf abzielen, die motorische Kontrolle der Patienten zu verbessern und unkontrollierte Bewegungen zu reduzieren.
- Quote paper
- Sebastian Kau (Author), 2011, Das Lesch-Nyhan-Syndrom und seine heilpädagogische Relevanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196989