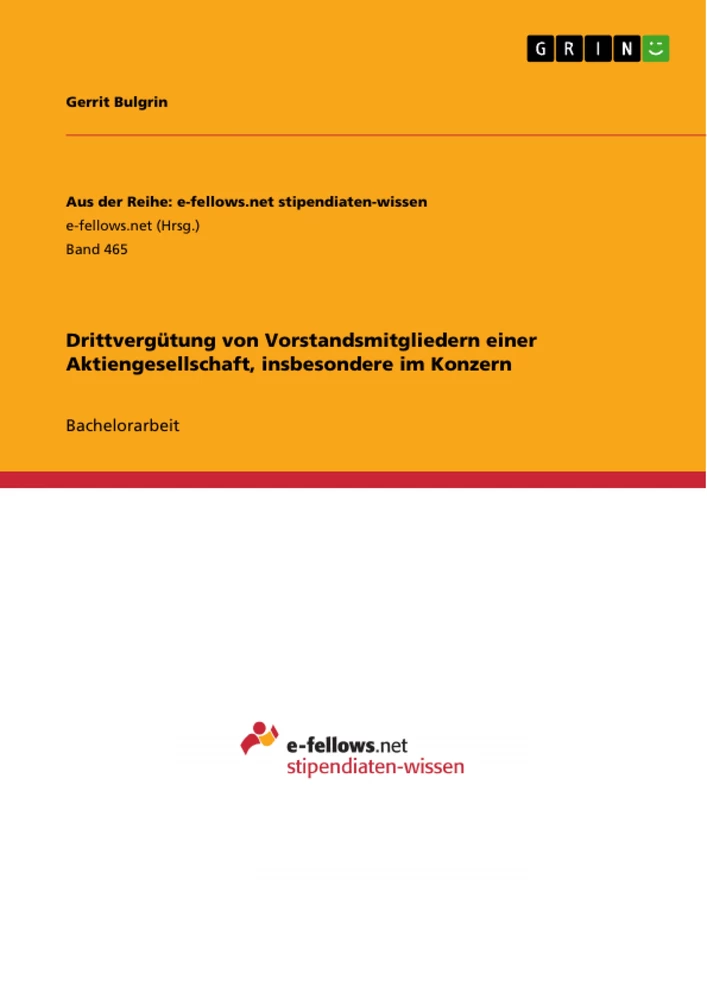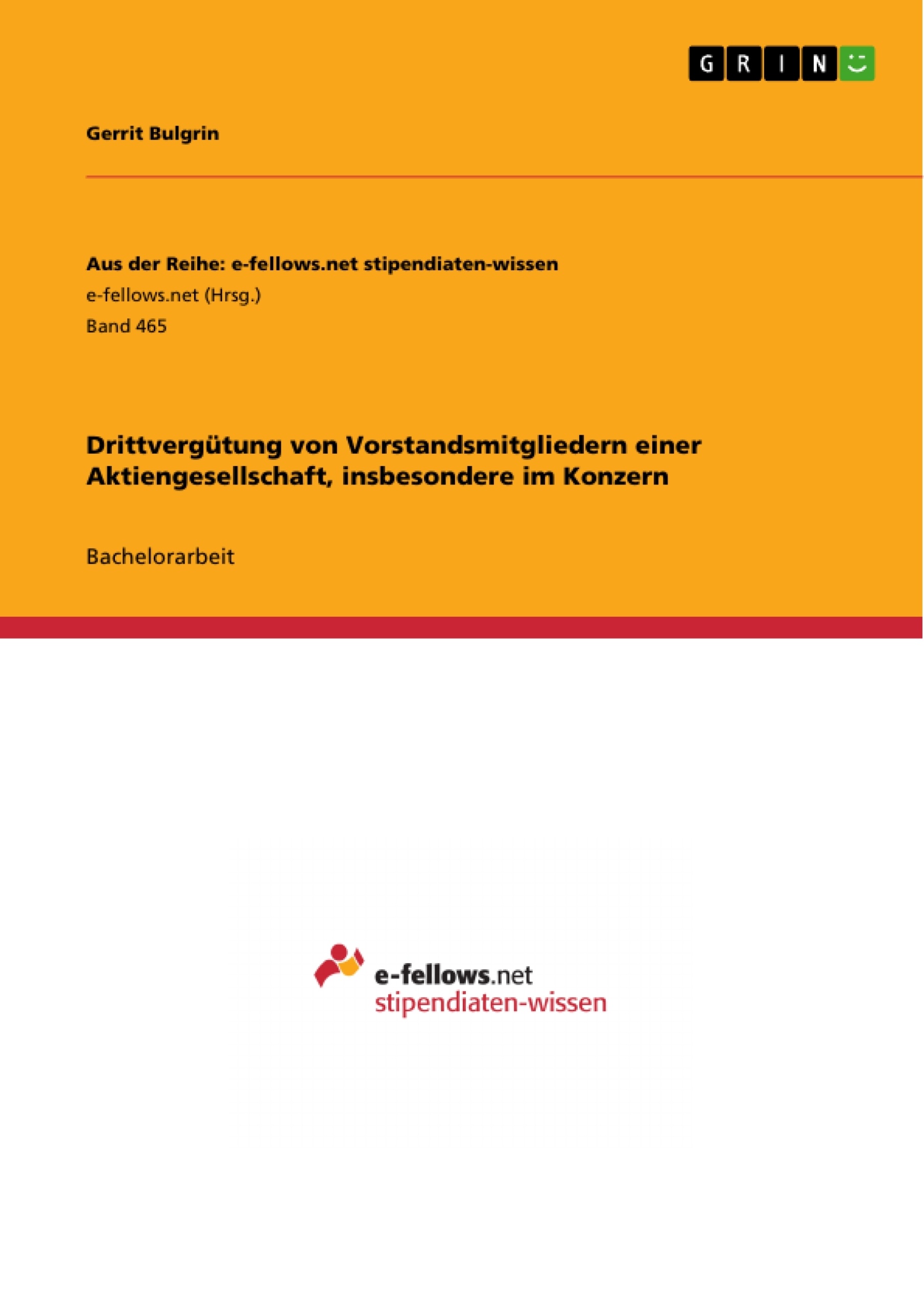Wie bereits bei Adam Smith angeklungen, ist das Verhalten von Vorständen in den letzen Jahren verstärkt zum Gegenstand öffentlicher Diskussion sowie wissenschaftlicher Erörterung geworden. Den Anlass dafür bilden mehrere schlagzeilenträchtige Skandale, sowie das steigende Interesse an Aktien in allen Bevölke-rungsschichten.
Vor dem Hintergrund dieser Skandale nehmen gleichzeitig die Fragen zu, wie Vorstände zukünftig effektiver kontrolliert werden können. Als eine erste Antwort auf diese Fragen sind insbesondere die Bildung der Regierungskommission Corporate Governance und die Schaffung des Corporate Governance Kodex im Jahre 2002 zu nennen. Gleichzeitig ist auch der Gesetzgeber in den letzten Jahren in immer kürzeren Abständen tätig geworden. Diese Maßnahmen reichen jedoch für die Disziplinierung des Managements häufig noch nicht aus.
Daher sind die Aktionäre vielfach zur anreizorientierten Vergütung von Vorstandsmitgliedern übergegangen, um den Vorstand auf diese Weise am unternehmerischen Risiko zu beteiligen oder zumindest die divergierenden Interessen zu einem Gleichlauf zu führen. Insbesondere im Rahmen von größeren Unternehmenstransaktionen kommt es dabei häufig vor, dass Aktionäre Bonuszahlungen ausloben, um die Unsicherheiten zu überwinden, denen die Anteilseigner und das Management in solchen Phasen der Veränderung ausgesetzt sind.
Erstaunlich ist allerdings, dass angesichts der Verbreitung dieses Phänomens bislang noch kaum Stellungnahmen in Literatur und Rechtsprechung existieren, zumal solche sogenannten
„Drittvergütungen“ komplexe Rechtsfragen hinsichtlich grundlegender Prinzipien des Aktienrechts aufwerfen: So ist der Vorstand einer AG gemäß § 76 Abs. 1 AktG dazu verpflichtet, diese unabhängig und im Interesse der Gesellschaft zu leiten. Eine Weisungsabhängigkeit ist im Gegensatz zur GmbH (§§ 37, 45 GmbHG) gerade nicht vorgesehen. Gleichzeitig greift der Aktionär durch die Vergütung des Vorstands möglicherweise in die ansonsten allein dem Aufsichtsrat zustehende Vergütungskompetenz (§ 87 Abs. 1 AktG) ein. Diese Konflikte sollen zum Anlass genommen werden, einen unverstellten Blick auf die Frage zu werfen, ob und unter welchen Voraussetzungen dem Vorstand einer Aktiengesellschaft im Zusammenhang mit seiner Vorstandstätigkeit finanzielle Zuwendungen durch Dritte, insbesondere durch Aktionäre, gewährt werden dürfen.
Gliederung
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
LITERATURVERZEICHNIS
A. EINLEITUNG
B. URSACHE DER DRITTVERGÜTUNG: DIE PRINCIPAL-AGENT-PROBLEMATIK
C. DRITTVERGÜTUNG IN EINER UNABHÄNGIGEN AKTIENGESELLSCHAFT
I. INTERESSENLAGE DER PARTEIEN (AM BEISPIEL EINER M&A TRANSAKTION)
1. Interessen des Großaktionärs
2. Interessen des potentiellen Käufers
3. Interessen der Vorstandsmitglieder
4. Mögliche Interessenkonflikte
II. AKTUELLER MEINUNGSSTAND
1. Rechtsprechung
2. Literatur
III. RECHTLICHE ZULÄSSIGKEIT
1. Mögliche Vorentscheidung des Gesetzgebers
a) Vorgaben des HGB
b) Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex
c) Vorgaben aus der Sicht des Principal-Agent-Konflikts (rechtsökonomisch)
2. Rechtliche Vorgaben aus Sicht des potentiellen Käufers
Ungerechtfertigte Vorteilsgewährung gemäß § 33d WpÜG
3. Rechtliche Vorgaben aus Sicht des Vorstands
a) Leitungsautonomie gemäß § 76 Abs. 1 AktG
b) Organschaftliche Treuepflicht gegenüber der Gesellschaft
aa) Handeln im Unternehmensinteresse
(1) Stakeholder Value Ansatz
(2) Shareholder Value Ansatz
(3) Stellungnahme
(4) Übertragung des Stakeholder Ansatzes auf die Drittvergütung
bb) Gesetzliches Wettbewerbsverbot gemäß § 88 AktG
4. Rechtliche Vorgaben aus Sicht des Großaktionärs
a) Verstoß gegen die Kompetenzen des Aufsichtsrats
aa) Anstellungskompetenz gemäß § 84 AktG
bb) Vergütungskompetenz gemäß § 87 AktG
(1) Festlegung durch den Aufsichtsrat
(2) Ermessensspielraum des Aufsichtsrats
b) Mitgliedschaftliche Treuepflicht gegenüber den außenstehenden Aktionären
5. Offenlegungspflicht gem äß § 285 HGB
IV. BEWERTUNG: DRITTVERGÜTUNG IN DER UNABHÄNGIGEN AG
D. DRITTVERGÜTUNG IM KONZERN
I. BESONDERHEIT: KONSTELLATION DER MITTELBAREN DRITTVERGÜTUNG
II. INTERESSENLAGE DER PARTEIEN
1. Interessen des herrschenden Aktionärs
2. Interessen des Vorstands der abhängigen Gesellschaft
3. Interessen der außenstehenden Aktionäre
III. AKTUELLER MEINUNGSSTAND
1. Literatur
2. Rechtsprechung
IV. RECHTLICHE ZULÄSSIGKEIT
1. Mögliche Vorentscheidung des Gesetzgebers
a) Vorgabe des § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG
b) Gesetzesbegründung (KonTraG)
2. Aktienrechtliche Vorgaben im faktischen Konzern
a) Wahrung des Unternehmensinteresses der Tochtergesellschaft
aa) Funktionsfähigkeit des Systems des gestreckten Einzelausgleichs
(1) Faktischer Ausschluss des Anwendungsbereichs
(2) Drittvergütung als solche als nachteilige Maßnahme?
(3) Zulässigkeit aufgrund bloßer Kumulation der Anreize?
(4) Verbot der Drittvergütung als Relikt des qualifiziert faktischen Konzerns?
(5) Wertungswiderspruch zur Zulässigkeit von Vorstandsdoppelmandaten?
bb) Ausnahme: Geringe Anreizintensität
b) Zustimmung des Aufsichtsrats
3. Aktienrechtliche Vorgaben im Vertragskonzern
a) Wahrung des Unternehmensinteresses der Tochtergesellschaft
b) Zustimmung des Aufsichtsrats
4. Aktienrechtliche Vorgaben in Sonderkonstellationen
a) Einpersonen-AG
b) Mehrstufiger Konzern
aa) Mehrstufiger Vertragskonzern
bb) Mehrstufiger faktischer Konzern
cc) Mehrstufiger Mischkonzern
5. Offenlegungspflicht gem äß § 314 HGB
V. BEWERTUNG UND LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN: DRITTVERGÜTUNG IM KONZERN
1. Zustimmung der Minderheitsgesellschafter
2. Vertragsgestaltung: Vereinbarung von Höchstbeträgen ( „ Caps “ )
3. Gesteigerte Überwachungspflichten des Aufsichtsrats
E. GESAMTERGEBNIS
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Drittvergütung bei Vorständen?
Es handelt sich um finanzielle Zuwendungen an Vorstandsmitglieder einer AG, die nicht von der Gesellschaft selbst, sondern von Dritten (z.B. Großaktionären) gewährt werden.
Warum ist die Drittvergütung rechtlich problematisch?
Sie kann die Leitungsautonomie des Vorstands (§ 76 AktG) gefährden und kollidiert mit der alleinigen Vergütungskompetenz des Aufsichtsrats (§ 87 AktG).
Was ist die Principal-Agent-Problematik in diesem Zusammenhang?
Es beschreibt den Interessenkonflikt zwischen Eigentümern (Aktionären) und Managern (Vorstand), den die Drittvergütung durch Anreize ausgleichen soll.
Gibt es Offenlegungspflichten für solche Zahlungen?
Ja, gemäß Handelsgesetzbuch (HGB) und dem Corporate Governance Kodex bestehen Transparenzpflichten, um Interessenkonflikte für andere Aktionäre sichtbar zu machen.
Ist Drittvergütung im Konzern zulässig?
Die Zulässigkeit ist komplex und hängt davon ab, ob das Unternehmensinteresse der Tochtergesellschaft gewahrt bleibt und ob der Aufsichtsrat zugestimmt hat.
- Citar trabajo
- Gerrit Bulgrin (Autor), 2011, Drittvergütung von Vorstandsmitgliedern einer Aktiengesellschaft, insbesondere im Konzern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197024