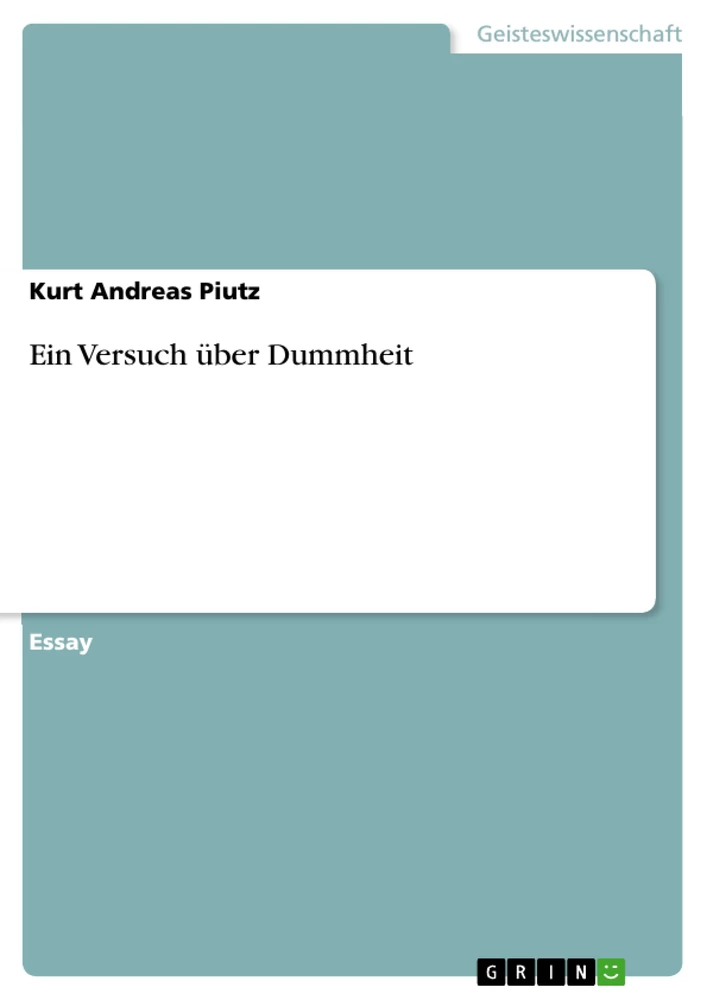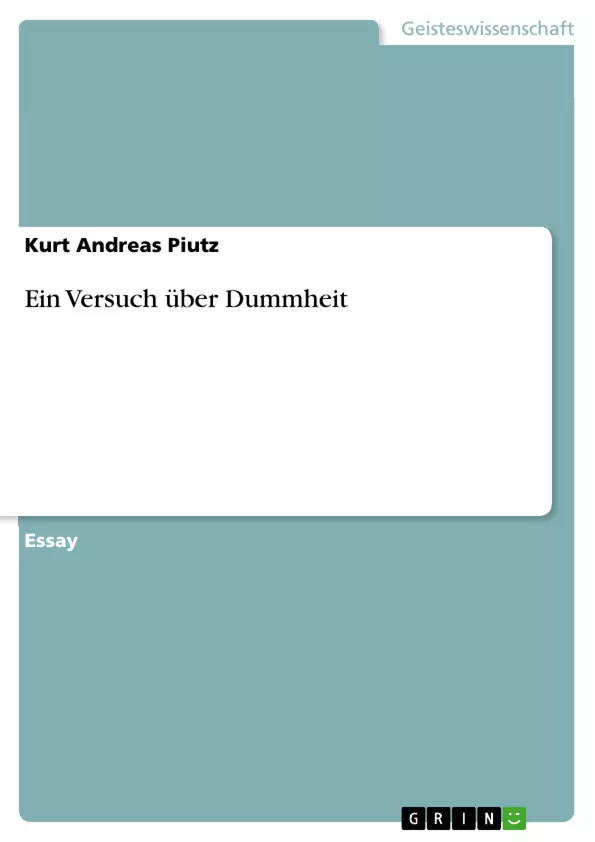Wenn ich von meinem Unwissen ausgehend nach Dummheit frage, meine ich fast schon "dümmlich" nach ihr zu fragen, deshalb frage ich nach ihr nicht wie nach einer Sache, Ding als Gegenstand, sondern nach dem "Begriff", der aber seiner konventionell umgangssprachlichen Begriffsbildung nach von (einer) meiner ausschließlich individualisierenden Betrachtungsweise schwer abzuheben ist.
Ich beginne mit der Absicht zuerst den Begriff oder etwas an dem Begriff aufzuzeigen, darzulegen, vielleicht auch festzustellen, was einstellungsmäßig (sozialpsychologisch) in bestimmter Weise daran aufzufassen wäre.
Wenn ich von meinem Unwissen ausgehend nach Dummheit frage, meine ich fast schon "dümmlich" nach ihr zu fragen, deshalb frage ich nach ihr nicht wie nach einer Sache, Ding als Gegenstand, sondern nach dem "Begriff", der aber seiner konventionell umgangssprachlichen Begriffsbildung nach von (einer) meiner ausschließlich individualisierenden Betrachtungsweise schwer abzuheben ist.
Zunächst erkläre[1] ich mir die Bestimmtheit eines Begriffes überhaupt als den Teil eines "Allgemeinen", der mich durch Gewissheit des (sinnlich oder wahrnehmenden) Erkennens ausstattet, aber nur durch oder von einem Ganzen her gedacht werden kann.
Es ist die Summe der in dem naiv-sinnlich wahrnehmenden Erkennen angesammelten Bestimmtheiten, die einen Begriff verdichten und in meinem Denken Vorstellung werden.
Denke ich z.B. "Heimat – Vaterland", so ist "Heimat" der aus unmittelbarem Erleben kommende erfahrungsmäßige Teil des von mir gedachten Begriffes "Vaterland". Ich müsste alle Bundesländer Österreichs bereisen, um nur teilweise über Erfahrungsdichte meines Heimatgefühlerlebens auch Wissensbestimmtheiten zu erlangen.
Und dennoch erhalte ich aus dem Begriff "Vaterland" nie die Erkenntnis aller Eigenheiten, die ich im eingegrenzten Teil meiner Heimat vorfinde. Wie sollte der Begriff allein schon die Eigenheiten der Menschen, Landschaften, d.h. ihre Tätigkeiten, Lebensgewohnheiten, ohne anschauliche Erfahrungsmöglichkeit "Vorstellung" ergeben?
Es fällt mir leichter in Begriffen wie "Pferd"-Eigenheiten eines oder aller Pferde zu denken. Platon, der das Allgemeine für das wirkliche Sein hielt, also "Pferd" zur "Pferdheit" erhob, dachte das Besondere nur durch Teilhaben am Allgemeinen wirklich! Durch diese Denkweise (gerade entgegen der Denkweise Aristoteles'), in welcher "Pferdheit" die "Idee" des Pferdes ist, denkt er die Besonderheit, das Bestimmte, wie Schnellfüßigkeit, Ausdauer, Kraft und andere hervortretenden Erkennbarkeiten an diesem oder anderen Tieren (Hundetreue, Löwenmut) zu einer Gesamtheit im Allgemeinen, zu einem Begriffe.
Um mich meiner analytisch nicht ganz erkennbaren Absicht noch mehr zu nähern, erkläre ich auch den Begriff "Wald" (es könnte auch "Heer", "Korn", "Meer" sein), der gewiss nur aus Bäumen gedacht, aber nicht durch Abstraktion "Baumheit" als wesensbezeichnender Begriff begreiflich wird.
An vielem Gleichartigen fehlt die konkrete Bestimmung des Einzelnen oder Besonderen. Im Nadelwald, Laubwald gibt es viele gleichartige Bäume. Durch den Begriff "Wald" denke ich aber die begreifbare Wesensbestimmtheit des einzelnen Baumes nicht mehr mit.
Ähnlich wie im Begriff "Heer" eine marschierende Masse nur durch ihren Zusammenhalt in ihrer Einheit auffällt, so wird auch im Begriff "Wald" die Einheit des Gleichartigen ohne Wesensbestimmtheit des Einzelbaumes mir begrifflich erkennbar.
Um endlich auf den Begriff "Dummheit" zu kommen, finde ich dem bisher zwar wenig Gesagten aber mehr Gedachten, dass man im umgangssprachlichen Gebrauch oder in der volkstümlichen Bezeichnung "Dummheit" verwendet, diese aber als ein Versagen bei vorausgesetzter verständiger Meisterung eine neuen Situation verstanden wird. Es liegt eher wie bei dem Worte "Schatten", dem man nur durch ein vorausgesetztes Licht, das einen Gegenstand beleuchtet, erhält.
Der Schatten hat seine Wirklichkeit nicht aus sich (in sich), sondern durch ein "Anderes", das ihn erzeugt – hat also nur Wahrnehmungswirklichkeit und ist somit kein Wesen. Alles nicht Wesenhafte ist aber nicht wirklich. Entferne ich das Licht, gibt es ihn nicht mehr, den Schatten.
Setze ich in Erwartung einer Handlung ein Ergebnis voraus, so benenne ich dieses einmal für klug, verständig, gescheit und einmal für "dumm" (unklug), und immer reagiert der Betroffene, eben als "dumm" Bezeichnete, mit "ja hätte ich das gewusst!"
Eine Handlung, die ich nicht vollbringe, wird nicht bewertet oder sogar für "dumm" gehalten, wie ein schattenspendendes Licht, das, wenn nicht vorhanden, keine Schatten werden kann.
Ich kann zwar eine Handlung nach einer bestimmten Erwartungsenttäuschung für "dumm" halten, aber nur in der bei mir verhafteten Meinung, das Licht meiner Urteilskraft oder Weisheit am Schatten der von mir als Dummheit bewerteten Handlung eines Menschen erkannt zu haben. Der Schatten der Handlungen meiner Mitmenschen aber hat Wahrnehmungswirklichkeit nur durch mein vermeintliches "Meinen", ich sei klüger als die anderen.[2]
[...]
[1] Das Ziel des Denkens, immer Einsicht durch ein aha-Erlebnis zu gewinnen, ist durch Erklären nicht immer vermittelbar. Wenn ich versuche diese Einsicht sprachlich zu vermitteln, wird selten die ursprünglich gemachte Einsicht erreicht. [Erklären reduziert immer den Inhalt des Gedankens – weniger aha-Erlebnis]
[2] Dummheit ist also ein Schattenbegriff (er besitzt keine Wesenswirklichkeit); im Volksmund: "Dem geht ein Licht auf".
Häufig gestellte Fragen
Wie wird „Dummheit“ in diesem Versuch definiert?
Dummheit wird nicht als feste Eigenschaft, sondern als „Schattenbegriff“ verstanden, der oft erst durch die Bewertung einer Handlung als unklug im Vergleich zu einer Erwartung entsteht.
Was bedeutet der Vergleich von Dummheit mit einem Schatten?
Wie ein Schatten nur durch Licht und einen Gegenstand existiert, benötigt Dummheit einen Betrachter, der sich für klüger hält und eine Handlung bewertet.
Welchen Einfluss hat Platon auf die Begriffsbildung in diesem Text?
Der Text bezieht sich auf Platons Ideenlehre, wonach das Allgemeine (die Idee) das wirkliche Sein darstellt, während das Besondere nur daran teilhat.
Warum ist Erfahrung für die Dichte eines Begriffes wichtig?
Begriffe wie „Heimat“ oder „Vaterland“ gewinnen erst durch persönliche, anschauliche Erfahrungen an inhaltlicher Tiefe und Vorstellungskraft.
Kann Dummheit als eigenständiges Wesen betrachtet werden?
Nein, im Text wird argumentiert, dass Dummheit keine Wesenswirklichkeit besitzt, da sie nur eine Wahrnehmungswirklichkeit durch das Urteil anderer ist.
- Citar trabajo
- Mag. Kurt Andreas Piutz (Autor), 2012, Ein Versuch über Dummheit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197083