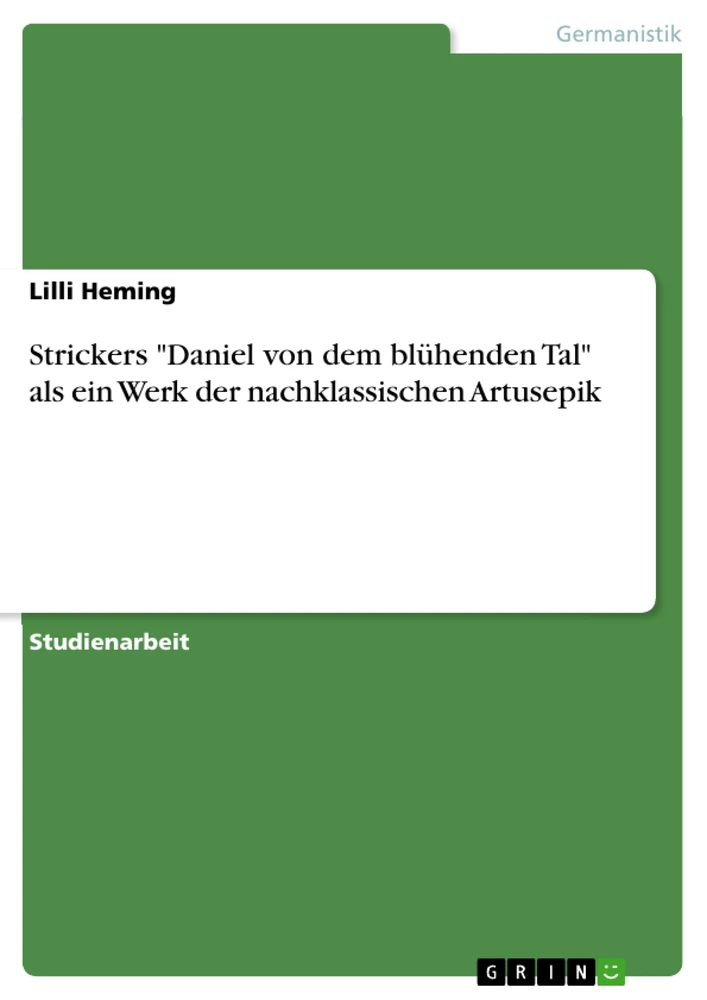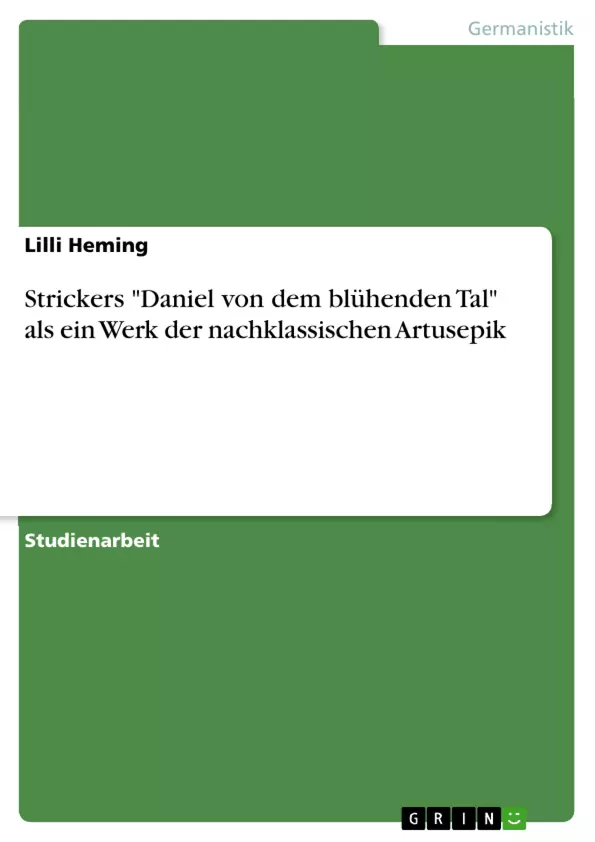Die vorliegende Hauptseminararbeit soll anhand der auffälligen Aspekte in Strickers "Daniel von dem blühenden Tal" den Wandel in der deutschen Artusepik aufzeigen und verdeutlichen, dass es sich um bewusste und beabsichtigte Veränderungen innerhalb eines etablierten Genres des Autors handelt. Dabei soll immer wieder Bezug zu den bekannten Forschungsergebnissen der klassischen arturischen Werke genommen werden. Neben der reinen Darstellung der neuen Merkmale der nachklassischen Artusepik sollen diese natürlich auch hinsichtlich ihrer Funktion untersucht werden. Des weiteren soll die Frage nach Grund und Intention für Strickers Abgrenzung von der Gattungstradition der klassischen Artusepik beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der klassische Artusroman
- Die nachklassische Artusepik und die Herausbildung eigener Formen
- Daniel von dem blühenden Tal
- Der Autor und sein Werk
- Episoden-Untersuchung des Daniels
- König Artus und der Artushof
- Minne und Darstellung der Frau
- Daniel als listiger und kluger Superheld
- Intertextuelle Bezüge im Daniel
- Intertextuelle Bezüge zwischen dem Daniel und dem Rolandslied bzw. dem Karl
- Intertextuelle Bezüge zwischen dem Daniel und dem Iwein
- Garel von dem blühenden Tal
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Strickers Daniel von dem blühenden Tal und untersucht, wie sich die deutsche Artusepik im Vergleich zu klassischen Werken wie Hartmanns von Aue Iwein und Wolframs von Eschenbach Parzival verändert hat. Insbesondere wird der Wandel des Heldenbildes beleuchtet, der durch den Wegfall des traditionellen „doppelten Kursus“ geprägt ist.
- Analyse des Wandels der deutschen Artusepik im Kontext von Strickers Daniel von dem blühenden Tal
- Untersuchung des veränderten Heldenbildes in der nachklassischen Artusepik
- Bedeutung des „doppelten Kursus“ und seine Abwesenheit in Daniel von dem blühenden Tal
- Analyse der Funktion und Bedeutung von „Aventüren“ in der nachklassischen Artusepik
- Bedeutung von intertextuellen Bezügen im Daniel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der nachklassischen Artusepik ein und hebt die zentralen Unterschiede zu klassischen Werken wie Iwein und Parzival hervor. Sie stellt Daniel von dem blühenden Tal als Beispiel für die veränderte Heldenfigur und die neuen Erzählformen vor.
Der klassische Artusroman: Dieses Kapitel beschreibt die klassischen Merkmale des Artusromans, insbesondere das Prinzip des „doppelten Kursus“, das die Gliederung des Werkes in zwei Teile mit Krise und Fall des Protagonisten beinhaltet. Das Kapitel beleuchtet die Funktionen von „Aventüren“ im klassischen Artusroman, ihre Verbindung zu heroischer Selbstfindung und die Bedeutung der höfischen Ordnung.
Die nachklassische Artusepik und die Herausbildung eigener Formen: Dieses Kapitel analysiert die Veränderungen in der nachklassischen Artusepik, insbesondere den Wegfall des „doppelten Kursus“ und die daraus resultierenden Folgen für das Heldenbild. Es untersucht die Rolle der „Aventüren“ in der nachklassischen Artusepik, die zunehmend phantastischer und handlungstragend werden.
Daniel von dem blühenden Tal: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Werk Daniel von dem blühenden Tal und untersucht die spezifischen Merkmale des Werkes im Kontext der nachklassischen Artusepik. Es beleuchtet die Rolle des Helden Daniel, seine „Aventüren“ und die intertextuellen Bezüge zu anderen Werken.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieses Textes umfassen die nachklassische Artusepik, Daniel von dem blühenden Tal, Strickers Werk, Heldenbild, doppelter Kursus, Aventüren, Intertextualität, phantastische Motive und die Veränderung der literarischen Gattung. Der Text beleuchtet die Entwicklung der deutschen Artusepik und ihre Besonderheiten im Kontext der klassischen Werke.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet Strickers "Daniel von dem blühenden Tal" von klassischen Artusromanen?
Strickers Werk bricht mit dem traditionellen "doppelten Kursus" der klassischen Artusepik und präsentiert einen Helden, der eher durch List und Klugheit als durch eine moralische Krise zum Erfolg gelangt.
Was bedeutet der Begriff "doppelter Kursus" in der Artusepik?
Der doppelte Kursus beschreibt die Struktur klassischer Romane (wie Iwein), in denen der Held nach einem ersten Erfolg eine Krise durchläuft und sich in einem zweiten Teil moralisch bewähren muss.
Wie wird die Figur des Daniel in Strickers Werk charakterisiert?
Daniel wird als "listiger und kluger Superheld" dargestellt, dessen Handeln weniger von ritterlicher Selbstfindung als von strategischer Problemlösung geprägt ist.
Welche Rolle spielen intertextuelle Bezüge im Daniel?
Das Werk nimmt Bezug auf andere Epen wie das Rolandslied, den Karl oder Hartmanns Iwein, um sich bewusst von der Gattungstradition abzugrenzen oder diese zu parodieren.
Wie verändern sich die "Aventüren" in der nachklassischen Epik?
In der nachklassischen Artusepik werden Aventüren phantastischer und dienen primär als handlungstragende Elemente statt der inneren Entwicklung des Helden.
- Quote paper
- Lilli Heming (Author), 2011, Strickers "Daniel von dem blühenden Tal" als ein Werk der nachklassischen Artusepik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197117