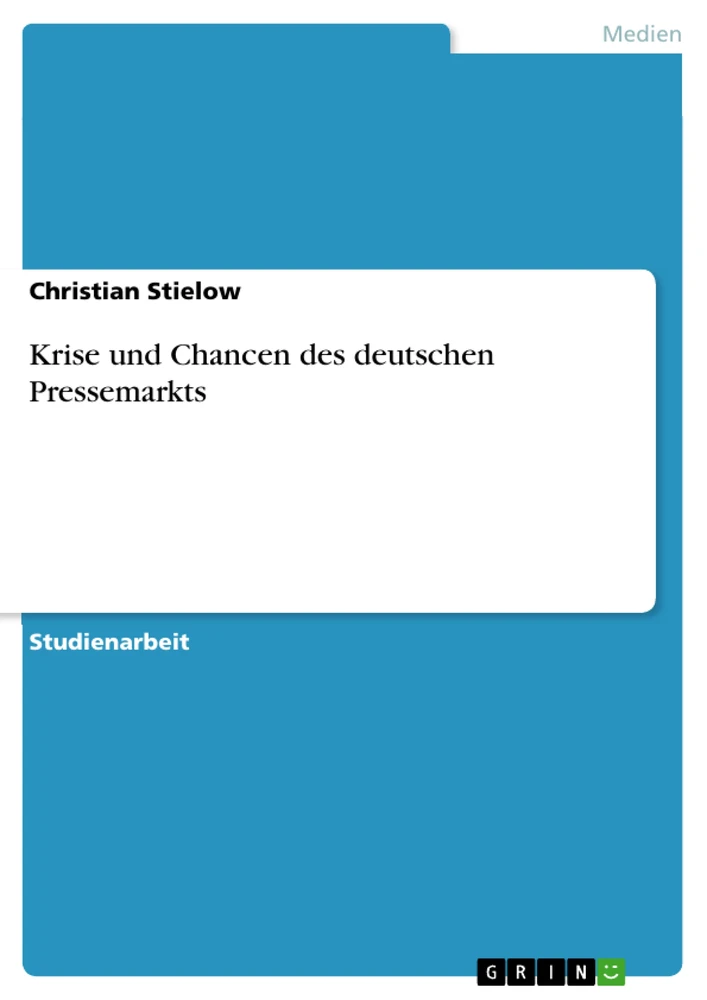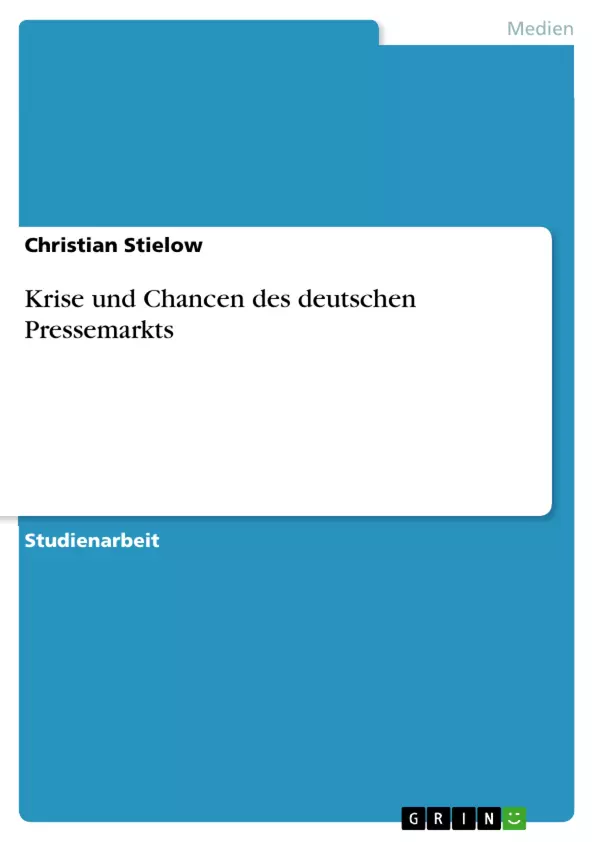„Das Jahr 2000 wird das Ende der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger einläuten.“ So wie es Bill Gates 1998 auf dem Wirtschaftsgipfel in Davos prognostizierte, ist es nicht gekommen. Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass der deutsche Zeitungsmarkt in einer schweren Krise steckt. Dies verdeutlichen die Zahlen zur Entwicklung der Tagespresse zwischen 1995 und 2010. Der Verkauf von Tageszeitungen sank in diesem Zeitraum von über 30 Millionen Exemplaren auf 22,7 Millionen Exemplare. Das entspricht einem Verlust von 24,5%. Besonders dramatisch verhält es sich bei den Kaufzeitungen (hierunter fällt z.B. der Verkauf in Kiosken), die einen Verlust von 33,6% im gemessenen Zeitraum verbuchten. Worin die Ursachen dieser Krise liegen, werde ich im ersten Teil meiner Arbeit darlegen.
Ich beschäftige mich hierbei zuerst mit dem Einbrechen der Anzeigenerlöse und Werbeeinnahmen. Anschließend erläutere ich die Folgen für die Tagespresse durch das veränderte Mediennutzungsverhalten der Rezipienten und nenne weitere gesellschaftliche Veränderungen, die sich negativ für das Zeitungswesen auswirken. Dabei gehe ich auch auf die Frage ein, ob es sich um eine konjunkturelle oder strukturelle Krise handelt.
Im zweiten Teil meiner Arbeit widme ich mich den Maßnahmen, mit denen die Zeitungsverlage versuchen, den Negativtrend der Tagespresse abzuwenden. Ich erörtere die Frage, ob sich die gedruckte Zeitung durch Pressekonzentration, staatliche Unterstützung oder den Verkauf verlagsnaher bzw. verlagsferner Zusatzprodukte auf dem Markt halten kann und was für Perspektiven das Internet bietet. Im Gegensatz zum ersten Teil gehe ich hier auf konkrete Beispiele anhand ausgewählter Tageszeitungen ein.
Mein Augenmerk liegt dabei auf dem deutschen Pressemarkt. Ein Vergleich, etwa mit den USA, in denen das „Zeitungssterben“ bereits deutlich weiter vorangeschritten ist als bei uns, oder mit Frankreich, wo der Staat erheblich mehr eingreift, wäre das mögliche Thema einer anknüpfenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einbruch der Anzeigenerlöse
- Verändertes Mediennutzungsverhalten der Rezipienten
- Gesellschaftliche Veränderungen
- Pressekonzentration und Presseförderung
- Verlagsnahe und verlagsferne Zusatzprodukte
- Die Online-Zeitung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Krise des deutschen Pressemarktes, untersucht die Ursachen für den Rückgang der Anzeigenerlöse und den veränderten Medienkonsum der Rezipienten und beleuchtet die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich auf den Zeitungsmarkt auswirken.
- Einbruch der Anzeigenerlöse durch das Internet als Konkurrent
- Verändertes Mediennutzungsverhalten der Rezipienten zugunsten des Internets
- Gesellschaftliche Veränderungen wie demografischer Wandel und Individualisierung von Werten
- Maßnahmen der Zeitungsverlage zur Abwendung des Negativtrends
- Die Rolle der Pressekonzentration und der staatlichen Unterstützung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Krise des deutschen Pressemarktes dar und beschreibt den Rückgang der Verkaufszahlen von Tageszeitungen. Die Ursachen für diese Krise werden in den folgenden Kapiteln genauer beleuchtet.
- Einbruch der Anzeigenerlöse: Dieses Kapitel analysiert den Rückgang der Werbeeinnahmen für Tageszeitungen, wobei insbesondere das Internet als Konkurrent hervorgehoben wird. Der Autor diskutiert die Gründe, warum Inserenten zunehmend das Internet für ihre Werbung bevorzugen und wie sich dieser Trend auf die Tagespresse auswirkt.
- Verändertes Mediennutzungsverhalten der Rezipienten: Das Kapitel untersucht, wie sich das veränderte Mediennutzungsverhalten der Rezipienten auf den Konsum von Tageszeitungen auswirkt. Der Autor analysiert den wachsenden Einfluss des Internets und die Gründe, warum Rezipienten zunehmend online Informationen beziehen.
- Gesellschaftliche Veränderungen: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen Veränderungen, die sich negativ auf den Zeitungsmarkt auswirken. Der Autor beschreibt den demografischen Wandel, die abnehmende Titeltreue und die steigende Mobilität der Gesellschaft.
- Pressekonzentration und Presseförderung: Das Kapitel untersucht Maßnahmen, die Zeitungsverlage ergreifen, um den Negativtrend abzuwenden. Der Autor diskutiert die Rolle der Pressekonzentration und der staatlichen Unterstützung, sowie die Chancen und Herausforderungen, die das Internet für die Tagespresse bietet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themengebiete des Textes sind: Krise des deutschen Pressemarktes, Einbruch der Anzeigenerlöse, Mediennutzungsverhalten, Internet als Konkurrent, gesellschaftliche Veränderungen, Pressekonzentration, Presseförderung, Online-Zeitung, Digitalisierung.
- Quote paper
- Christian Stielow (Author), 2012, Krise und Chancen des deutschen Pressemarkts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197171