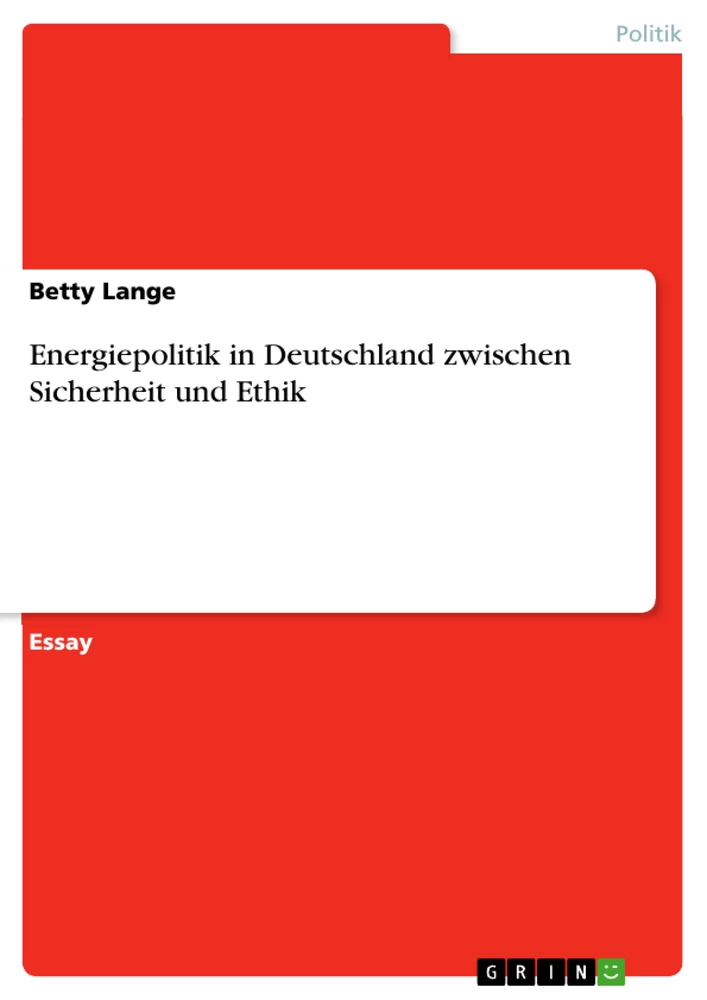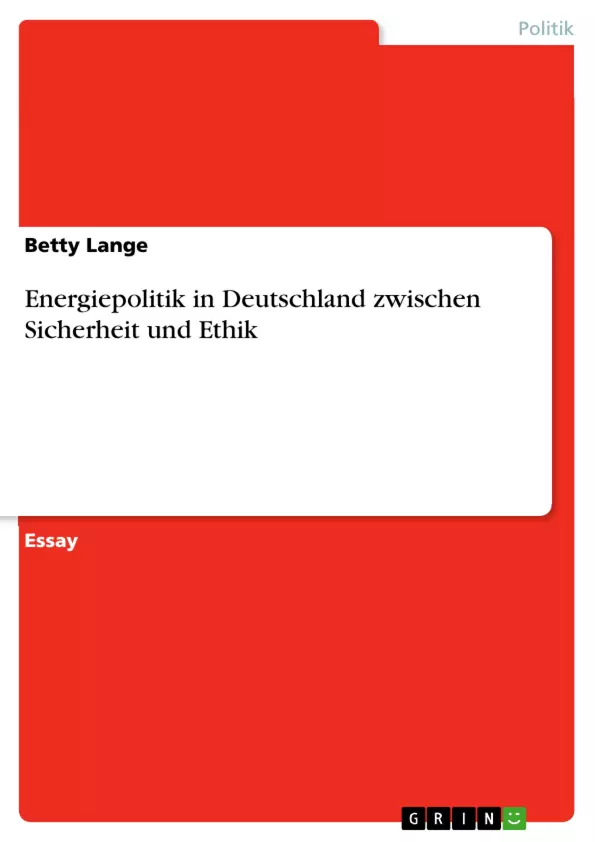Nach der Atomkatastrophe in Japan werden Sicherheit und Risiken der
Atomenergie und die Energiepolitik in Deutschland mehr diskutiert denn je.
Sicherlich ist die Gefahr eines Tsunami, wie in Japan, der weite Teile des
Landes verwüstet und auch die Kernkraftwerke stark beschädigt hat, in
Deutschland vernachlässigbar. Doch Kernkraftwerke sind an sich nie ohne
Gefahr, wie die Unfälle der Vergangenheit zeigen. Der Super GAU in der
Ukraine im April 1986 in Tschernobyl ist Jedem noch in Erinnerung. Bei der
Simulation eines Stromausfalls wurden gravierende Fehler gemacht,
wodurch schließlich der Reaktor explodierte und Radioaktivität bis in die
Atmosphäre freigesetzt wurde. Tausende Menschen starben an den
Spätfolgen, 120 000 mussten umgesiedelt werden und Wolken und Wind
transportierten die Radioaktivität bis nach Westeuropa. Der schwerste
Atomunfall der USA ereignete sich nur sieben Jahre zuvor in Harrisburg,
Pennsylvania. Im März 1979 kam es zur Kernschmelze infolge von einer
Kombination aus Fehlbedienung und Fehlfunktion des Kühlsystems. Die
radioaktive Wolke zwang im Umkreis von mehreren hundert Kilometern
über 200 000 Menschen ihre Häuser zu verlassen. Auch in Großbritannien
kam es 1957 zu einem folgenschweren Unfall. Ein Feuer beschädigte einen
Reaktor zur Herstellung von Plutonium für Bomben. Ein Gebiet von
mehreren hundert Quadratkilometern wurde verseucht und mindestens 39
Menschen starben an den Folgen. Über ganz Europa verteilte sich eine
radioaktive Wolke. Bereits einen Monat zuvor, im September 1957,
explodierte im sowjetischen Majek in einer Plutoniumfabrik ein
unterirdischer Tank mit flüssigen radioaktiven Abfällen. Es gab mindestens
1 000 Tote und 10 000 Verstrahlte. Ein Gebiet von 300 Kilometern Länge
und 40 Kilometern Breite wurde verseucht, bis heute. [...]
Nach der Atomkatastrophe in Japan werden Sicherheit und Risiken der Atomenergie und die Energiepolitik in Deutschland mehr diskutiert denn je. Sicherlich ist die Gefahr eines Tsunami, wie in Japan, der weite Teile des Landes verwüstet und auch die Kernkraftwerke stark beschädigt hat, in Deutschland vernachlässigbar. Doch Kernkraftwerke sind an sich nie ohne Gefahr, wie die Unfälle der Vergangenheit zeigen. Der Super GAU in der Ukraine im April 1986 in Tschernobyl ist Jedem noch in Erinnerung. Bei der Simulation eines Stromausfalls wurden gravierende Fehler gemacht, wodurch schließlich der Reaktor explodierte und Radioaktivität bis in die Atmosphäre freigesetzt wurde. Tausende Menschen starben an den Spätfolgen, 120 000 mussten umgesiedelt werden und Wolken und Wind transportierten die Radioaktivität bis nach Westeuropa. Der schwerste Atomunfall der USA ereignete sich nur sieben Jahre zuvor in Harrisburg, Pennsylvania. Im März 1979 kam es zur Kernschmelze infolge von einer Kombination aus Fehlbedienung und Fehlfunktion des Kühlsystems. Die radioaktive Wolke zwang im Umkreis von mehreren hundert Kilometern über 200 000 Menschen ihre Häuser zu verlassen. Auch in Großbritannien kam es 1957 zu einem folgenschweren Unfall. Ein Feuer beschädigte einen Reaktor zur Herstellung von Plutonium für Bomben. Ein Gebiet von mehreren hundert Quadratkilometern wurde verseucht und mindestens 39 Menschen starben an den Folgen. Über ganz Europa verteilte sich eine radioaktive Wolke. Bereits einen Monat zuvor, im September 1957, explodierte im sowjetischen Majek in einer Plutoniumfabrik ein unterirdischer Tank mit flüssigen radioaktiven Abfällen. Es gab mindestens 1 000 Tote und 10 000 Verstrahlte. Ein Gebiet von 300 Kilometern Länge und 40 Kilometern Breite wurde verseucht, bis heute. Genauere Zahlen fehlen hier, da das Unglück vertuscht und erstmals 1976 bekannt wurde. Offiziell bestätig wurde es erst 1990. Unfälle ereigneten sich aber nicht nur im Anfangsstadium der Energiegewinnung im großen industriellen Stil mittels Kernkraftwerken. Im September 1999 trat in Tokaimura in Japan stark radioaktive Strahlung bei der unvorschriftsmäßigen Befüllung eines Vorbereitungstanks in einem Brennelementewerk aus. Fast 100 Störfälle werden in sechs Jahren bis August 2006 in dem tschechischen Atomkraftwerk Temelin protokolliert. Von den Risiken der Atomkraft sind wir in Deutschland aber nicht nur mittelbar durch unsere Nachbarländer betroffen. Kurzschlüsse in zwei Hochspannungsleitungen führten im Januar 1977 im deutschen Atomkraftwerk Gundremmingen in Bayern zu einem Totalschaden. Das Reaktorgebäude wurde mit radioaktivem Kühlwasser verseucht. Im Dezember 2001 verursachte eine Wasserstoffexplosion im Atomkraftwerk Brunsbüttel einen Störfall. Der Reaktor wurde aber erst auf Drängen der Kontrollbehörden im Februar 2002 für eine Inspektion vom Netz genommen. Der Reaktor Krümmel in Schleswig Holstein musste im Juli 2009 nach einem Kurzschluss im Maschinentransformator per Schnellabschaltung vom Netz genommen werden. Bereits im Juni 2007 war ein baugleicher Transformator nach einem Kurzschluss in Brand geraten. Bei dieser Häufigkeit von Störfällen und Unfällen scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich der nächste Unfall ereignet und auch Deutschland betrifft. Was macht aber die Atomkraftwerke so gefährlich? Zunächst einmal die Atomenergie selbst. Der für die Energiegewinnung notwendige Rohstoff ist Uran und notwendig um den eigentlichen „Brennstoff“ für Atomkraftwerke herzustellen. Bereits der Uranabbau verwüstet ganze Landstriche und belastet Arbeiter wie Umwelt durch Stäube, Ablüfte und Abwässer. Dabei enthält Natururan noch nicht einmal ein Prozent spaltbares Uran-235, für den Einsatz zur Energiegewinnung im Atomkraftwerk muss dieser Anteil durch Anreicherung auf drei bis fünf Prozent erhöht werden. Diese hoch angereicherten Brennstoffe strahlen nach ihrer Halbwertszeit von über 700 Millionen Jahren immer noch mit der halben Intensität. Dadurch ist allein die Förderung und Anreicherung von Uran ein immenses Risiko, weil dadurch die sichere Lagerung des Stoffes notwendig wird und dafür für so einen langen Zeitraum weder ein passender Lagerungsbehälter noch eine Lagerungsstätte irgendwo auf der Welt existiert, die auch nur annähernd längerfristige Sicherheit bieten kann. Hinzu kommen die Unmengen von giftigen und radioaktiven Abfallprodukten aus der Förderung, Anreicherung und aus den Kraftwerken, die zwar in der Regel selber weniger stark radioaktiv sind, dafür aber oftmals für die Lagerung chemisch schwer handhabbare Eigenschaften aufweisen. Sie sind sehr reaktiv mit Flüssigkeiten und Feuchtigkeit, außerdem auch oft gasförmig und stark flüchtig. Dazu darf trotz aller nationalen und internationalen Kontrollbehörden das Interesse der Energieunternehmen und der Unternehmen der Atomwirtschaft allgemein nicht unterschätzt werden. Das sind riesige Konzerne, die Milliarden erwirtschaften, indem sie Deutschland mit günstigem Strom aus alten abgeschriebenen Atomkraftwerken versorgen und dabei in erster Linie ihren Anteilseignern und Aktionären verpflichtet sind möglichst gewinnbringend zu wirtschaften. Sicherheit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit können nur dann von Bedeutung sein, wenn sie dem unternehmerischen Ziel zur Gewinnerwirtschaftung dienen. Vor diesem Hintergrund werden marode Kraftwerke immer weiter betrieben und Sicherheit zu einem sehr dehnbaren subjektiven Begriff. Aber was bedeutet eigentlich Sicherheit im Betrieb von Kernkraftwerken? Da es immer das berühmte Restrisiko geben wird, um das Alle wissen und das zu bestreiten nicht einmal die mächtige Atomlobby im Stande ist, kann Sicherheit im Zusammenhang mit Kernkraft wohl immer nur ein frommer Wunsch bleiben.
[...]
- Arbeit zitieren
- Betty Lange (Autor:in), 2012, Energiepolitik in Deutschland zwischen Sicherheit und Ethik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197175