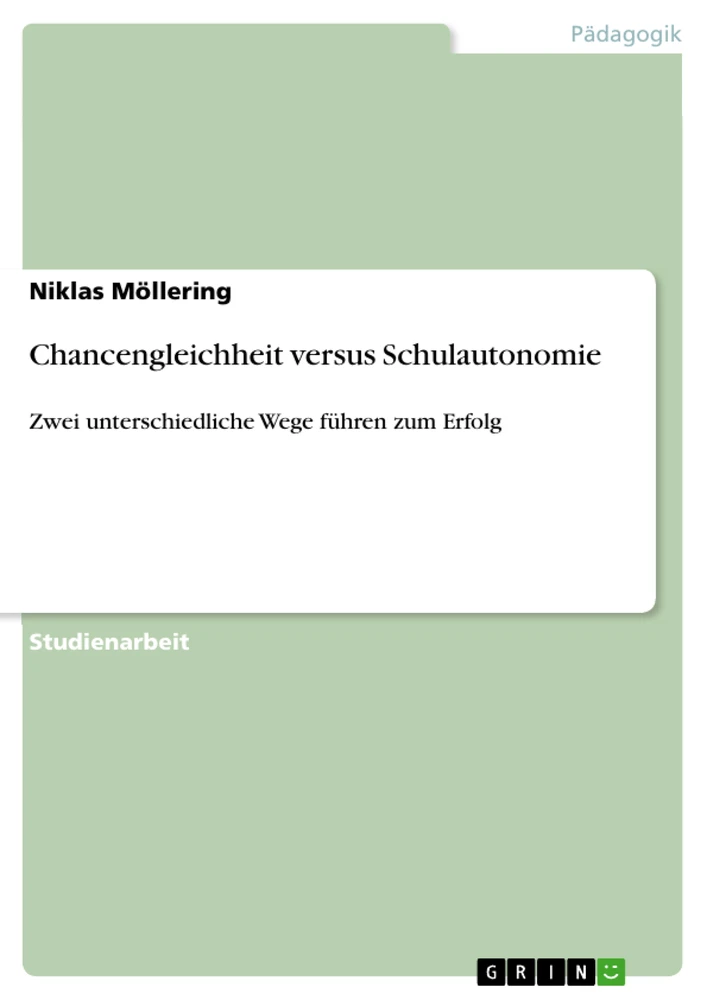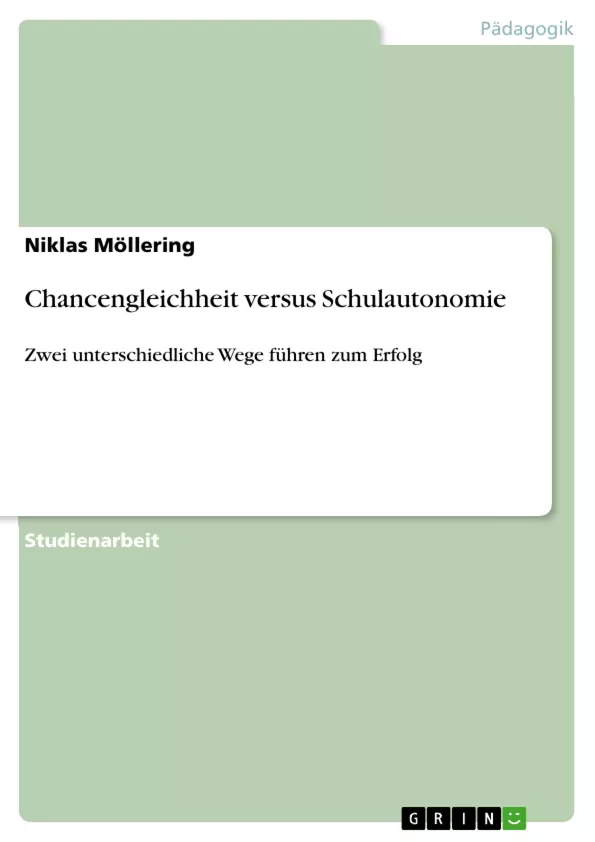Als Ende 2001 die ersten PISA-Ergebnisse veröffentlicht wurden, schockierte dies sowohl Bildungsforscher, Medien und Politiker: Deutschland lag mit Platz 22 nicht nur unter dem OECD-Durchschnitt sondern rangierte neben Ländern wie Mexiko oder Russland auf den hintersten Plätzen im Bildungsranking.Doch müssen jene Dezembertage im Jahr 2001 nicht zwingend als dunkelste Stunde der deutschen Bildungsforschung angesehen werden, da durch die detaillierte Studie erstmals vergleichende Aussagen zum Erfolg verschiedener Bildungssysteme getroffen werden konnten. Es wurde klar, in welchen Punkten es Nachholbedarf gab bzw. wie erfolgreich die Maßnahmen der anderen Vergleichsstaaten hinsichtlich der eigenen Probleme waren. Gerade in der Folgezeit wurde daher geschaut, inwieweit sich diese erfolgreichen Strategien in das deutsche Bildungssystem einflechten lassen. Viele dieser Innovationen, welche oftmals zwar nicht realisiert wurden, aber dennoch in der Diskussion standen, stammen aus den Niederlanden oder Finnland, deren Bildungssysteme den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ausmachen werden. Im ersten Kapitel richtet sich der Fokus primär auf die geschichtlichen Aspekte beider Bildungssysteme. Vor allem historisch gewachsenene Begebenheiten, Einstellungen oder Spezifika sollen auf diese Weise ihre Darstellung finden. Die Kapitel 2. und 3. befassen sich hingegen mit der heutigen Situation der Bildungssysteme und vergleichen diese. Vor allem die Organisation, Steuerung und Verwaltung der Bildungssysteme seitens der Regierung, sowie deren Ziele bei der Bildung als auch das Trägerschaftensystem beider Länder soll in diesem Kontext thematisiert und miteinander verglichen werden. Das folgende Kapitel geht auf ein weiteres wesentliches Gebiet innerhalb eines Bildungssystems ein: auf den Beruf des Lehrers. Im Vordergrund des Kapitels wird zwar der Ausbildungsverlauf der angehenden Lehrkraft stehen, doch sollen erstmals auch Probleme der Bildungssysteme durchleuchtet werden. Den Hauptteil dieser Arbeit macht jedoch das fünfte Kapitel aus, welches die Bildungsysteme miteinander vergleicht sowie jeweilige Vor- und Nachteile festhalten möchte. Im sechsten Kapitel geht es schließlich um die eingangs postulierte PISA-Studie. Ziel ist es, die bisher gewonnenen Erkenntnisse auf die PISA-Studie zu übertragen, um Gründe für das jeweilige gute Abschneiden auszumachen und notwendige Konsequenzen für das deutsche Bildungssystem abzuleiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenüberstellung - Vorstellung beider Länder
- Geschichtliche Aspekte der Schulsysteme
- Finnland auf dem Weg zur Chancengleichheit
- Der Schulstreit und seine Folgen - Geschichte des niederländischen Schulsystems
- Organisation, Steuerung und Verwaltung des niederländischen und finnischen Bildungssystems
- Trägerschaften
- Lehrerausbildung
- Finnische Lehrerausbildung
- Niederländische Lehrerausbildung
- Bildungssysteme im Vergleich
- Die vorschulische Erziehung
- Primarbereich
- Niederländische Basisschool
- Finnische Gemeinschaftsschule (Peruskoulu)
- Sekundarbereich
- Finnischer Sekundarbereich
- Berufliche Grundausbildung
- Gymnasiale Oberstufe
- Niederländischer Sekundarbereich
- VMBO
- HAVO
- VWO
- Sonderpädagogische Maßnahmen
- Integratives Bestreben des finnischen Förder- und sonderpädagogischen Unterrichts
- Strikte Trennung von Sonder- und Regelschulen? - Die Niederlande auf dem Weg zu einem integrativen Sonderschulkonzept?
- Die Ergebnisse der PISA-Studie – Versuch eines Vergleichs
- Probleme der Bildungssysteme
- Resümee: Chancengleichheit versus Schulautonomie. Zwei unterschiedliche Wege führen zum Erfolg
- Geschichtliche Entwicklung der beiden Bildungssysteme
- Organisation, Steuerung und Verwaltung der Bildungssysteme
- Lehrerausbildung in Finnland und den Niederlanden
- Vergleich der Bildungssysteme in den verschiedenen Bildungsstufen
- Die Rolle der PISA-Studie und ihre Relevanz für die beiden Länder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bildungssysteme Finnlands und der Niederlande, um zu verstehen, wie und warum sie im Vergleich zu anderen Ländern, insbesondere Deutschland, so erfolgreich sind. Im Vordergrund steht die Frage, inwieweit Chancengleichheit versus Schulautonomie zum Erfolg dieser beiden Bildungssysteme beiträgt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der PISA-Studie für die Bildungsforschung und stellt die beiden Fokusländer, Finnland und die Niederlande, vor. Im zweiten Kapitel werden die geschichtlichen Aspekte beider Bildungssysteme betrachtet. Hier werden die historischen Entwicklungen, Einstellungen und Spezifika der jeweiligen Systeme beleuchtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit der heutigen Organisation, Steuerung und Verwaltung der Bildungssysteme in Finnland und den Niederlanden, inklusive deren Ziele und Trägerschaftensysteme. Kapitel 4 untersucht die Lehrerausbildung in beiden Ländern, wobei auch Probleme der Bildungssysteme angesprochen werden. Kapitel 5 widmet sich einem detaillierten Vergleich der finnischen und niederländischen Bildungssysteme in allen wichtigen Bildungsstufen. Kapitel 6 analysiert die Ergebnisse der PISA-Studie und versucht, die Gründe für das gute Abschneiden der beiden Länder zu erklären.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Bildungssystemen Finnlands und der Niederlande, insbesondere mit den Themen Chancengleichheit und Schulautonomie. Weitere zentrale Themen sind die historische Entwicklung der Bildungssysteme, die Organisation und Verwaltung, die Lehrerausbildung, der Vergleich der Bildungsstufen sowie die Relevanz der PISA-Studie.
- Quote paper
- Niklas Möllering (Author), 2010, Chancengleichheit versus Schulautonomie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197221