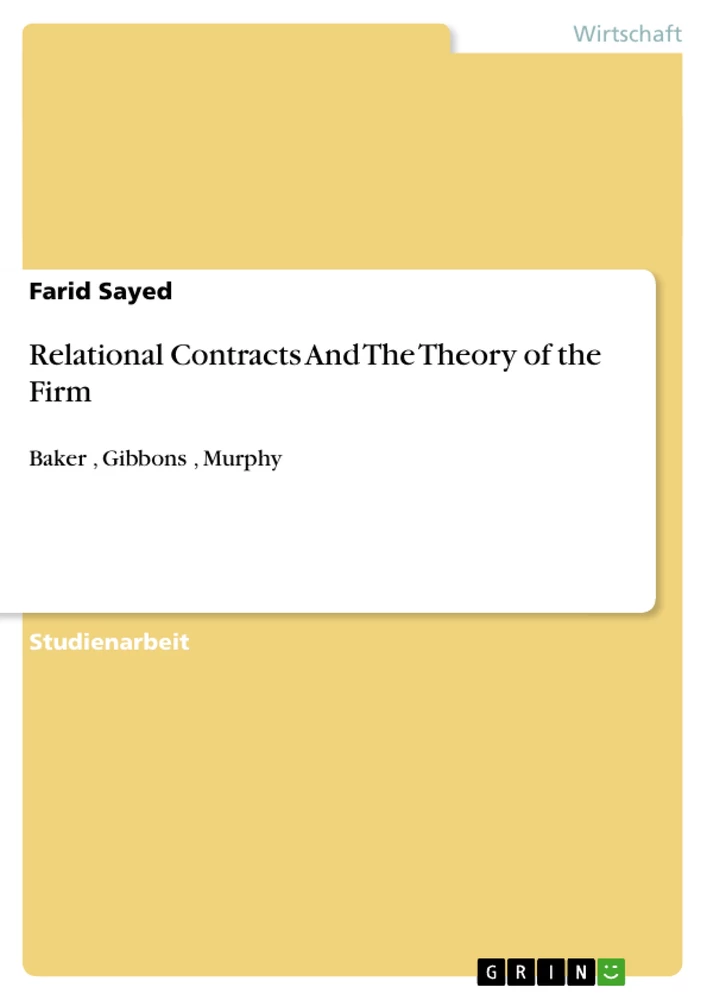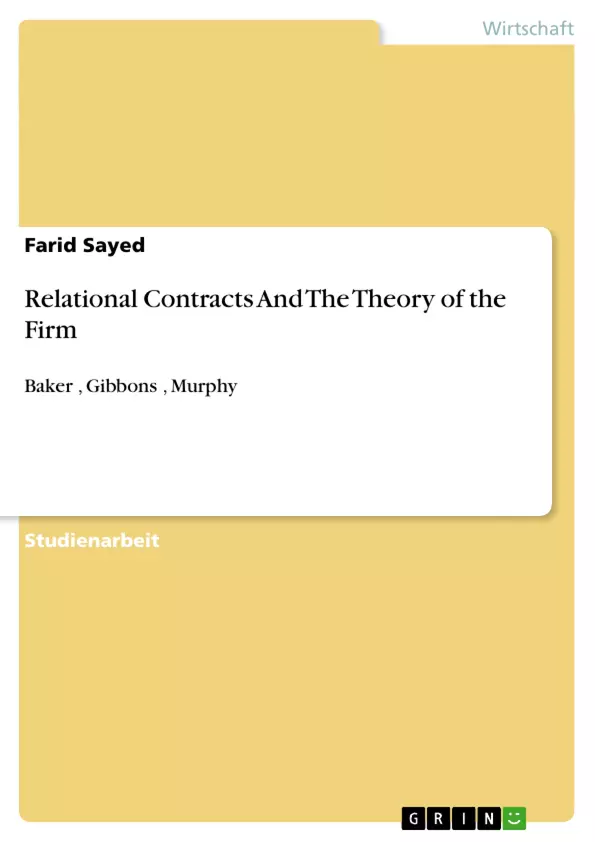Eine Zusammenfassungen und kurze Analyse basierend auf das Paper "Relational Contracs And The Theory Of The Firm" von Baker , Gibbons, Murphy.
Man befasst sich mit der Frage unter welchen Bedingungen Integration oder Outsourcing in Kombination mit relationalen Verträgen optimal ist.
z.B.
-Lässt eine Firma eine externe Steuerberaterkanzlei ihre Buchhaltung erledigen oder werden Fachpersonen in der Firma dafür angestellt ?
-Wann produziert eine Firma Güter im Ausland.
-Welche Vertragstypen sorgen für effizientes Arbeiten.
Diese Fragen und weitere kann man aus der Analyse ableiten.
Die allermeisten Korporationen befolgen i.d.R. diese Theorie.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Relationale Verträge
3. Das Modell .
3.1 Modelleinstellungen (Economic Environment)
3.2 Analyse der vier Organisationsstrukturen
3.2.1 Spot Outsourcing (SO)
3.2.2 Spot Employment (SE)
3.2.3 Relational Employment (RE)
3.2.4 Relational Outsourcing (RO)
3.3 Komparative Statik
4. Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb.1: Die Vier Governancestrukturen
Abb.2: Vertragstypen
Abb.3: Vier Organisationsstrukturen im Modell
Abb.4: Effiziente Organisationsform als Funktion von r und [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]p
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Kaum ein anderer Konzern ist in so viele Wirtschaftssparten diversifiziert, wie der japanische Unterhaltungskonzern Sony. In der Filmindustrie ist der Konzern mit seinem eigenständigen Filmstudio vertreten und betreibt so kostenloses Product Placement für die Elektronikartikel seines Mutterkonzerns. Ferner ist Sony insbesondere in der Videospieleindustrie (Playstation) , der Musikindustrie und der Unterhaltungselektronikindustrie (Fernseher, Tablets, Mobiltelefone etc.) stark vertreten.
Die unterschiedlichen und wirtschaftlich eigenständigen Tochtergesellschaften können jedoch nicht nur negative externe Effekte aufeinander ausüben. Aus dieser Überlegung heraus resultiert das Koordinationsproblem, „der Überwindung des Nichtwissens hinsichtlich dessen, was zu tun ist.“1 Dieser Problematik wird angegangen, indem durch Arbeitsteilung und Spezialisierung der effizienteste Output generiert wird. Weiterhin bleibt zu klären, ob die einzelnen Akteure innerhalb einer Organisation die an sie gerichteten Aufgaben auch mit der notwendigen Arbeitsanstrengung bewerkstelligen. Diesen Motivationsproblemen, die von Picot et al. als die „Überwindung des Nichtwollens“,1 bezeichnet werden, soll durch Anreizmechanismen entgegengewirkt werden. Letztere werden von Baker, Gibbons und Murphy in ihrem Modell im Paper: „Relational Contracts and The Theory Of The Firm“ wieder aufgegriffen. Es werden vier Governancestrukturen analysiert und untersucht, unter welchen Umständen relationale Verträge einen höheren Überschuss erzeugen als Spot-Verträge, sowohl in Bezug auf vertikaler Integration als auch unter Nicht-Integration.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1 : Die Vier Governancestrukturen Quelle : Bannier, C. (2005), S.193
2. Relationale Verträge
Zentraler Aspekt in der Betrachtung der vier unterschiedlichen Governancestrukturen ist der Begriff des relationalen Vertrags. Ein relationaler Vertrag ist ein unvollständiger Vertrag, der auf eine langfristige Beziehung der Vertragsparteien ausgelegt ist, z.B. Kooperationen zwischen Unternehmen oder ein unbefristeter Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.2 Obwohl bei dieser Form von Verträgen die Gefahr von Hold-Up besteht, bilden Sie in der Praxis die häufigste Form von Kontrakten. Durch die wirtschaftspolitische
Maßnahme der Zeitarbeit z.B. wurde den Unternehmen die Möglichkeit der Flexibilisierung gegeben, die nun von vielen Unternehmen zur Imitierung von Spotkontrakten genutzt wird. So findet unverkennbar eine Tendenz weg von relationalen Kontrakten hin zu kurzfristigen Verträgen in der Praxis statt.3 Spotverträge hingegen sind kurzfristige Verträge, die durch Dritte z.B. Gerichte durchgesetzt werden.2 Meinungsverschiedenheiten zweier Parteien bei einem Kaufvertrag werden i.d.R. durch die Auslegung des Bürgerlichen Gesetzbuches und des Handelsgesetzbuches in Deutschland geklärt. Abbildung 2 veranschaulicht die unterschiedlichen Vertragstypen wobei die neoklassische Variante im Modell keine Beachtung findet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2: Vertragstypen
Quelle : Picot et al. (2002) , S.19
3. Das Modell
Baker et al. gehen in ihrem Modell der Frage nach ob und unter welchen Umständen relationale Verträge selbstdurchsetzend sind, d.h. ob keine der Vertragsparteien einen Anreiz hat vom relationalen Kontrakt abzuweichen, im Falle von integrierten als auch nicht-integrierten Organisationsstrukturen. Formal wird dies in Form eines unendlich wiederholten Spiels dargestellt.4
3.1 Modelleinstellungen (Economic Environment)
Baker et al. unterscheiden zwei Vertragsparteien. Einen Downstream (D) als Auftraggeber und einen Upstream (U) als Hersteller. Der Upstream produziert ein Gut und verkauft dieses an den Downstream, der das Gut für seinen Produktionsprozess weiterverwenden kann. Für die Produktion des Gutes wird ein Asset benötigt. Verfügt nun der Downstream über die Eigentumsrechte am Asset, so spricht man von Integration. In dem Fall ist der Upstream ein Arbeitnehmer. Liegt das Eigentum am Asset jedoch beim Upstream so spricht man von Outsourcing - der Upstream ist ein unabhängiger Unternehmer.5 Daraus lassen sich folgende vier Organisationsformen abbilden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.3: Vier Organisationstrukturen im Modell
Quelle : Baker et al. (2002) , S.46
Das erzeugte Gut hat für den Downstream einen spezifischen Wert Q in jeweils zwei Ausprägungen[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]das von der Wahrscheinlichkeit[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] abhängt mit [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] sowie einen alternativen Marktwert P, ebenfalls in unterschiedlicher Qualität,[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] und Wahrscheinlichkeit[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] abhängt. Somit hängt der Wert des erzeugten Gutes maßgeblich vom Anstrengungsvektor[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] des Herstellers ab.
[...]
1 Picot et al. (2002), S.8
2 Picot et al. (2002), S.19
3 Vgl. http://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/arbeit-immer-mehr- zeitarbeit_aid_647177.html (02.03.2012)
4 Vgl. Bannier, C. (2005) , S.193
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die ein Inhaltsverzeichnis, ein Abbildungsverzeichnis, ein Abkürzungsverzeichnis, eine Einleitung, eine Diskussion über relationale Verträge, ein Modell zur Analyse von Organisationsstrukturen (Spot Outsourcing, Spot Employment, Relational Employment, Relational Outsourcing), eine komparative Statik und ein Fazit sowie ein Literaturverzeichnis enthält.
Was sind relationale Verträge?
<Relationale Verträge werden als unvollständige Verträge beschrieben, die auf langfristige Beziehungen zwischen Vertragsparteien ausgerichtet sind.
Was sind die vier Organisationsstrukturen, die im Modell analysiert werden?
Die vier Organisationsstrukturen sind Spot Outsourcing (SO), Spot Employment (SE), Relational Employment (RE) und Relational Outsourcing (RO).
Was wird in der Einleitung diskutiert?
Die Einleitung diskutiert die Diversifizierung von Konzernen am Beispiel von Sony und thematisiert Koordinations- und Motivationsprobleme in Unternehmen. Sie verweist auf das Modell von Baker, Gibbons und Murphy über relationale Verträge und die Theorie des Unternehmens.
Was sind Spot-Verträge im Gegensatz zu relationalen Verträgen?
Spot-Verträge sind kurzfristige Verträge, die in der Regel durch Dritte (z.B. Gerichte) durchgesetzt werden, im Gegensatz zu relationalen Verträgen, die langfristige Beziehungen implizieren.
Was wird im Abschnitt "Das Modell" betrachtet?
Im Abschnitt "Das Modell" wird untersucht, ob und unter welchen Bedingungen relationale Verträge selbstdurchsetzend sind, sowohl in integrierten als auch in nicht-integrierten Organisationsstrukturen, dargestellt als ein unendlich wiederholtes Spiel.
Was ist der Zweck des Modells von Baker et al.?
Das Modell von Baker et al. dient dazu, zu analysieren, unter welchen Umständen relationale Verträge einen höheren Überschuss erzeugen als Spot-Verträge, sowohl in Bezug auf vertikale Integration als auch unter Nicht-Integration.
Was bedeuten die Abkürzungen SO, SE, RE und RO im Kontext des Modells?
SO steht für Spot Outsourcing, SE für Spot Employment, RE für Relational Employment und RO für Relational Outsourcing.
Was sind die Hauptaspekte des Economic Environment im Modell?
Das Economic Environment im Modell beinhaltet zwei Vertragsparteien (Downstream und Upstream), die Produktion eines Gutes, die Eigentumsrechte an einem Asset und die resultierenden Organisationsformen (Integration vs. Outsourcing). Der Wert des erzeugten Gutes hängt vom Anstrengungsvektor des Herstellers ab.
- Citar trabajo
- Farid Sayed (Autor), 2012, Relational Contracts And The Theory of the Firm, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197251