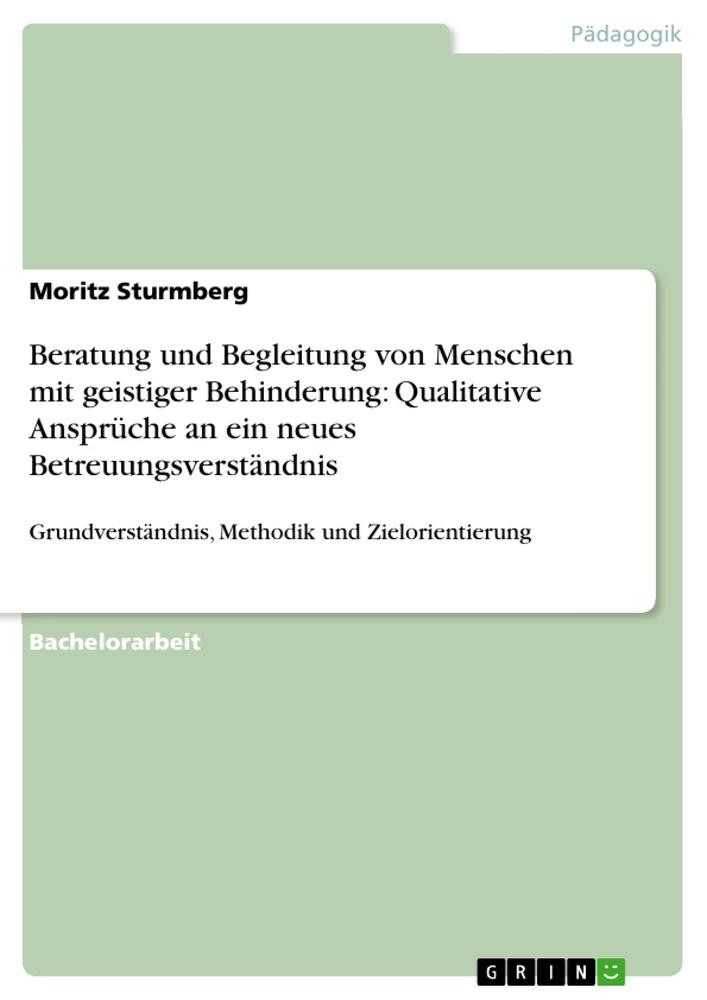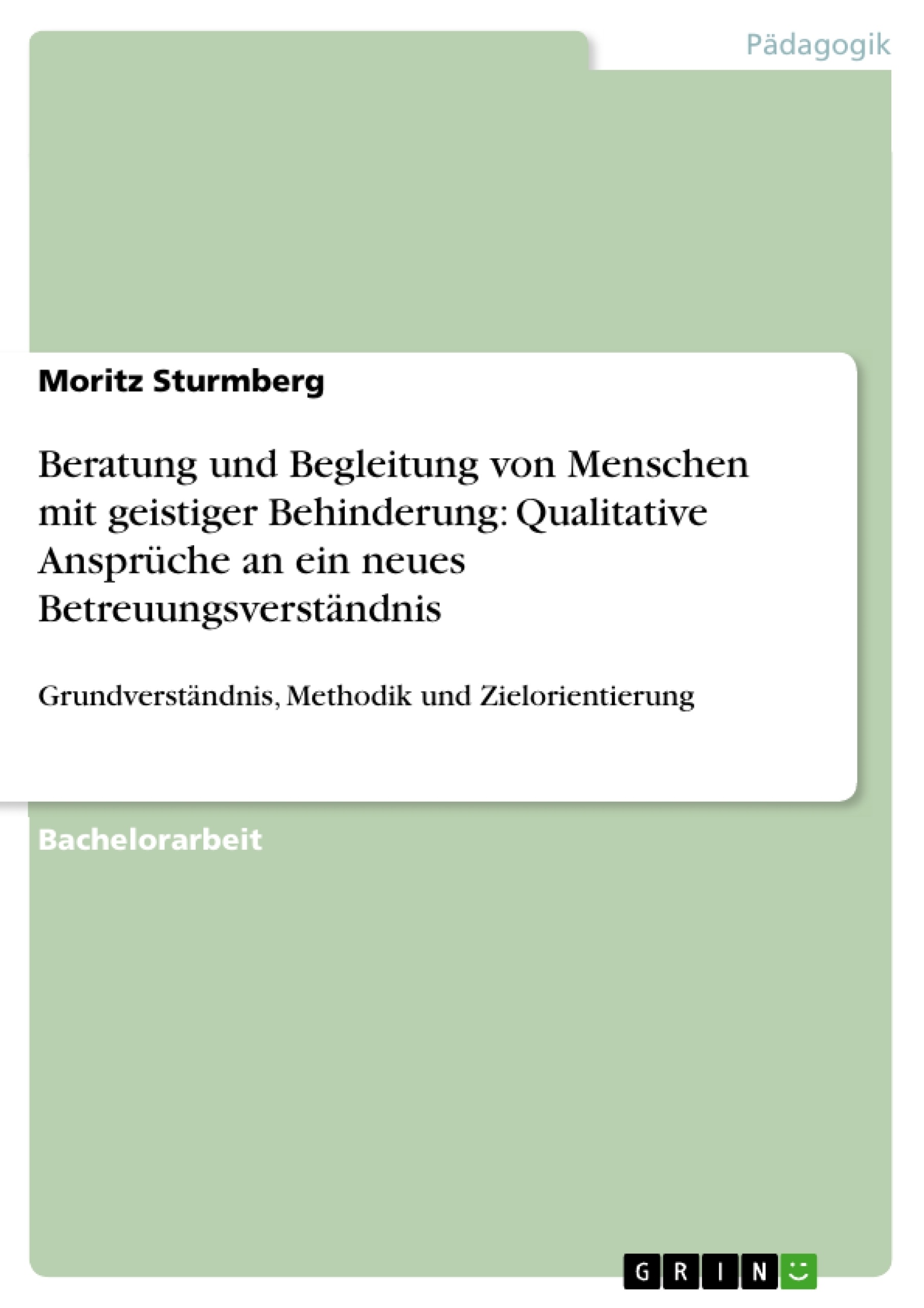1 Einführung
Seit Beginn der 1990er Jahre und mit dem einschneidenden Impuls des Lebenshilfe Kongresses 1994 in Duisburg (Ich weiß doch selbst, was ich will! Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung) ist die Forderung nach mehr Selbstbestimmung und Teilhabe für Menschen mit Behinderung in Deutschland zu einem zentralen Anliegen für die Organisation von Hilfen und die Vorstellung von professioneller Unterstützung im Alltag geworden. Lange wurden Menschen mit Behinderung als passive Empfänger von Hilfsmaßnahmen gesehen. Zunehmend werden sie jedoch als Ratsuchende, als eigenständige und entscheidungsfähige Zielgruppe wahrgenommen.
Mit dem Anspruch einer Hilfe zur Selbsthilfe wird der eher neuartige pädagogische Optimismus einer ressourcen- und kompetenzorientierten Sichtweise auf Menschen mit geistiger Behinderung fokussiert (...). Die Begriffe des „Förderns“ oder „Betreuens“ suggerieren im Kontext von Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und Teilhabe mittlerweile schnell ein Bild streng asymmetrischer Beziehungs- und Interaktionskonstellationen, den Gedanken des „Formens“ nach persönlichen und gesamtgesellschaftlichen Normen und Werten sowie den Anspruch des Behütens und Bewahrens vor der Gesellschaft und eigenen Fehlleistungen.
Als Abgrenzung und Neuorientierung gegenüber den bisher gängigen Begriffsbezeichnungen bedient sich aktuellere Literatur in diesem Bewusstsein vermehrt der Begriffe „Begleiter“, „Assistent“ oder „Berater“. Ziel ist es dabei auch, Menschen mit geistiger Behinderung wieder als Subjekt von Interaktionen zu positionieren, anstatt sie durch eine Überhandnahme pädagogischer Konzepte zu objektivieren(...). Unter Bezugnahme auf ein in der Praxis etabliertes Beratungsverständnis, die Rahmenbedingungen professioneller Grundhaltung in der Behindertenhilfe und anhand einer Auseinandersetzung mit beobachtbaren Dilemmata eines Betreuer – Bewohner – Verhältnisses, soll in der vorliegenden Arbeit schließlich der Versuch unternommen werden, den Begriff Beratung hinsichtlich einer Vorstellung von Lebensberatung auszuweiten, was voraussetzt, dass hierbei neben ideologischen und methodischen beraterischen Kompetenzen des Begleiters auch die Kompetenzen gehören, fachübergreifend und nahraumorientiert zu kooperieren sowie Wege zu mehr Selbstbestimmungsrecht und Teilhabe zu organisieren und zu ermöglichen (...).
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Verortung professioneller Beratung als pädagogisches Leitbild
- Beratung als sozialpädagogischer Handlungstyp
- Grundüberlegungen des klientenzentrierten Ansatzes nach Rogers
- Kooperative Beratung nach Mutzeck
- Kontext und Rahmenbedingungen des Beratungsbegriffs in der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung
- Paradigmenwechsel
- Empowerment und Selbstbestimmung
- Das Normalisierungsprinzip
- Der Inklusionsgedanke
- Exkurs: Spannungsfelder und Handlungsparadoxien alltäglicher Beratungsarbeit
- Faktoren einer Systematisierung und Ausweitung von Beratung und Begleitung
- Zur Implementierung neuer Perspektiven
- Das Assistenzkonzept
- Das Kundenmodell
- praktisch- methodische Konsequenzen
- Das WKS- Modell: Alltags- und Prozessbegleiter
- Das Beratungskonzept,,So und So“
- Zur Implementierung neuer Perspektiven
- Fazit
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, wie sich professionelle Beratung im Kontext der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung zu einem Lebensberatungskonzept entwickeln kann. Hierzu werden die etablierten Denk- und Handlungsmuster der Behindertenhilfe kritisch beleuchtet und neue Perspektiven im Sinne von Selbstbestimmung und Teilhabe aufgezeigt. Dabei wird insbesondere auf die Bedeutung von Beratungskompetenz in der alltäglichen Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung eingegangen.
- Die Entwicklung von professioneller Beratung in der Behindertenhilfe
- Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung
- Das Lebensberatungskonzept als pädagogisches Leitbild
- Die Rolle von Beratungskompetenz in der Alltagsbegleitung
- Die Bedeutung von Empowerment und Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung des Verständnisses von Behinderung und die wachsende Bedeutung von Selbstbestimmung und Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung. Sie stellt den Anspruch auf eine ressourcen- und kompetenzorientierte Sichtweise auf Menschen mit geistiger Behinderung heraus und verdeutlicht die Abgrenzung des Begriffs „Beratung“ gegenüber traditionellen Begriffen wie „Fördern“ oder „Betreuen“.
Die Verortung professioneller Beratung als pädagogisches Leitbild
Dieses Kapitel analysiert die Rolle von Beratung als sozialpädagogischen Handlungstyp und stellt die Grundüberlegungen des klientenzentrierten Ansatzes nach Rogers sowie die kooperative Beratung nach Mutzeck vor. Es wird die Bedeutung von Beratung als eigenständige und als Querschnittsmethode für die Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung hervorgehoben.
Kontext und Rahmenbedingungen des Beratungsbegriffs in der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung
Dieses Kapitel beleuchtet den Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe hin zu Empowerment und Selbstbestimmung und diskutiert das Normalisierungsprinzip und den Inklusionsgedanken. Es geht außerdem auf Spannungsfelder und Handlungsparadoxien in der alltäglichen Beratungsarbeit ein.
Faktoren einer Systematisierung und Ausweitung von Beratung und Begleitung
Dieses Kapitel untersucht die Implementierung neuer Perspektiven, wie das Assistenzkonzept und das Kundenmodell, in der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung. Es werden auch praktische und methodische Konsequenzen, wie das WKS-Modell und das Beratungskonzept „So und So“, erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Lebensberatung, Selbstbestimmung, Teilhabe, Empowerment, Inklusion und professioneller Beratung in der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung. Sie setzt sich kritisch mit etablierten Denk- und Handlungsmustern der Behindertenhilfe auseinander und befasst sich mit neuen Perspektiven und Methoden, die auf die Bedürfnisse und Kompetenzen der Menschen mit geistiger Behinderung eingehen. Wichtige Konzepte in diesem Zusammenhang sind das Assistenzkonzept, das Kundenmodell, das WKS-Modell und das Beratungskonzept „So und So“.
Häufig gestellte Fragen
Welcher Paradigmenwechsel findet in der Behindertenhilfe statt?
Ein Wechsel von der Bevormundung ("Betreuen", "Fördern") hin zu mehr Selbstbestimmung, Teilhabe und Empowerment.
Was ist das Ziel des neuen Beratungsverständnisses?
Menschen mit geistiger Behinderung als Subjekte ihrer Interaktionen zu positionieren und sie als eigenständige Ratsuchende wahrzunehmen.
Welche Rolle spielt der klientenzentrierte Ansatz nach Rogers?
Er dient als pädagogisches Leitbild für eine professionelle Beratung, die den Ratsuchenden in den Mittelpunkt stellt.
Was versteht man unter dem Assistenzkonzept?
Es ist eine Form der Unterstützung, bei der der Mensch mit Behinderung selbst bestimmt, welche Hilfen er in Anspruch nimmt.
Was ist das WKS-Modell?
Es ist ein praktisch-methodisches Konzept für Alltags- und Prozessbegleiter in der Behindertenhilfe.
Was bedeutet Inklusion in diesem Kontext?
Inklusion bedeutet die volle und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen gesellschaftlichen Bereichen.
- Quote paper
- Moritz Sturmberg (Author), 2012, Beratung und Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung: Qualitative Ansprüche an ein neues Betreuungsverständnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197443