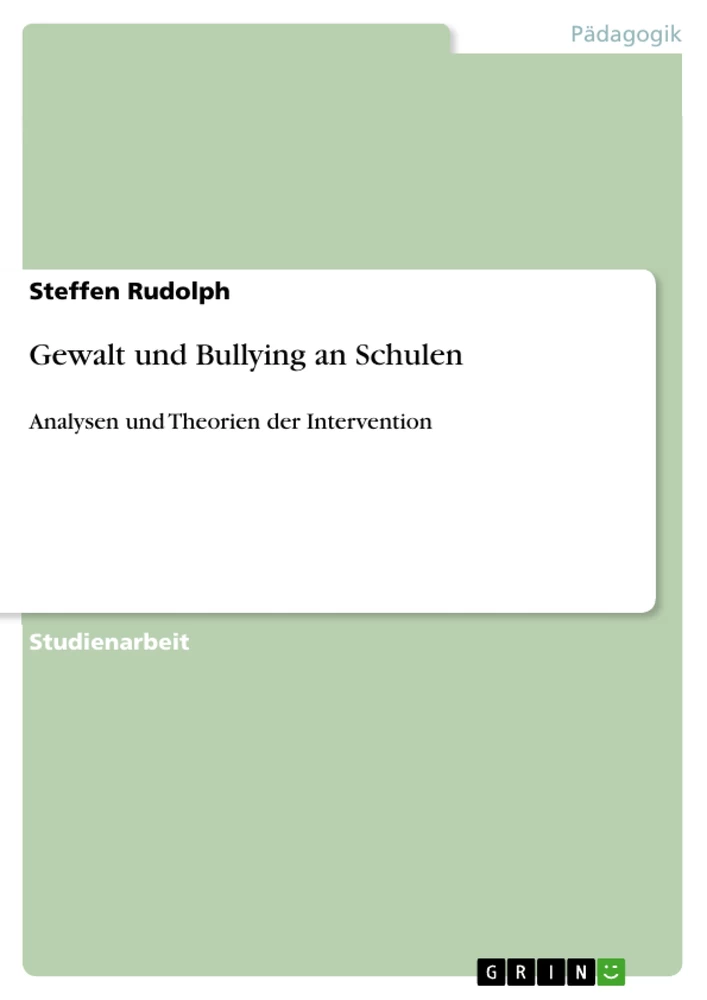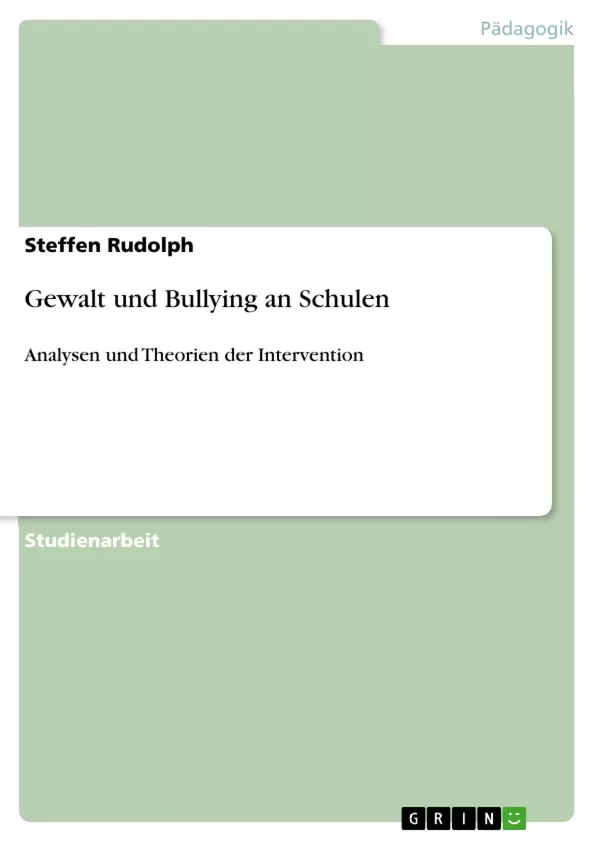In der öffentlichen Wahrnehmung hat sich die Problematik von Gewalt an Schulen in den letzten Jahren verschärft. Extreme Vorfälle wie das Schulmassaker 2001 in Erfurt oder die schweren Misshandlungen in Lüneburg und Bremen 2004 prägen die Berichterstattung. Empirische Untersuchungen bestätigen diese gefühlte Zunahme der Gewaltausübung an Schulen nicht eindeutig.
Verschiedene Umfragen ergaben allerdings, dass etwa die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler Angst vor Gewalt an Schulen hat. Etwa jeder Fünfte Schüler in Deutschland wurde bereits von anderen Schülern
und Schülerinnen geschlagen, bedroht oder psychisch angegriffen. Diese hohe Zahl sollte Anlass zum Denken und Handeln sein, sie ist allerdings auch kein Grund in Panik zu verfallen.
Alle Studien der letzten Jahre kommen - oft entgegen "seriöser" Medienberichte - zum Ergebnis, dass die Schule kein Hort schwerer Kriminalität geworden ist. Nach einer Untersuchung des Bundesverbandes der Unfallkassen hat die physische Gewalt an Schulen in den letzten zehn Jahren deutschlandweit sogar abgenommen. Es bleibt allerdings ein gewisser Kern von Gewalttätern, der den Lehrern und Mitschülern das Leben schwer macht.
Diese Täter werden immer jünger und die Auseinandersetzungen immer härter. Besorgnis erregend ist auch der Anstieg und der alltägliche Gebrauch verbaler Gewalt.
Thema dieser Arbeit ist das Auftreten von Gewalt und Bullying an Schulen in Deutschland und der Umgang damit. In einem ersten Abschnitt werden die Begriffe Gewalt und Bullying definiert und es werden verschiedene Formen der Aggression unterschieden. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den "normalen" Formen der Gewalt, daher spielen die immer noch seltenen Formen der Amokläufe als auch der Suizide keine Rolle in dieser Arbeit.
Im zweiten Abschnitt wird die Realität in Sachen Gewalt und Bullying auf Basis verschiedener Studien der letzten Jahre diskutiert. Im
Anschluss daran werden die Ursachen untersucht und Einflussfaktoren für die Entstehung von Gewalt benannt. Im dritten Abschnitt wird untersucht, wie die Schulen aktuell mit der Problematik umgehen. Prävention, Intervention / Mediation und Postvention findet an Schulen in ganz unterschiedlichen Facetten statt. An manchen
Schulen wird sie nur punktuell eingesetzt, an anderen dagegen als dauerhafter Prozess verstanden.In einem Fazit werden die Ergebnisse festgehalten.
Gliederung
Einleitung
I. Definitionen
II. Prävalenz, Theorien und Einflussfaktoren
2.1 Prävalenz
2.2 Theorien zur Entstehung von Gewalt
2.3 Einflussfaktoren
III. Prävention, Intervention, Postvention
3.1 Grundlagen
3.2 Konzepte
3.3 Beispiele
IV. Fazit
- Arbeit zitieren
- Steffen Rudolph (Autor:in), 2011, Gewalt und Bullying an Schulen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197466