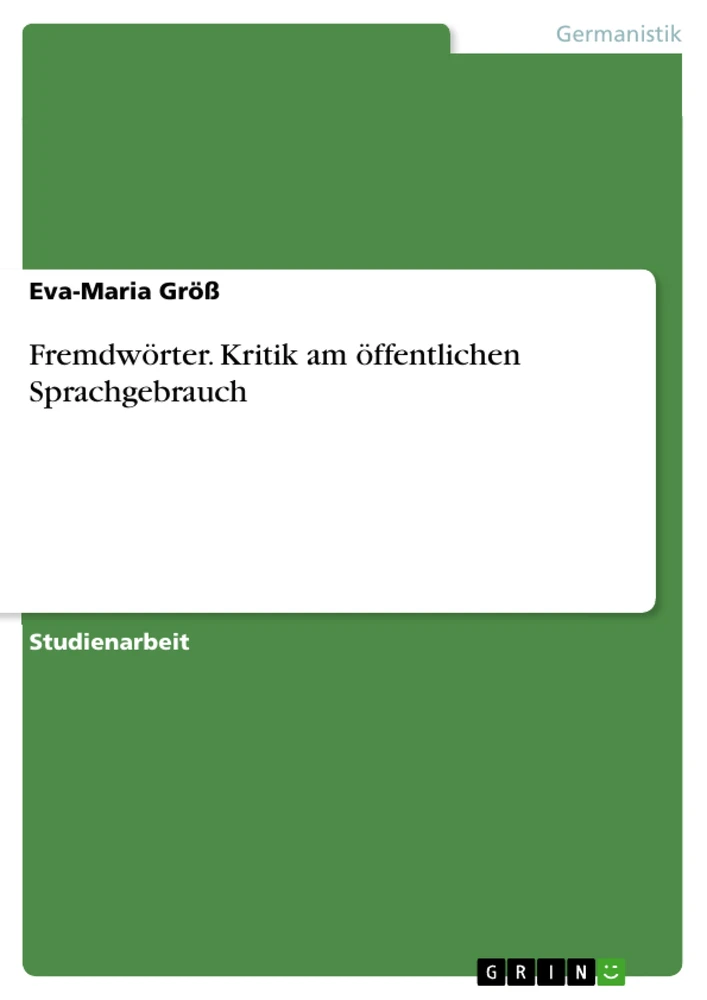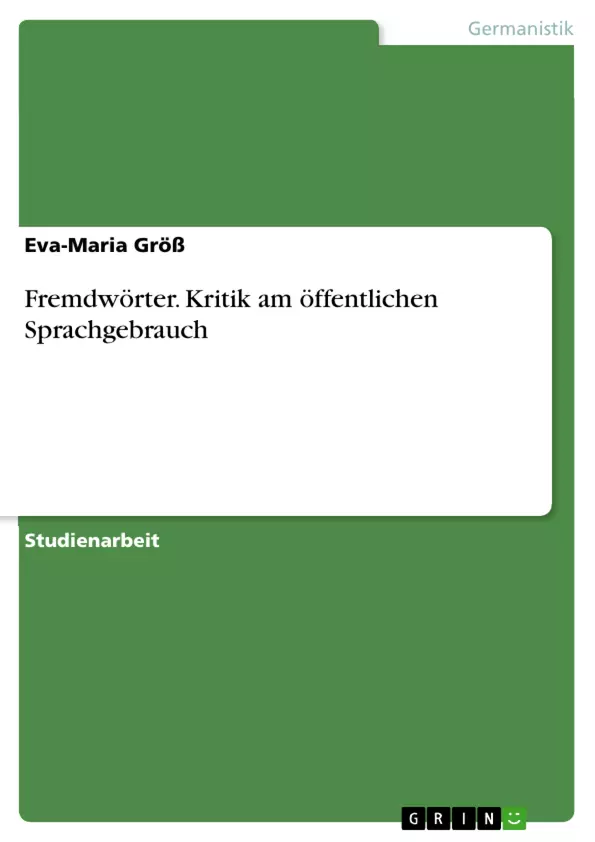Abweichungen von der Sprachnorm werden argwöhnisch betrachtet und mit der Phrase „Verfall der Sprache“ in Zusammenhang gebracht. Der „Sprachverfall“ wird zum Schlagwort, ja zur Floskel, die in aller Munde zu sein scheint. Doch sind sich die Sprecher über die Bedeutung des Ausdrucks überhaupt bewusst?
Nie zuvor diskutierten Sprachwissenschaftler die Überfremdung der deutschen Sprache wie in den letzten beiden Jahrzehnten. Etliche Bücher und Aufsätze widmen sich dieser Thematik. Darüber hinaus zählt die Fremdwortproblematik, insbesondere im Hinblick auf den vermehrten Anglizismengebrauch, zu den wenigen Sprachfragen, die auch die Öffentlichkeit bewegen. Diese Feststellung schlägt sich nicht nur in der Beobachtung nieder, dass Vereinigungen entstehen, die sich für den Schutz und die Bewahrung der deutschen Sprache aussprechen, auch eine 1999 erschienene bundesweite Repräsentativumfrage der IDS gibt preis, dass etwa ein Viertel der Deutschen die aktuellen Sprachveränderungen mit Besorgnis verfolgen und eine Überfremdung der deutschen Sprache sehen bzw. befürchten.
Wieder einmal findet die These des Sprachverfalls in der Öffentlichkeit Zustimmung. Die Klagen über den ständig fortschreitenden Verfall des Deutschen beziehen sich nicht nur auf Sprechermängel hinsichtlich der Beherrschung von Rechtschreibung, Grammatik, Lese- oder Ausdrucksfähigkeit. Ebenfalls die unreflektierte Neigung zu Fremd- und Modewörtern, insbesondere in der Sprache der Medien, der Jugend und der Wissenschaften, stößt auf Kritik. Viele Laien stehen diesen neuen Sprachwandelprozessen sehr kritisch gegenüber, reagieren sogar aggressiv. Sie nehmen die konservative Grundhaltung ein, die alte Sprache bewahren zu wollen, sie vor Neuem zu schützen. Problematisch hierbei ist, dass viele Laien von einer fest gefügten, unwandelbaren Regelsprache, ja Normsprache ausgehen, vermutlich noch diese, die sie in ihrer Jugend in Elternhaus und Schule gelernt haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Bezug zum Thema des Seminars
- 1.2 Einstieg in die Thematik: Problematisierung „Verfall der deutschen Sprache“
- 2. Fremdwörter
- 2.1 Geschichtlicher Rückblick
- 2.1.1 Exkurs: Fremdsprachliche Einflüsse auf die deutsche Sprache
- 2.1.2 Sprachpurismus
- 2.2 Angloamerikanismen
- 2.3 Kritik am Fremdwort
- 3. Diskussion und Fazit
- 4. Didaktische Anregungen: Das Thema „Fremdwörter“ im Deutschunterricht der Sekundarstufe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Kritik am öffentlichen Sprachgebrauch, speziell im Hinblick auf Fremdwörter. Ziel ist es, die Thematik sprachwissenschaftlich zu beleuchten und didaktische Ansätze für den Unterricht aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei auf Fremdwörtern, wobei der Diskurs um Fachwörter ausgeklammert wird. Die Arbeit analysiert die öffentliche Debatte um den angeblichen "Verfall der deutschen Sprache" und setzt diese in den Kontext sprachwissenschaftlicher Erkenntnisse.
- Der historische Umgang mit fremdsprachlichen Einflüssen auf die deutsche Sprache.
- Die Rolle des Sprachpurismus in der Debatte um Fremdwörter.
- Die zunehmende Verwendung von Angloamerikanismen im deutschen Sprachgebrauch.
- Zentrale sprachwissenschaftliche Kritikpunkte am Einsatz von Fremdwörtern.
- Didaktische Implikationen der Fremdwortproblematik für den Deutschunterricht.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung erläutert den Bezug der Arbeit zum Seminar "Sprachkritik" und führt in die Problematik des vermeintlichen "Verfalls der deutschen Sprache" ein. Sie beschreibt die öffentliche Besorgnis über den zunehmenden Gebrauch von Fremdwörtern, insbesondere Anglizismen, und skizziert die kontroverse Debatte zwischen Befürwortern und Kritikern des Sprachwandels. Die Autorin positioniert ihre Arbeit als sprachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Fremdwortproblematik und kündigt die Ausklammerung des Fachwortdiskurses an. Sie betont die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung der öffentlichen Sprachkritik und die Bedeutung von Sprachbewusstsein im Schulunterricht.
2. Fremdwörter: Dieses Kapitel bietet einen geschichtlichen Überblick über fremdsprachliche Einflüsse auf die deutsche Sprache, inklusive eines Exkurses zum Sprachpurismus und seinen Auswirkungen. Es analysiert die aktuelle Debatte um Angloamerikanismen und die damit verbundene Kritik. Der Abschnitt beleuchtet die zentralen sprachwissenschaftlichen Einwände gegen den Gebrauch von Fremdwörtern, wobei die Autorin sowohl öffentliche Meinungen als auch wissenschaftliche Perspektiven berücksichtigt. Der Kapitel schließt mit einer kritischen Auseinandersetzung mit der These des "Sprachverfalls" im Zusammenhang mit der Fremdwortproblematik.
Schlüsselwörter
Fremdwörter, Anglizismen, Sprachpurismus, Sprachkritik, Sprachwandel, öffentlicher Sprachgebrauch, Sprachverfall, Didaktik, Deutschunterricht, Sprachgeschichte.
FAQ: Sprachkritik - Fremdwörter im öffentlichen Sprachgebrauch
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Kritik am öffentlichen Sprachgebrauch, insbesondere im Hinblick auf Fremdwörter. Der Fokus liegt auf Fremdwörtern, wobei der Diskurs um Fachwörter ausgeklammert wird. Die Arbeit analysiert die öffentliche Debatte um den angeblichen "Verfall der deutschen Sprache" und setzt diese in den Kontext sprachwissenschaftlicher Erkenntnisse. Sie beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über Fremdwörter mit historischem Rückblick und Analyse aktueller Debatten, sowie eine Diskussion und ein Fazit mit didaktischen Anregungen für den Unterricht.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Thematik der Fremdwörter sprachwissenschaftlich zu beleuchten und didaktische Ansätze für den Deutschunterricht aufzuzeigen. Es soll ein differenziertes Verständnis der öffentlichen Sprachkritik gefördert und die Bedeutung von Sprachbewusstsein im Unterricht hervorgehoben werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den historischen Umgang mit fremdsprachlichen Einflüssen auf die deutsche Sprache, die Rolle des Sprachpurismus, die zunehmende Verwendung von Angloamerikanismen, zentrale sprachwissenschaftliche Kritikpunkte am Einsatz von Fremdwörtern und didaktische Implikationen für den Deutschunterricht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, die den Bezug zum Seminar und die Problematik des "Sprachverfalls" einführt; ein Kapitel über Fremdwörter mit historischem Rückblick, Analyse von Angloamerikanismen und sprachwissenschaftlicher Kritik; ein Kapitel mit Diskussion und Fazit; und schließlich ein Kapitel mit didaktischen Anregungen für den Deutschunterricht.
Was wird im Kapitel "Fremdwörter" behandelt?
Das Kapitel "Fremdwörter" bietet einen geschichtlichen Überblick über fremdsprachliche Einflüsse auf die deutsche Sprache, inklusive eines Exkurses zum Sprachpurismus. Es analysiert die aktuelle Debatte um Angloamerikanismen und die damit verbundene Kritik. Es beleuchtet zentrale sprachwissenschaftliche Einwände gegen den Gebrauch von Fremdwörtern und setzt sich kritisch mit der These des "Sprachverfalls" auseinander.
Welche didaktischen Anregungen werden gegeben?
Die Arbeit enthält ein Kapitel mit didaktischen Anregungen, wie das Thema "Fremdwörter" im Deutschunterricht der Sekundarstufe behandelt werden kann. Konkrete Vorschläge werden jedoch nicht im bereitgestellten Auszug genannt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Fremdwörter, Anglizismen, Sprachpurismus, Sprachkritik, Sprachwandel, öffentlicher Sprachgebrauch, Sprachverfall, Didaktik, Deutschunterricht, Sprachgeschichte.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit richtet sich an Personen, die sich für Sprachkritik, Sprachwandel und den Einfluss von Fremdwörtern auf die deutsche Sprache interessieren, insbesondere an Lehrende im Bereich Deutschunterricht.
- Quote paper
- Studienrätin Eva-Maria Größ (Author), 2007, Fremdwörter. Kritik am öffentlichen Sprachgebrauch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197517