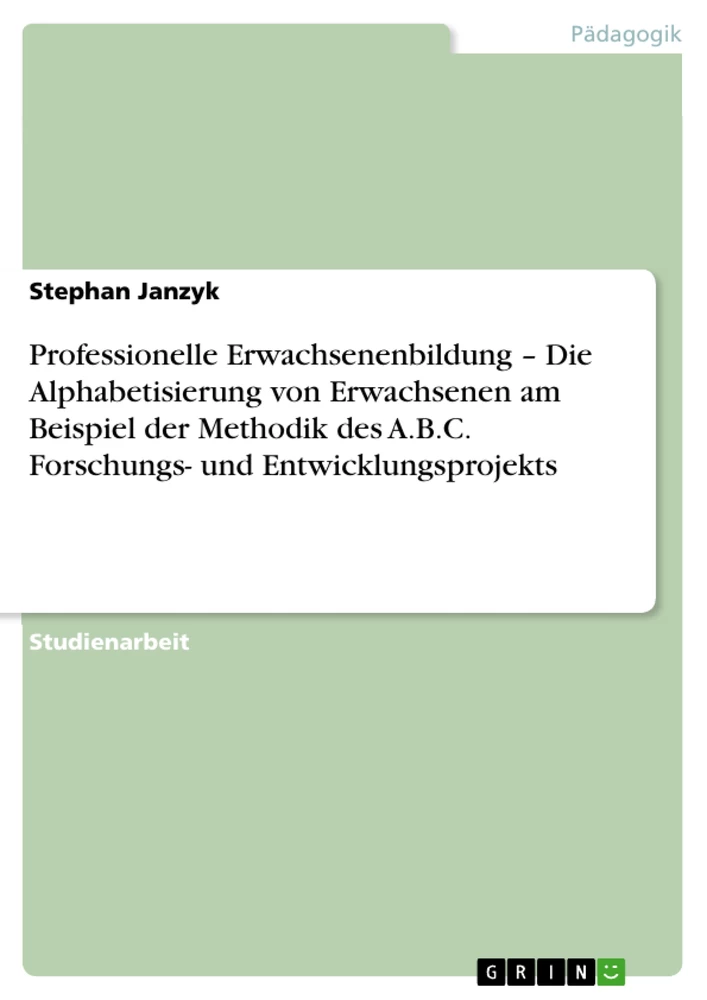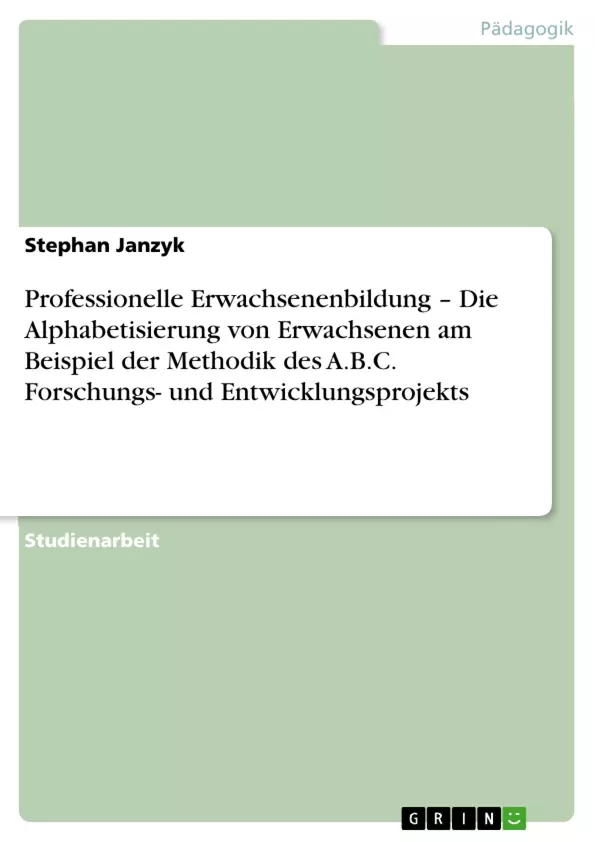Die vorliegende Hausarbeit zum Thema: „Professionelle Erwachsenenbildung? – Die Alphabetisierung von Erwachsenen am Beispiel der Methodik des A.B.C. Forschungs- und Entwicklungsprojekts“, welche im Masterstudium der Bildungs- und Erziehungswissenschaften an der Helmut – Schmidt – Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg, im Fach der Erwachsenenbildung verfasst wurde, beschäftigt sich mit der leider gegenwärtig immer noch aktuellen Problematik des Analphabetismus von Erwachsenen in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung in das Thema
2. Grundbegriffe
2.1. Grundzüge und Grundbegriffe der Alphabetisierung
2.2. Erwachsenenbildung und Professionalisierung
2.3. Grundbildung und Literalität
3. Methodik und Didaktik in der Erwachsenenbildung
4. Die Lehr – Lern – Methodik des A.B.C. Forschungs- und
Entwicklungsprojekts zur Alphabetisierung
5. Resümee
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des A.B.C. Forschungsprojekts?
Das Projekt befasst sich mit der Entwicklung effektiver Lehr- und Lernmethoden zur Alphabetisierung von Erwachsenen in Deutschland, um deren Literalität und Grundbildung zu verbessern.
Wie viele Erwachsene in Deutschland sind von Analphabetismus betroffen?
Die Arbeit thematisiert die gegenwärtige Problematik des funktionalen Analphabetismus, der Millionen von Erwachsenen betrifft, die zwar einzelne Wörter lesen, aber keine komplexen Texte verstehen können.
Was bedeutet Professionalisierung in der Erwachsenenbildung?
Professionalisierung bedeutet die Etablierung wissenschaftlich fundierter Standards, spezifischer didaktischer Kompetenzen und anerkannter Qualifikationen für Lehrkräfte in der Erwachsenenbildung.
Was ist der Unterschied zwischen Grundbildung und Literalität?
Literalität bezieht sich spezifisch auf die Lese- und Schreibkompetenz, während Grundbildung auch andere Basisfertigkeiten wie Rechnen, IT-Kenntnisse und soziale Kompetenzen umfasst.
Welche methodischen Ansätze nutzt das A.B.C.-Projekt?
Das Projekt nutzt teilnehmerorientierte und lebensweltnahe Didaktik, die die spezifischen Lernvoraussetzungen und Hemmschwellen erwachsener Lerner berücksichtigt.
- Quote paper
- Stephan Janzyk (Author), 2011, Professionelle Erwachsenenbildung – Die Alphabetisierung von Erwachsenen am Beispiel der Methodik des A.B.C. Forschungs- und Entwicklungsprojekts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197536