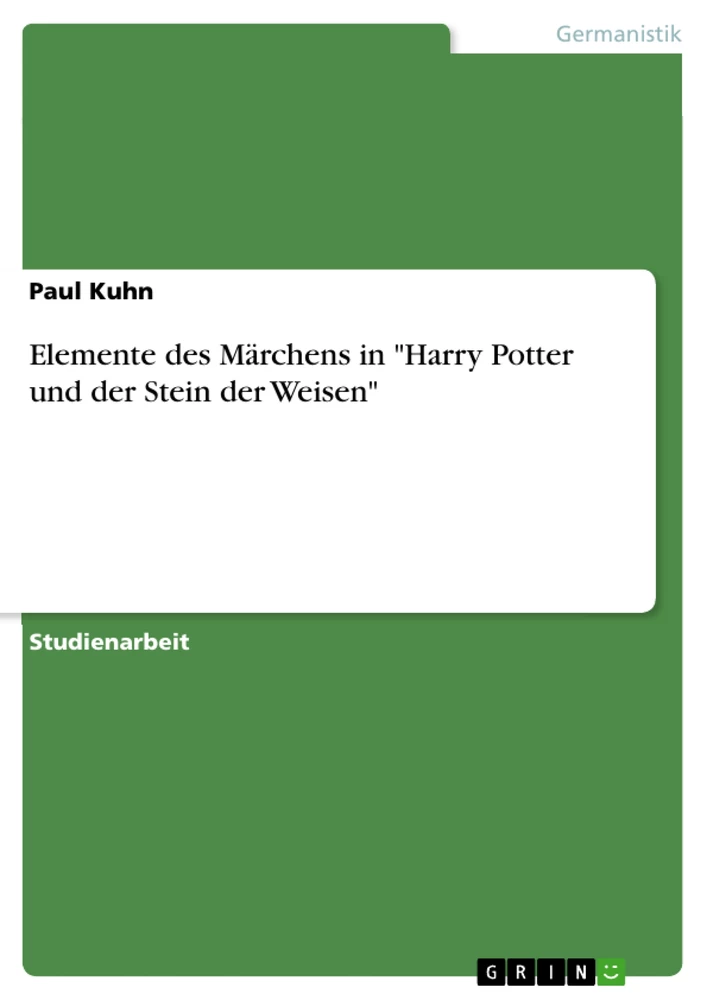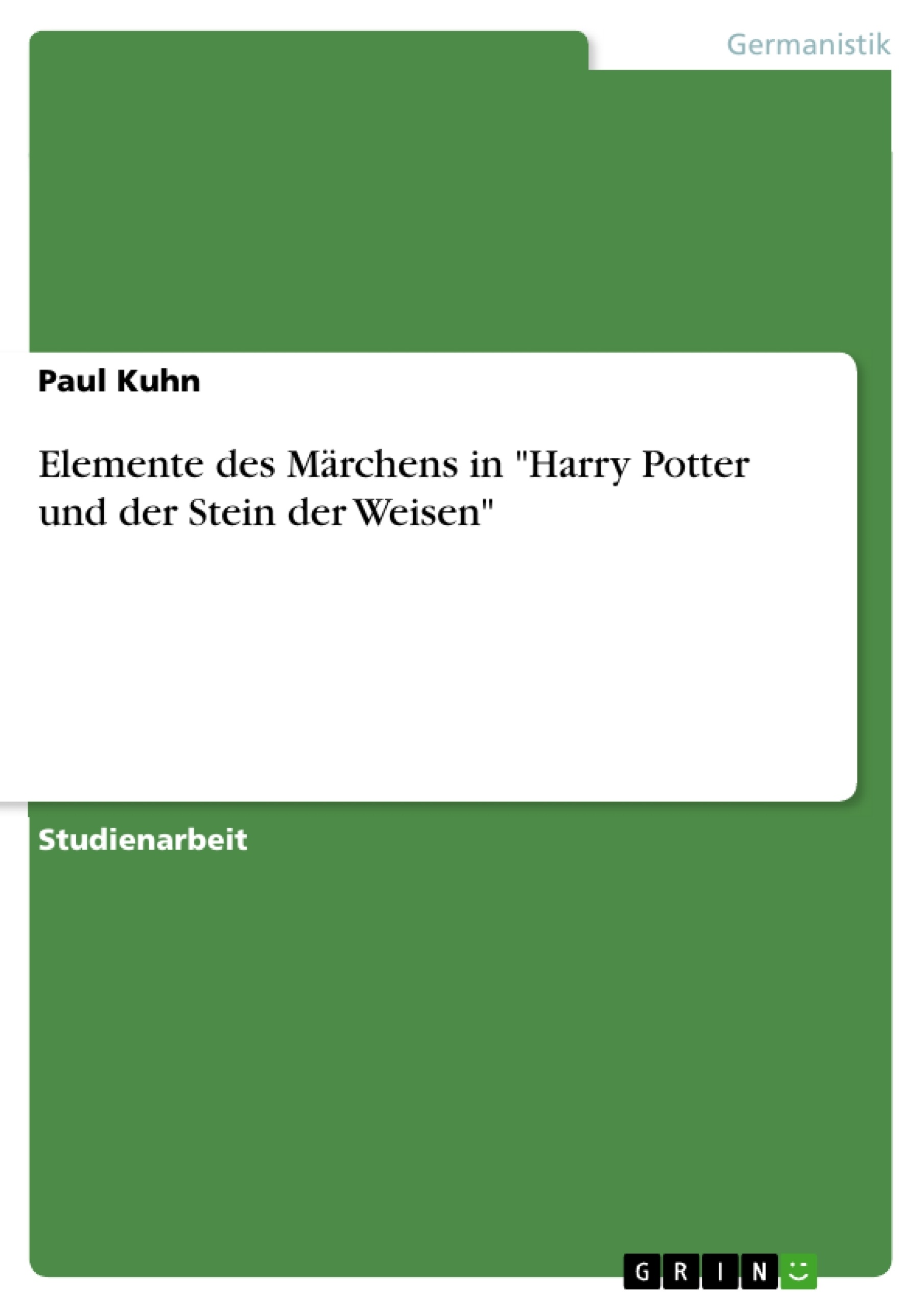Die Harry Potter-Romane erweisen sich über alle Ländergrenzen hinaus als Kassenschlager. Filme werden gedreht, illegale Raubkopien kursieren im Internet und Buchläden führen Sonderveranstaltungen zu den Erscheinungsterminen der Folgeromane durch. Kinder, Jugendliche und Erwachsene lesen die Bücher Joann K. Rowlings mit großer Begeisterung und es bilden sich Fan-Foren im Internet, in denen eifrig über die Auslegung der Harry Potter-Elemente debattiert wird. Was also ist das Erfolgsrezept der Romanreihe? Aus welchen Zutaten setzen sich die Bücher zusammen? Aus literaturwissenschaftlicher Sicht ist die Gattung der Harry Potter-Romane irgendwo zwischen Phantastischer Literatur, Abenteuerroman, Internatsgeschichte, Kriminalgeschichte und Adoleszenzroman anzusiedeln (vgl. Bak 2004, S. 88; Karg & Mende 2010, S. 184). Selten und wenn, dann meist zuletzt, konstatiert man auch märchenhafte Einflüsse (vgl. Mattenklott 2001, S. 34). Ziel dieser Arbeit ist es diese märchenhaften Elemente zu finden und kritisch zu hinterfragen. Dabei soll nicht die Behauptung bewiesen werden, dass die Harry Potter Romane zur Gattung „Märchen“ gehören würden. Dies soll auf Grundlage des ersten Bandes Harry Potter und der Stein der Weisen geschehen, da eine Analyse anhand mehrerer Bände der Reihe den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Vorgehen
2. Auf der Suche nach Wesensmerkmalen eines modernen Märchens
2.1 Was ist ein Märchen
2.2 Morphologische und inhaltliche Betrachtung des Märchens
2.3 Figuren des Märchens
2.4 Das Kunstmärchen
3. Grundlegende Feststellung - Volksmärchen oder Kunstmärchen
4. Ein Vergleich mit dem prototypischen Handlungsverlauf eines Märchens
4.1 Der Start
4.2 Die Reise
4.3 Der Schluss
5. Märchenhafte Figuren in Harry Potter und der Stein der Weisen
5.1Ist Harry Potter ein Märchenheld
5.2 Die Nebenfiguren
5.3 Wundersame Wesen
6. Themen und Motive des Märchens in Harry Potter und der Stein der Weisen
7. Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Ist Harry Potter ein klassisches Märchen?
Harry Potter wird primär als Phantastische Literatur oder Internatsgeschichte eingeordnet, enthält aber viele strukturelle und inhaltliche Elemente des Märchens, die in dieser Arbeit analysiert werden.
Welche märchenhaften Figuren finden sich in "Harry Potter und der Stein der Weisen"?
Neben dem „Märchenhelden“ Harry finden sich archetypische Figuren wie der weise Mentor (Dumbledore), der böse Gegenspieler (Voldemort) und wundersame Wesen wie Zentauren oder Einhörner.
Was unterscheidet ein Volksmärchen von einem Kunstmärchen?
Volksmärchen haben keinen festen Autor und sind mündlich überliefert, während Kunstmärchen (wie Harry Potter) bewusst von einem Autor verfasst wurden und oft komplexere Strukturen aufweisen.
Folgt die Handlung von Harry Potter einem märchenhaften Schema?
Ja, die Arbeit vergleicht den Handlungsverlauf – vom schwierigen Start (Auszug des Helden) über die Reise und Prüfungen bis zum Sieg über das Böse – mit dem prototypischen Märchenaufbau.
Welche Motive des Märchens werden in Harry Potter genutzt?
Typische Motive sind der Kampf zwischen Gut und Böse, die Verwendung magischer Gegenstände, Prophezeiungen und die moralische Entwicklung des Helden.
- Quote paper
- Paul Kuhn (Author), 2011, Elemente des Märchens in "Harry Potter und der Stein der Weisen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197748