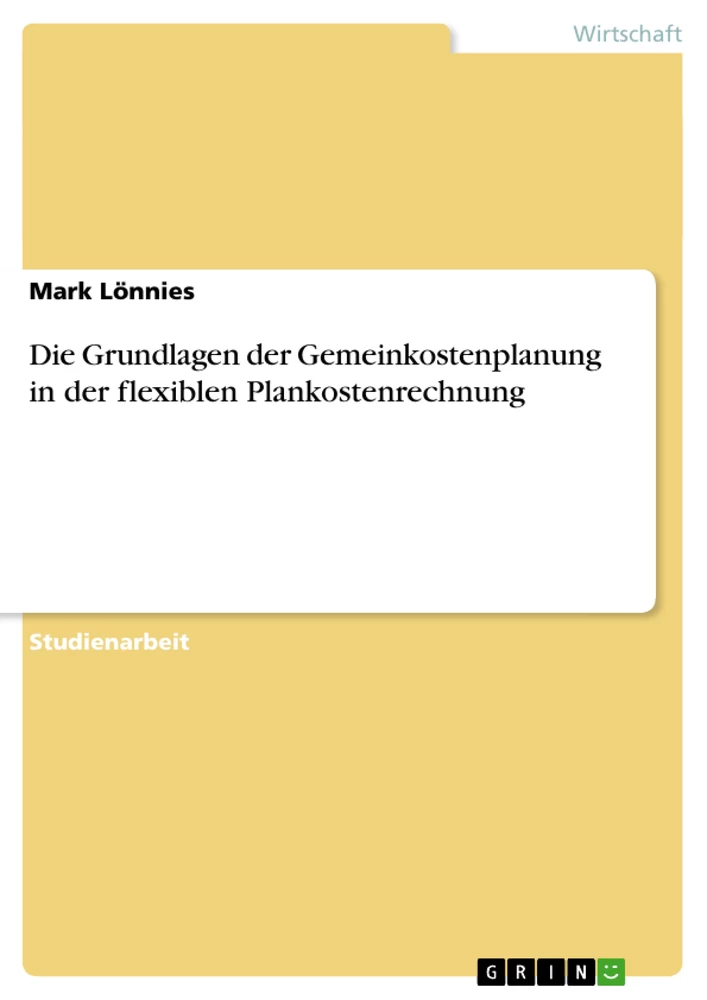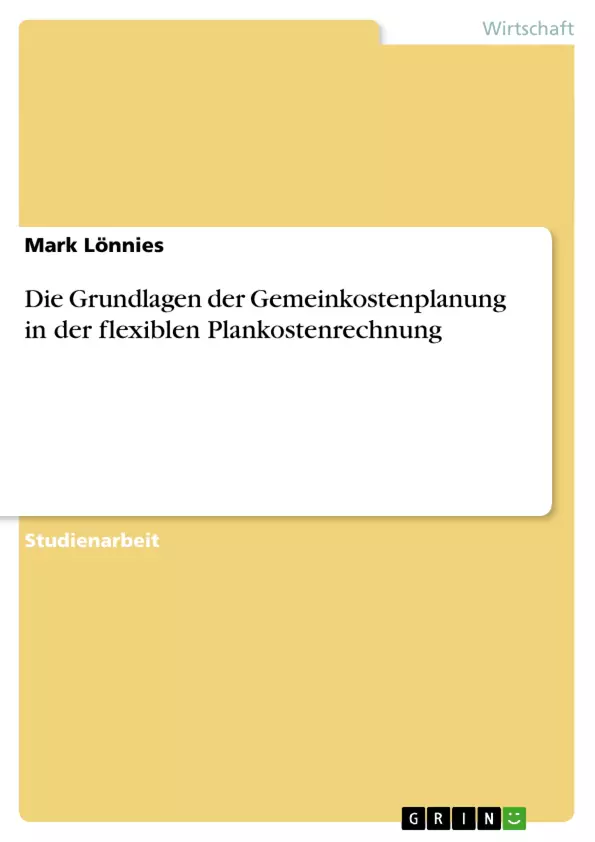Die Planung der Gemeinkosten ist einer der elementaren Bestandteile einer flexiblen Plankostenrechnung (PKR). Allgemein ist eine PKR dadurch charakterisiert, dass die Kosten nicht aus Werten der Vergangenheit abgeleitet werden, sondern aus der betrieblichen Planung hervorgehen. Ziel einer PKR ist es auch, bestimmte Faktoren, die auf die Kosten einwirken durch Vorausplanung der Kosten einer bestimmten Planungsperiode aus der Abrechnung zu eliminieren. Solche Einflüsse können sich durch Güterpreisschwankungen, Mengenverbrauchsschwankungen oder durch Schwankungen des Beschäftigungsgrades ergeben. Um eine Kostenkontrolle und eine Kalkulation ungestört durch solche Einflüsse durchführen zu können, verrechnet man statt der Istkosten geplante Kosten. Plankosten sind nicht nur im Voraus geplante Kosten, sondern sie haben auch Vorgabecharakter. Um der betrieblichen Kontrolle dienlich zu sein, stellt eine PKR mit Hilfe eines Soll-Ist-Vergleichs die Differenzen zwischen geplanten und tatsächlich angefallenen Kosten fest und analysiert diese. Die flexible PKR zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine Anpassung an Plandatenänderungen vornimmt. So werden z.B. Änderungen der technischen oder personellen Kapazität, der Losgröße oder der Produktionsverfahren berücksichtigt. Zwar gibt sie die Plankosten der Kostenstellen (KST) auf der Basis eines als Jahresdurchschnitt erwarteten Planbeschäftigungsgrades vor, rechnet die Plankosten aber auf den tatsächlich erreichten Ausnutzungsgrad (Istbeschäftigung) der einzelnen Abrechnungsperioden (z.B. Monaten) um. Diese Plankkosten der jeweiligen Istbeschäftigung werden als Sollkosten bezeichnet. Die Gemeinkosten treten bei der Auflösung der Plankosten in fixe und variable bzw. proportionale Bestandteile wieder in den Fordergrund. Die Gemeinkostenplanung beschreibt demnach eine planmäßige Festlegung der einzelnen Gemeinkostenarten je Kostenstelle mit Hilfe von Bezugsgrößen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Grundsätze der Gemeinkostenplanung
- Die Bedeutung der Kostenstelleneinteilung für die Gemeinkostenplanung
- Die Auswahl von Bezugsgrößen der Kostenverursachung
- Grundsätze und Verfahren der Bezugsgrößenwahl
- Direkte Bezugsgrößen
- Direkte Bezugsgrößen bei homogener Kostenverursachung
- Direkte Bezugsgrößen bei heterogener Kostenverursachung
- Indirekte Bezugsgrößen für Hilfs- und Nebenkostenstellen
- Bezugsgrößenwahl für Material-, Verwaltungs- und Vertriebskosten-stellen
- Die Bestimmung der Planbezugsgrößen
- Die Kapazitätsplanung
- Die Engpassplanung
- Vergleich von Kapazitäts- und Engpassplanung
- Die Methoden der Gemeinkostenplanung
- Gemeinkostenplanung mit statistischen Methoden
- Die einstufige analytische Gemeinkostenplanung
- Die planmäßige Kostenauflösung als Grundlage der einstufigen Gemeinkostenplanung
- Bewertung der einstufigen Gemeinkostenplanung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Grundlagen der Gemeinkostenplanung im Kontext der flexiblen Plankostenrechnung. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der relevanten Konzepte und Methoden zu vermitteln.
- Grundsätze der Gemeinkostenplanung
- Bedeutung der Kostenstelleneinteilung
- Auswahl und Bestimmung von Bezugsgrößen
- Methoden der Gemeinkostenplanung (statistische und analytische Ansätze)
- Kapazitäts- und Engpassplanung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Gemeinkostenplanung in der flexiblen Plankostenrechnung ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Sie skizziert die Bedeutung einer effizienten Gemeinkostenplanung für Unternehmen.
Allgemeine Grundsätze der Gemeinkostenplanung: Dieses Kapitel legt die grundlegenden Prinzipien der Gemeinkostenplanung dar. Es erläutert den Unterschied zwischen Einzel- und Gemeinkosten und die Herausforderungen, die sich bei der Zurechnung von Gemeinkosten ergeben. Es werden wichtige Begriffe wie Kostenstellen und Kostenträger definiert und deren Bedeutung für die Planung herausgestellt. Das Kapitel dient als Grundlage für das Verständnis der nachfolgenden Abschnitte.
Die Bedeutung der Kostenstelleneinteilung für die Gemeinkostenplanung: Dieser Abschnitt betont die entscheidende Rolle einer sinnvollen Kostenstelleneinteilung für eine effektive Gemeinkostenplanung. Verschiedene Kriterien für die Einteilung von Kostenstellen werden vorgestellt und diskutiert, einschließlich funktioneller, verantwortungsorientierter und räumlicher Aspekte. Der Fokus liegt auf der Erläuterung, wie eine geeignete Strukturierung die Genauigkeit der Kostenzuordnung und die Effizienz der Planung verbessert.
Die Auswahl von Bezugsgrößen der Kostenverursachung: Dieses Kapitel behandelt die Auswahl geeigneter Bezugsgrößen zur Verrechnung der Gemeinkosten. Es unterscheidet zwischen direkten und indirekten Bezugsgrößen und erläutert die Prinzipien ihrer Wahl. Die Diskussion umfasst verschiedene Verfahren und Methoden, die für die Ermittlung relevanter Bezugsgrößen in unterschiedlichen betrieblichen Kontexten angewendet werden können, einschließlich der Berücksichtigung homogener und heterogener Kostenverursachung.
Die Bestimmung der Planbezugsgrößen: Hier werden die Methoden zur Bestimmung der Planbezugsgrößen erläutert, wobei Kapazitäts- und Engpassplanung im Detail beschrieben werden. Die jeweiligen Vorteile und Nachteile beider Methoden werden im Vergleich dargestellt. Der Abschnitt zeigt auf, wie die Wahl der Methode von den spezifischen Umständen des Unternehmens abhängt.
Die Methoden der Gemeinkostenplanung: In diesem Kapitel werden verschiedene Methoden der Gemeinkostenplanung vorgestellt und analysiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Erläuterung statistischer und einstufiger analytischer Methoden. Die Diskussion umfasst die Vorteile und Grenzen der einzelnen Methoden und deren Anwendbarkeit in unterschiedlichen Situationen. Besondere Aufmerksamkeit wird der planmäßigen Kostenauflösung als Grundlage der einstufigen Gemeinkostenplanung gewidmet.
Schlüsselwörter
Gemeinkostenplanung, flexible Plankostenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung, Bezugsgrößen, Kapazitätsplanung, Engpassplanung, statistische Methoden, analytische Methoden, Kostenverursachung, Plankosten.
FAQ: Gemeinkostenplanung in der flexiblen Plankostenrechnung
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Gemeinkostenplanung im Kontext der flexiblen Plankostenrechnung. Sie beinhaltet eine Einleitung, allgemeine Grundsätze der Gemeinkostenplanung, die Bedeutung der Kostenstelleneinteilung, die Auswahl und Bestimmung von Bezugsgrößen, verschiedene Methoden der Gemeinkostenplanung (inklusive statistischer und analytischer Ansätze), Kapazitäts- und Engpassplanung und abschließend ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Grundlagen der Gemeinkostenplanung, die Bedeutung der Kostenstelleneinteilung für eine effektive Planung, die Auswahl und Bestimmung geeigneter Bezugsgrößen zur Verrechnung der Gemeinkosten (einschließlich direkter und indirekter Bezugsgrößen), verschiedene Methoden der Gemeinkostenplanung (statistische und analytische Ansätze) und die Konzepte der Kapazitäts- und Engpassplanung.
Welche Methoden der Gemeinkostenplanung werden erläutert?
Die Seminararbeit beschreibt und analysiert verschiedene Methoden der Gemeinkostenplanung. Der Schwerpunkt liegt auf statistischen Methoden und der einstufigen analytischen Gemeinkostenplanung, einschließlich der planmäßigen Kostenauflösung als Grundlage dieser Methode. Die jeweiligen Vorteile und Grenzen der Methoden werden diskutiert.
Welche Rolle spielt die Kostenstelleneinteilung?
Die Arbeit betont die entscheidende Rolle einer sinnvollen Kostenstelleneinteilung für eine effektive Gemeinkostenplanung. Es werden verschiedene Kriterien für die Einteilung von Kostenstellen vorgestellt und diskutiert (funktionelle, verantwortungsorientierte und räumliche Aspekte), um die Genauigkeit der Kostenzuordnung und die Effizienz der Planung zu verbessern.
Wie werden Bezugsgrößen ausgewählt und bestimmt?
Das Dokument behandelt die Auswahl geeigneter Bezugsgrößen zur Verrechnung von Gemeinkosten. Es unterscheidet zwischen direkten und indirekten Bezugsgrößen und erläutert die Prinzipien ihrer Wahl. Verschiedene Verfahren und Methoden zur Ermittlung relevanter Bezugsgrößen in unterschiedlichen betrieblichen Kontexten werden vorgestellt, einschließlich der Berücksichtigung homogener und heterogener Kostenverursachung. Die Bestimmung der Planbezugsgrößen wird anhand von Kapazitäts- und Engpassplanung detailliert beschrieben, inklusive eines Vergleichs beider Methoden.
Was sind die Schlüsselbegriffe der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Gemeinkostenplanung, flexible Plankostenrechnung, Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung, Bezugsgrößen, Kapazitätsplanung, Engpassplanung, statistische Methoden, analytische Methoden, Kostenverursachung und Plankosten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Allgemeine Grundsätze der Gemeinkostenplanung, Die Bedeutung der Kostenstelleneinteilung für die Gemeinkostenplanung, Die Auswahl von Bezugsgrößen der Kostenverursachung, Die Bestimmung der Planbezugsgrößen, Die Methoden der Gemeinkostenplanung und abschließend ein Fazit.
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung führt in die Thematik der Gemeinkostenplanung in der flexiblen Plankostenrechnung ein, beschreibt den Aufbau der Arbeit und skizziert die Bedeutung einer effizienten Gemeinkostenplanung für Unternehmen.
- Quote paper
- Mark Lönnies (Author), 2003, Die Grundlagen der Gemeinkostenplanung in der flexiblen Plankostenrechnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19789