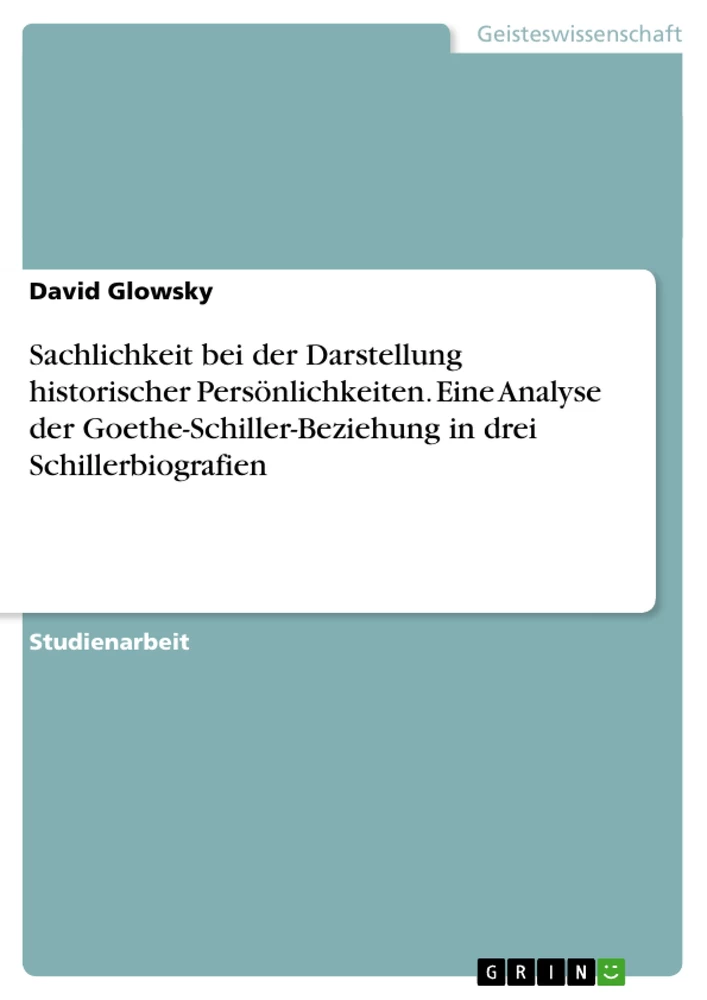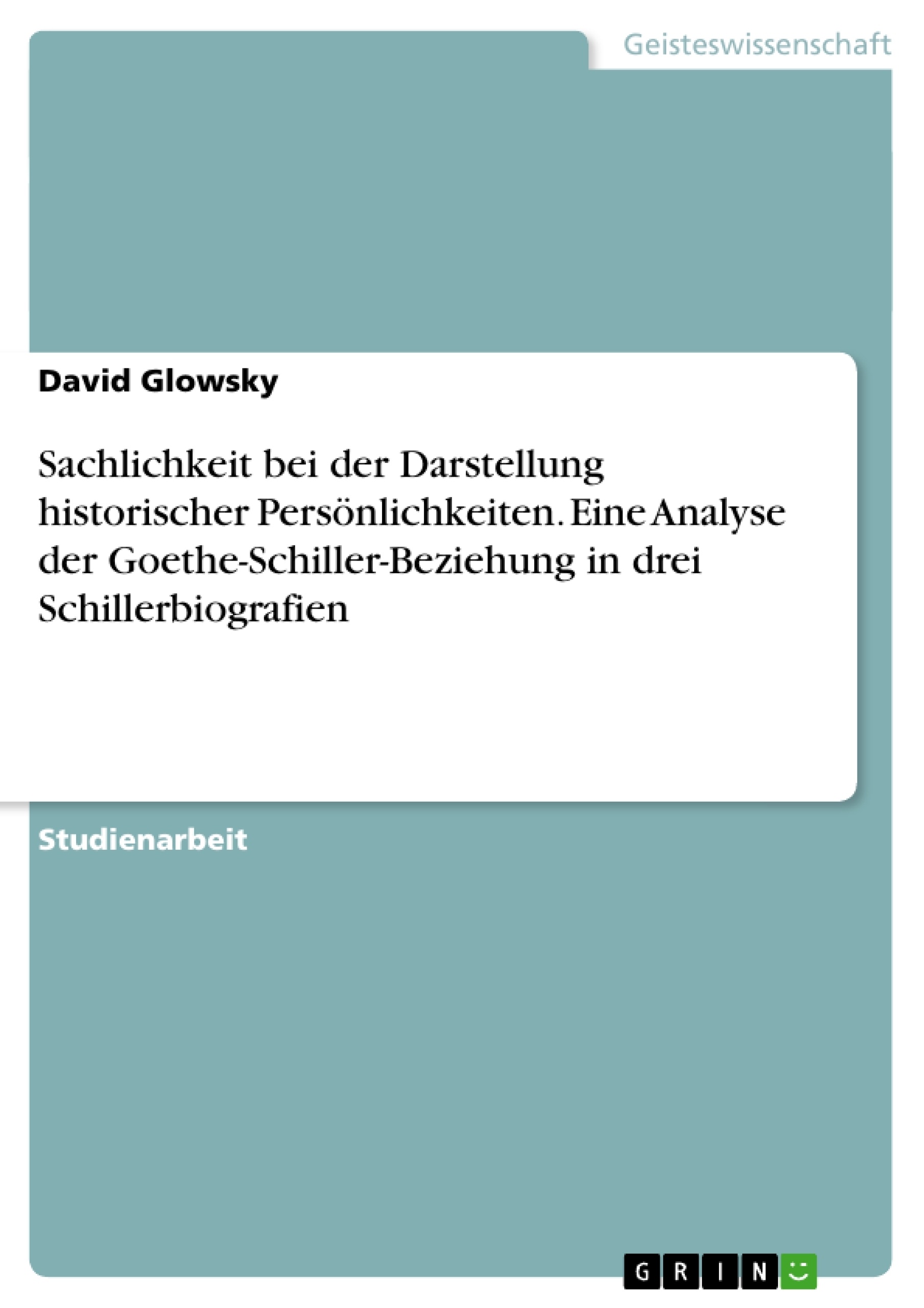Wahrscheinlich kein deutscher Autor hat sein eigenes Leben so akribisch festgehalten wie
Johann Wolfgang von Goethe, und wohl ebenso hat kein anderer sich darum bemüht, sich
selbst so sehr in Szene zu setzen. Goethe hat zu seinen Lebzeiten einen Großteil seiner
Energie darauf verwendet, sich selbst unsterblich zu machen. Nie hat er eine umfassende
Autobiografie geschrieben, und doch ist beinahe jeder Tag in Einzelheiten noch heute aus
Selbstzeugnissen nachvollziehbar. Aus unzähligen Briefen, die den Großteil seiner Gesamtausgabe
ausmachen, lässt sich sein Leben rekonstruieren. In späteren Lebensphasen
entstanden rückerinnernde Aufsätze, in denen er ausgesuchte Ereignisse seines Lebens
noch einmal niederschrieb und sie so stilisiert für die Nachwelt konservierte. Ab 1823
beschäftigte er Johann Eckermann einzig dafür, Gespräche, die er ihm diktierte, aufzuschreiben.
Darüber hinaus sorgte er mit ebenso großer Energie dafür, dass er seinen Zeitgenossen
präsent war. In jungen Jahren zeigte er regen Anteil an Versammlungen, später
konnte er es sich leisten, in seinen eigenen Räumen regelrechte Audienzen zu geben, bei
denen er sich nach Belieben inszenierte, bevorzugt in der Rolle des Kauzes.
Diese ein Leben andauernde Selbstinszenierung hat ihre Wirkung nicht verfehlt, sie hat zur
Goetherezeption der vergangenen 170 Jahre, die um 1900 in gottesähnlichen Glorifizierungen
kulminierte1, maßgeblich beigetragen. Grundlegend für diese Entwicklung war
sicherlich die Einführung des Abiturs in Preußen 1818, das Pflicht zur Zulassung an der
Universität wurde. Sie machte die Einführung eines Lehrkanons in Lehrplänen um 1830
notwendig, der ganzdeutsch sein musste, denn die Lehrplankommissionen mussten ein
Curriculum erarbeiten, das überall im Land angewendet werden konnte, und was bot sich
mehr an als Goethe und Schiller, die in ihren Werken gerade das Grundlegende in der
Kunst gesucht und eine Einheit der deutschen Kunst angestrebt hatten. Darüber hinaus
waren sie in Bezug auf die Bikonfessionalität der Deutschen nicht anstößig, da sie sich in
ihrem Werk nicht religionspolitisch engagierten. So wurden Goethe und Schiller bereits
unmittelbar nach Goethes Tod Bestandteil des deutschen Schulkanons, und die Germanistik
brachte um 1850 die ersten Schulbücher heraus, die die Schüler flächendeckend mit
Texten von Goethe und Schiller versorgten.
1 Ein gutes Beispiel dafür ist Bielschowsky 1896-1904.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Friedrich Schiller“ – Benno von Wiese
- 3. „Schillers Leben“ – Peter Lahnstein
- 4. „Schiller“ Oellers/Gellhaus
- 5. Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung historischer Persönlichkeiten in drei verschiedenen Schiller-Biografien. Das Hauptziel ist die Analyse der jeweiligen methodischen Ansätze und die Bewertung der Objektivität in der Beschreibung der Goethe-Schiller-Beziehung. Es wird untersucht, wie die Autoren mit den Selbstzeugnissen der beiden Dichter umgehen und welche Erzählweisen und Zitate sie verwenden, um ein Bild der Beziehung zu schaffen.
- Objektivität in der Geschichtsschreibung
- Die Darstellung der Goethe-Schiller-Beziehung in Biografien
- Analyse von Erzähltechniken und Zitatenauswahl in Biografien
- Der Einfluss von Selbstzeugnissen auf die biographische Darstellung
- Die Konstruktion von "deutscher Klassik"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die intensive Selbstinszenierung Goethes und deren Einfluss auf die Rezeption seines Lebens und Werkes. Sie skizziert die Entstehung des "Goethe-Kults" im Zusammenhang mit der Einführung des Abiturs, der Entwicklung eines nationalen Lehrkanons und des Historismus um 1871. Die Arbeit stellt die Frage nach den Möglichkeiten einer sachlichen und distanzierten Darstellung historischer Persönlichkeiten, insbesondere im Kontext der etablierten Mythenbildung um Goethe und Schiller und deren Bedeutung für die deutsche Identität. Die Untersuchung fokussiert sich auf die Analyse von drei Schillerbiografien und deren Darstellung der Goethe-Schiller-Beziehung.
2. „Friedrich Schiller“ – Benno von Wiese: Diese Zusammenfassung analysiert Benno von Wieses Biografie "Friedrich Schiller" von 1959. Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung der Beziehung zwischen Schiller und Goethe. Von Wiese's Ansatz wird als wenig kritisch beschrieben, da er die Selbstzeugnisse der beiden Dichter weitgehend unreflektiert übernimmt. Sein Fokus liegt primär auf Schillers literarischem Schaffen und geistiger Entwicklung, während sein Privatleben und die Rolle seiner Frau Charlotte nur marginal behandelt werden. Das Beispiel der unkritischen Einbettung von Schillers Zitaten, die die Beziehung zu Goethe mit der von Brutus zu Caesar vergleichen, veranschaulicht den Mangel an kritischer Distanz in von Wieses Darstellung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Darstellung historischer Persönlichkeiten in Schiller-Biografien"
Welche Biografien werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert drei verschiedene Schiller-Biografien: „Friedrich Schiller“ von Benno von Wiese (1959), „Schillers Leben“ von Peter Lahnstein (Jahr nicht angegeben im vorliegenden Auszug) und „Schiller“ von Oellers/Gellhaus (Autoren und Jahr nicht angegeben im vorliegenden Auszug).
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel besteht in der Analyse der methodischen Ansätze der drei Biografien und der Bewertung ihrer Objektivität bei der Darstellung der Beziehung zwischen Goethe und Schiller. Es wird untersucht, wie die Autoren mit den Selbstzeugnissen der beiden Dichter umgehen und welche Erzählweisen und Zitate sie verwenden, um ein Bild der Beziehung zu schaffen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie Objektivität in der Geschichtsschreibung, die Darstellung der Goethe-Schiller-Beziehung in Biografien, die Analyse von Erzähltechniken und Zitatenauswahl, den Einfluss von Selbstzeugnissen auf die biographische Darstellung und die Konstruktion von "deutscher Klassik".
Wie wird die Biografie von Benno von Wiese analysiert?
Die Analyse von Wieses Biografie „Friedrich Schiller“ kritisiert dessen wenig kritischen Ansatz. Von Wiese übernimmt die Selbstzeugnisse der beiden Dichter weitgehend unreflektiert. Sein Fokus liegt auf Schillers literarischem Schaffen, während sein Privatleben und die Rolle seiner Frau nur marginal behandelt werden. Die unkritische Verwendung von Schillers Zitaten, die die Beziehung zu Goethe mit der von Brutus zu Caesar vergleichen, veranschaulicht den Mangel an kritischer Distanz.
Welche weiteren Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Neben der Einleitung und der Analyse der Biografie von Benno von Wiese umfasst die Arbeit Kapitel zu „Schillers Leben“ von Peter Lahnstein und „Schiller“ von Oellers/Gellhaus sowie abschliessende Bemerkungen. Die Zusammenfassungen der restlichen Kapitel sind im vorliegenden Auszug nicht enthalten.
Was ist der Kontext der Arbeit?
Die Arbeit setzt sich mit der intensiven Selbstinszenierung Goethes und deren Einfluss auf die Rezeption seines Lebens und Werkes auseinander. Sie beleuchtet den "Goethe-Kult" im Zusammenhang mit dem Abitur, der Entwicklung eines nationalen Lehrkanons und des Historismus um 1871. Die zentrale Frage ist, wie eine sachliche und distanzierte Darstellung historischer Persönlichkeiten, insbesondere im Kontext der Mythenbildung um Goethe und Schiller, möglich ist.
- Citar trabajo
- David Glowsky (Autor), 2001, Sachlichkeit bei der Darstellung historischer Persönlichkeiten. Eine Analyse der Goethe-Schiller-Beziehung in drei Schillerbiografien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19797