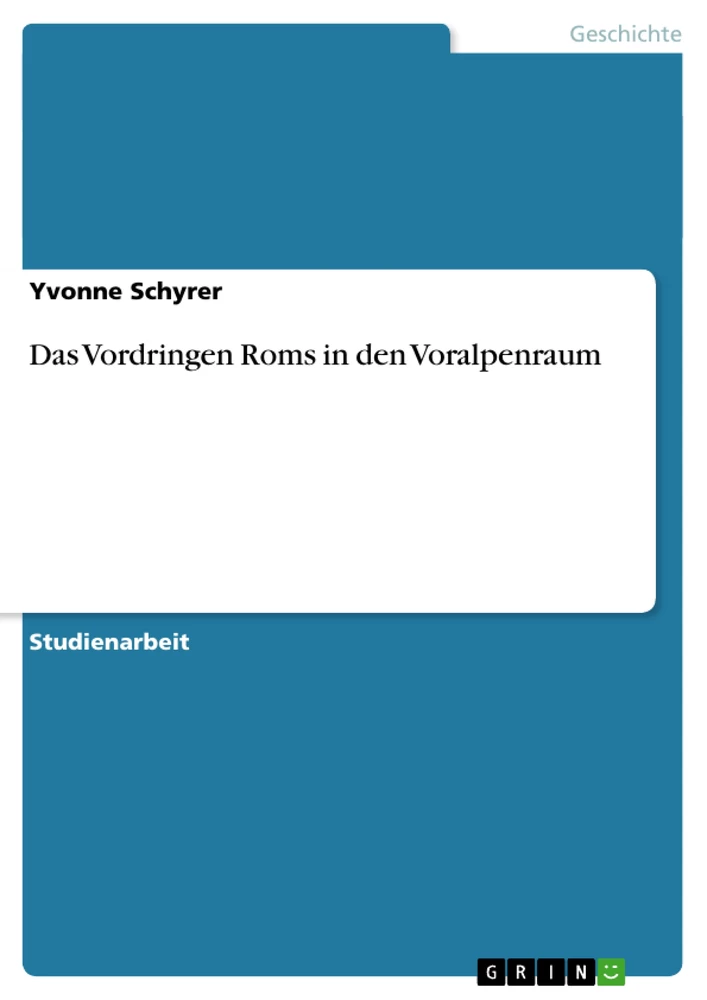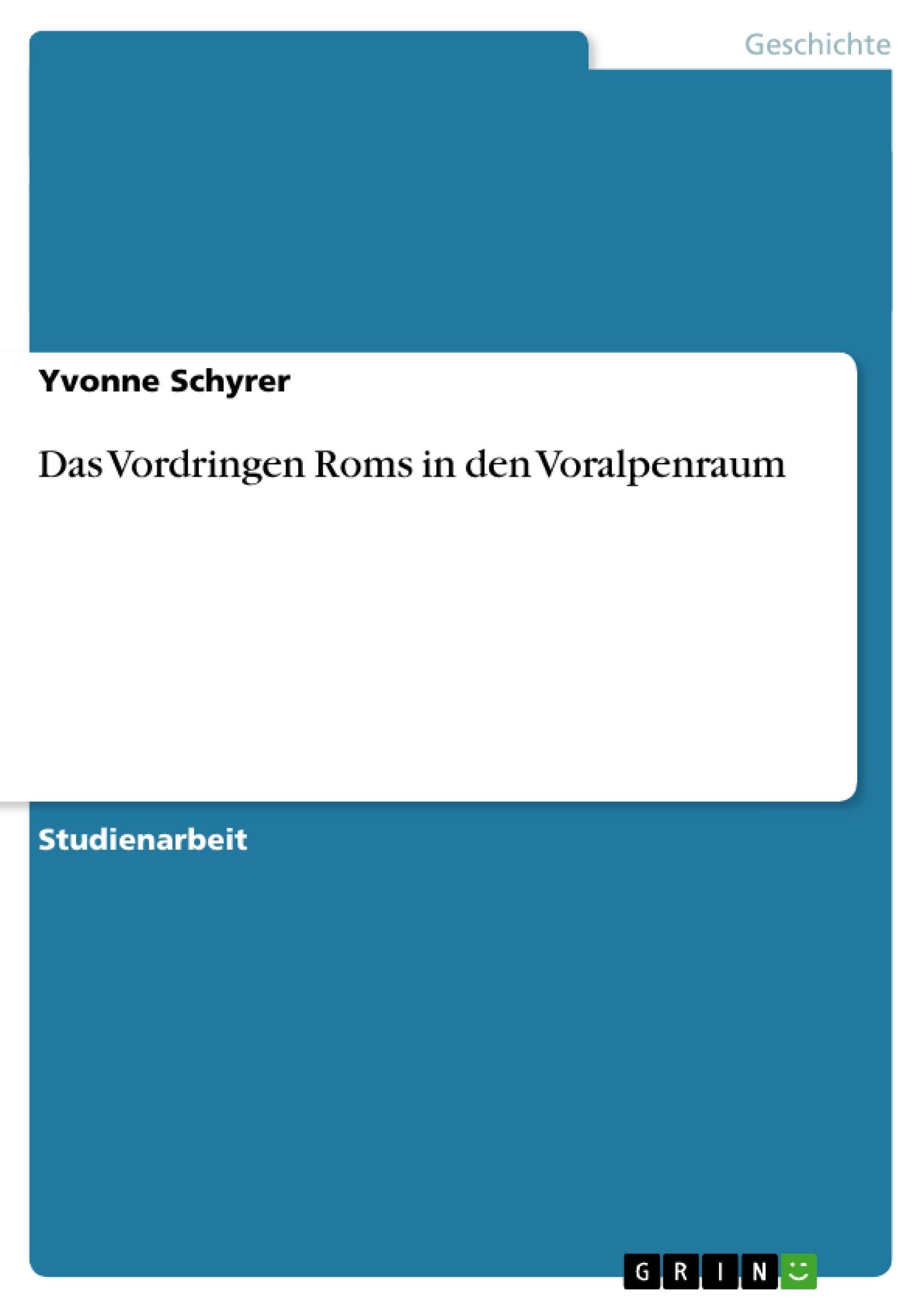Inhaltsverzeichnis
I) Einleitung
II) Hauptteil
1. Die Besetzung des Alpengebiets – verschiedene Theorien
2. Quelle zum Sommerfeldzug 15 v. Chr.
3. Die Eroberung des Alpenraums
4. Die Entscheidungsschlacht
III) Schluss
IV) Quellenverzeichnis
I) Einleitung
Geht es um die Frühzeit der römischen Geschichte, bezieht man das Wissen meist aus archäologischen Quellen. Dazu zählen unter anderem Inschriften auf Weihesteinen, Grabdenkmäler, Meilensteine oder Militärdiplome. Schriftliche Quellen sind kaum vorhanden.
Aus den vorhandenen Quellen lässt sich nach heutigem Wissensstand schließen, dass die Römer nicht erst auf Grund der Eroberung 15 v. Chr. in Berührung mit den Alpenstämmen kamen.
Diese frühzeitigen Beziehungen waren jedoch nur von einem friedlichen Fernhandel bestimmt, der politische Berührungen bis dahin ausschloss.1
Da die römische Herrschaftsausweitung anfangs nach Norden gerichtet war, stieß sie zunächst auf andere Mittelmeerregionen. Folglich entstand eine schubartige Erweiterung des Wissens über den Norden. „Dennoch waren die römischen Vorstellungen von den Raetern noch in der Kaiserzeit teilweise höchst nebulös.“2
Auf die erhaltene Literatur gestützt, geht man davon aus, dass die Römer nicht einmal genau wussten, wo die Raeter anzutreffen waren.
Um nun wirklich verstehen zu können, warum die Römer Teile des heutigen Bayerns eingenommen haben, sind weitere Überlegungen unerlässlich.
Inhaltsverzeichnis
I) Einleitung
II) Hauptteil
1. Die Besetzung des Alpengebiets - verschiedene Theorien
2. Quelle zum Sommerfeldzug 15 v. Chr.
3. Die Eroberung des Alpenraums
4. Die Entscheidungsschlacht
III) Schluss
IV) Quellenverzeichnis
I) Einleitung
Geht es um die Frühzeit der römischen Geschichte, bezieht man das Wissen meist aus archäologischen Quellen. Dazu zählen unter anderem Inschriften auf Weihesteinen, Grabdenkmäler, Meilensteine oder Militärdiplome. Schriftliche Quellen sind kaum vorhanden.
Aus den vorhandenen Quellen lässt sich nach heutigem Wissensstand schließen, dass die Römer nicht erst auf Grund der Eroberung 15 v. Chr. in Berührung mit den Alpenstämmen kamen.
Diese frühzeitigen Beziehungen waren jedoch nur von einem friedlichen Fernhandel bestimmt, der politische Berührungen bis dahin ausschloss.1
Da die römische Herrschaftsausweitung anfangs nach Norden gerichtet war, stieß sie zunächst auf andere Mittelmeerregionen. Folglich entstand eine schubartige Erweiterung des Wissens über den Norden. „Dennoch waren die römischen Vorstellungen von den Raetern noch in der Kaiserzeit teilweise höchst nebulös.“2
Auf die erhaltene Literatur gestützt, geht man davon aus, dass die Römer nicht einmal genau wussten, wo die Raeter anzutreffen waren.
Um nun wirklich verstehen zu können, warum die Römer Teile des heutigen Bayerns eingenommen haben, sind weitere Überlegungen unerlässlich.3
II) Hauptteil
1. Die Besetzung des Alpengebiets - verschiedene Theorien
Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass die Eroberung im Jahr 15 v. Chr. nur als simple Schutzmaßnahme der römischen Nordgrenze gedacht war. Auch Theodor Mommsen war der Auffassung, dass Rom ohne diesen Feldzug nicht mehr „Herr im eigenen Haus war“.4
Andere sahen jedoch bei diesem strategischen Zug, die Anfänge eines großen politischen Konzepts. Mit dem Ziel, einer bis zur Elbe reichenden römischen Herrschaft. Auslöser sei die schmachvolle Niederlage „clades Lolliana“ gewesen. Rom reichte es nun nicht mehr, die Rheingrenze zum Schutz Galliens zu verteidigen, sondern beabsichtigte ein offensives Vorgehen gegen die Germanen. Vorgesehen war hierfür eine militärische Zangenbewegung. Diese sollte auf der einen Seite vom Rhein nach Osten zur Unter- und Mittelelbe erfolgen und auf der anderen Seite von der Donau zu den Elbquellen. Die Eroberung des Alpenvorlandes sei nur als Vorbereitung auf die Kontrolle eines Landstreifens zwischen Iller und Lech gewesen, der als Aufmarschbasis für die geplante Unterwerfung des großgermanischen Raums dienen sollte. Heute ist die Ansicht weitgehend fallen gelassen worden.5
2. Quelle zum Sommerfeldzug 15 v. Chr.
Die Jahreszahl 15 v. Chr. ergibt sich „aus der Einordnung der Geschehnisse in das Geschichtswerk des Cassius Dio, in die Chronik des Kirchenvaters Hieronymus und nicht zuletzt durch eine noch zu erwähnende Angabe des Horaz.“6
Leider sind die Kenntnisse der damaligen Vorgänge, auf Grund der Quellenverluste, rar. Viele Einzelheiten sind umstritten oder nicht bekannt.
[...]
1 Vgl Czysz, Wolfgang; Dietz, Karlheinz; Fischer, Thomas; Kellner, Hans-Jörg: Die Römer in Bayern; Hamburg 2005; Seite 19
2 Czysz, Wolfgang; Dietz, Karlheinz; Fischer, Thomas; Kellner, Hans-Jörg: Die Römer in Bayern; Hamburg 2005; Seite 20
3 Vgl Czysz, Wolfgang; Dietz, Karlheinz; Fischer, Thomas; Kellner, Hans-Jörg: Die Römer in Bayern; Hamburg 2005; Seite 20f.
4 Vgl Czysz, Wolfgang; Dietz, Karlheinz; Fischer, Thomas; Kellner, Hans-Jörg: Die Römer in Bayern; Hamburg 2005; Seite 21
5 Vgl Czysz, Wolfgang; Dietz, Karlheinz; Fischer, Thomas; Kellner, Hans-Jörg: Die Römer in Bayern; Hamburg 2005; Seite 21f.
6 Czysz, Wolfgang; Dietz, Karlheinz; Fischer, Thomas; Kellner, Hans-Jörg: Die Römer in Bayern; Hamburg 2005; Seite 22
Häufig gestellte Fragen
Wann fand die Eroberung des Alpenraums durch die Römer statt?
Die entscheidende Eroberung und der sogenannte Sommerfeldzug fanden im Jahr 15 v. Chr. statt.
Welche Quellen belegen die römische Präsenz in Bayern?
Da schriftliche Quellen rar sind, stützt sich das Wissen vor allem auf archäologische Funde wie Weihesteine, Grabdenkmäler, Meilensteine und Militärdiplome.
Wer waren die Raeter?
Die Raeter waren ein Alpenstamm, über dessen genaue Lokalisierung die Römer lange Zeit nur vage Vorstellungen hatten, bevor es zur militärischen Konfrontation kam.
Was war die „clades Lolliana“?
Es handelt sich um eine schmachvolle Niederlage der Römer gegen Germanenstämme, die möglicherweise als Auslöser für eine offensivere römische Politik im Norden diente.
War die Alpenbesetzung nur eine Schutzmaßnahme?
Theodor Mommsen sah darin eine Schutzmaßnahme der Nordgrenze, während andere Theorien vermuten, dass sie Teil eines größeren Konzepts zur Eroberung Germaniens bis zur Elbe war.
- Quote paper
- B. Ed. Yvonne Schyrer (Author), 2011, Das Vordringen Roms in den Voralpenraum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197977