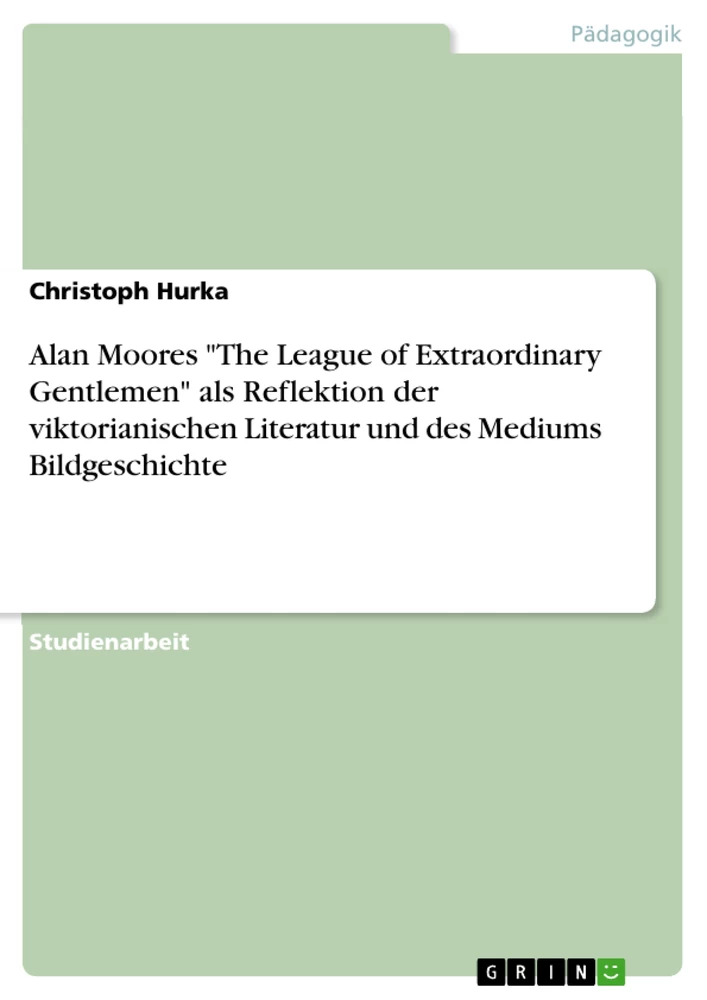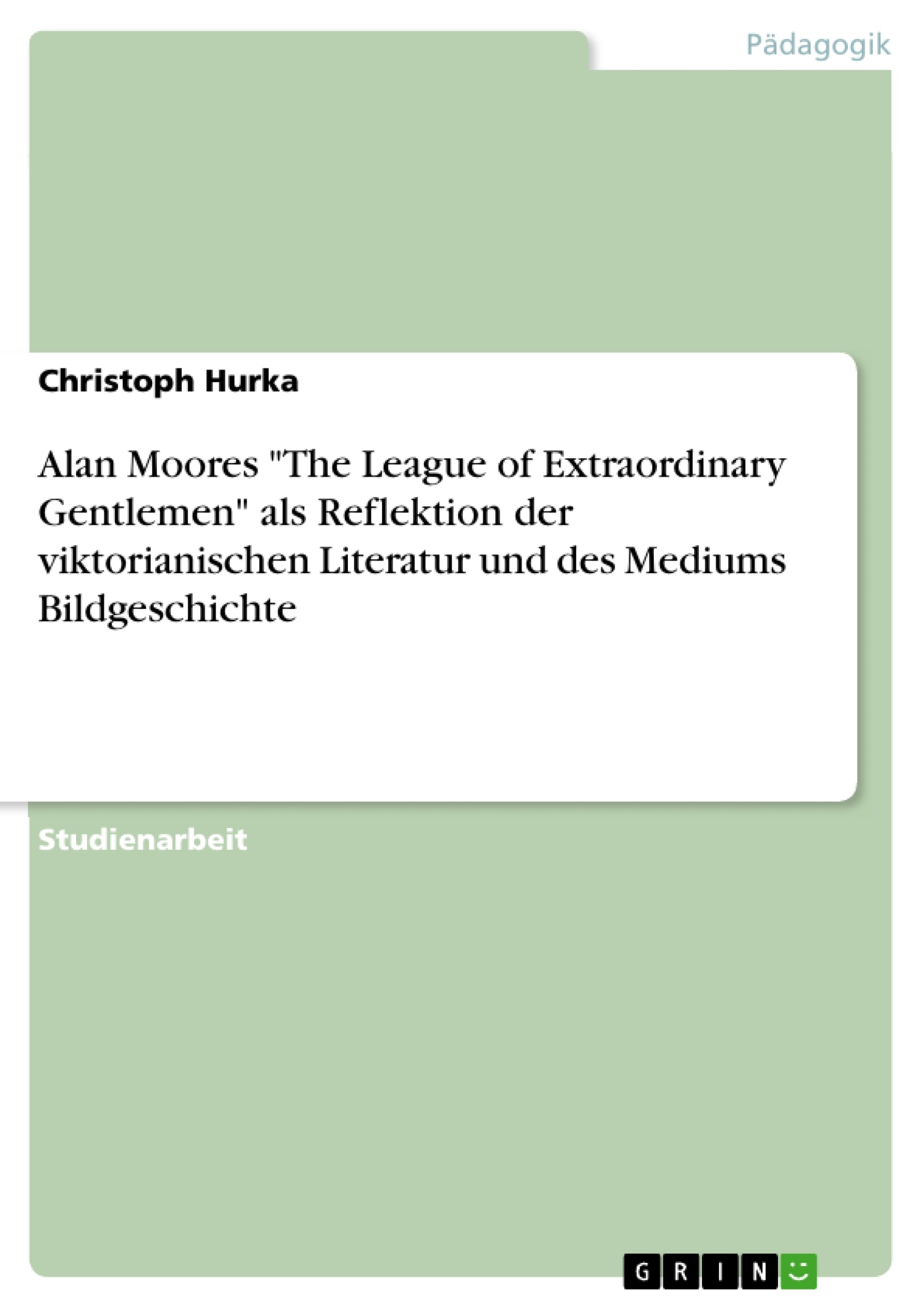Die vorliegende Arbeit soll versuchen, einige der scheinbar unzähligen Bezüge in Alan Moore’s Comic "The League of Extraordinary Gentlemen" zur Viktorianischen Literatur des neunzehnten Jahrhunderts herzustellen und zu erläutern. Die Vielschichtigkeit von Alan Moores’ Werk zeichnet sich nicht nur durch die sehr originelle Kombination verschiedenster Protagonisten aus literarischen Werken des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts, sondern auch durch die Bezugnahme auf die Publikationsformen der damaligen Zeit aus und arbeitet parallel zu der eigentlichen Geschichte der „Liga“ in höchst selbstreflektiver Weise auch die Entwicklung der Bildgeschichte und des Comics an sich auf. Die Protagonisten der LOEG sind allesamt aus Romanen des 19. Jahrhunderts entlehnt und bilden mit ihren starken Egos eine sehr heterogene Gruppe, deren Aufgabe der Schutz des Empires vor seinen Feinden ist (In Band I: Prof. Moriarty; in Band II: Marswesen).
Die Gestaltung der einzelnen Sammelbände (Band I und II bestehen ursprünglich aus jeweils 6 Einzelheften) wurde zudem dem Layout bekannter Literaturmagazine der Zeit – wie z.B. dem Strand Magazine – nachempfunden, was bedeutet, dass die LOEG nicht nur aus den Bildgeschichten der „Liga“ an sich bestehen, sondern zudem z.B. auch illustrierte Geschichten, die weitere Abenteuer von einzelnen Protagonisten der LOEG erzählen (wie z.B. Allan Quatermain), oder auch originale Werbeanzeigen der Zeit enthalten.
Jeder Aspekt der Gestaltung der LOEG – sei es die Auswahl der Protagonisten, die Etablierung eines bestimmten Weltbildes, das Setting, die Einbindung weiterer Geschichten oder die Illustration der Bände durch originale Werbeanzeigen – unterliegt somit dem Versuch, auf Ebene der Comicliteratur eine Art Gesamtkunstwerk zu schaffen, das in jedem seiner Bestandteile die Literatur des ausgehenden 19. Jahrhunderts adaptiert, widerspiegelt aber auch weiterentwickelt. Die Art und Weise in der dies geschieht soll im Folgenden, auch mit Hilfe zahlreicher Illustrationen, herausgearbeitet werden. Als Gegenstand für diese Untersuchungen dienen die beiden Hardcover-Ausgaben The League of Extraordinary Gentlemen Volume I und The League of Extraordinary Gentlemen Volume II .
Inhaltsverzeichnis
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Literatur und Gesellschaft des Viktorianischen Zeitalters
- 2.1 Das Figurenuniversum der LOEG
- 2.2 Das Verhältnis der LOEG-Protagonisten zu ihrer literarischen Vorlage
- 2.2.1 Allan Quatermain
- 2.2.2 Dr. Jekyll / Mr. Hyde
- 3.1 Alan Moores' LOEG als Reflektion auf die Entwicklung der Bildgeschichte und des Comics
- 3.1.1 Die Penny Dreadfuls
- 3.2 Nachahmung der Penny Dreadfuls in der LOEG
- 3.2.1 Weitere gestalterische Aspekte der Nachahmung viktorianischer Literatur in der LOEG
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die vielfältigen Bezüge von Alan Moores Comic "The League of Extraordinary Gentlemen" (LOEG) zur viktorianischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Sie analysiert die originelle Kombination verschiedener Protagonisten aus literarischen Werken des ausgehenden 19. Jahrhunderts und die Bezugnahme auf die damalige Publikationsform. Die Arbeit beleuchtet auch die selbstreflektierende Auseinandersetzung mit der Entwicklung der Bildgeschichte und des Comics.
- Die Auswahl der Protagonisten und ihre Darstellung in der LOEG
- Die Reflektion der viktorianischen Gesellschaft und Literatur in der LOEG
- Die Nachahmung viktorianischer Publikationsformen im Design des Comics
- Die LOEG als eigenständiges literarisches Werk im Kontext der Comicliteratur
- Die Entwicklung der Bildgeschichte und des Comics im Spiegel der LOEG
Zusammenfassung der Kapitel
1.1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Untersuchung der Bezüge von Alan Moores' LOEG zur viktorianischen Literatur und die Analyse der selbstreflektierenden Auseinandersetzung mit der Entwicklung von Bildgeschichte und Comic. Es wird hervorgehoben, dass die LOEG nicht nur Protagonisten aus verschiedenen literarischen Werken kombiniert, sondern auch die Publikationsformen der Zeit imitiert, um ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, das die Literatur des ausgehenden 19. Jahrhunderts adaptiert und weiterentwickelt.
1.2 Literatur und Gesellschaft des Viktorianischen Zeitalters: Dieses Kapitel beschreibt das historische Setting der LOEG im ausgehenden 19. Jahrhundert, während der Regierungszeit Queen Victorias. Es beleuchtet das Wachstum der englischen Wirtschaft und des Empires, aber auch die negativen Folgen wie die rapide Urbanisierung, steigende Armut und die daraus resultierenden gesellschaftlichen Probleme. Der Einfluss der Industrialisierung und der dampfbetriebenen Rotationspresse auf die Literaturproduktion und den Zugang zu Literatur wird ebenfalls diskutiert. Das Kapitel verdeutlicht, wie der Roman zum dominanten Medium der britischen Kultur wurde, und behandelt die gesellschaftliche "Degeneration"-Debatte am Ende des Jahrhunderts, die sich auch in der Literatur widerspiegelt, beispielsweise in Robert Louis Stevensons' "Dr. Jekyll and Mr. Hyde".
2.1 Das Figurenuniversum der LOEG: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Auswahl der Protagonisten der LOEG und deren Herkunft aus verschiedenen Werken der viktorianischen Literatur: Allan Quatermain, der Unsichtbare Griffin, Dr. Jekyll/Mr. Hyde, Mina Harker und Kapitän Nemo. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die LOEG trotz der Verwendung bereits existierender Figuren als eigenständiges literarisches Werk betrachtet werden kann. Der Vergleich mit anderen Comic-Serien, die ebenfalls bekannte Figuren kombinieren, wird angestellt.
2.2 Das Verhältnis der LOEG-Protagonisten zu ihrer literarischen Vorlage: Dieser Abschnitt untersucht, inwiefern Moore und O'Neill die ausgewählten Figuren aus ihren literarischen Vorlagen übernommen und verändert haben. Es wird ein Vergleich zwischen den ursprünglichen Charakteren und deren Darstellung in der LOEG vorgenommen, um zu zeigen, dass Moore und O'Neill eine eigenständige, psychologisierte Version dieser Figuren erschaffen haben. Durch die Kombination und Konfrontation der Figuren wird ihnen eine neue Facette hinzugefügt.
Schlüsselwörter
The League of Extraordinary Gentlemen, Alan Moore, Viktorianische Literatur, 19. Jahrhundert, Bildgeschichte, Comic, Allan Quatermain, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Mina Harker, Kapitän Nemo, Penny Dreadfuls, Industrialisierung, Urbanisierung, Gesellschaftliche Entwicklungen.
Häufig gestellte Fragen zu "The League of Extraordinary Gentlemen" (LOEG)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die vielfältigen Bezüge von Alan Moores Comic "The League of Extraordinary Gentlemen" (LOEG) zur viktorianischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Sie untersucht die Kombination verschiedener Protagonisten aus literarischen Werken des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die Bezugnahme auf damalige Publikationsformen und die selbstreflektierende Auseinandersetzung mit der Entwicklung der Bildgeschichte und des Comics.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Auswahl und Darstellung der Protagonisten in der LOEG, die Reflektion der viktorianischen Gesellschaft und Literatur im Comic, die Nachahmung viktorianischer Publikationsformen im Design, die LOEG als eigenständiges literarisches Werk im Kontext der Comicliteratur und die Entwicklung der Bildgeschichte und des Comics im Spiegel der LOEG.
Welche Protagonisten werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Protagonisten Allan Quatermain, den Unsichtbaren Griffin, Dr. Jekyll/Mr. Hyde, Mina Harker und Kapitän Nemo und deren Verhältnis zu ihren literarischen Vorlagen.
Wie werden die Figuren in der LOEG dargestellt?
Die Arbeit vergleicht die ursprünglichen Charaktere aus ihren literarischen Vorlagen mit deren Darstellung in der LOEG und zeigt, dass Moore und O'Neill eine eigenständige, psychologisierte Version dieser Figuren geschaffen haben. Die Kombination und Konfrontation der Figuren verleiht ihnen eine neue Facette.
Welche Rolle spielt die viktorianische Gesellschaft und Literatur?
Die Arbeit beschreibt das historische Setting der LOEG im ausgehenden 19. Jahrhundert, beleuchtet den Einfluss der Industrialisierung und der dampfbetriebenen Rotationspresse auf die Literaturproduktion und den Zugang zu Literatur und diskutiert die gesellschaftliche "Degeneration"-Debatte am Ende des Jahrhunderts.
Welche Bedeutung haben die Penny Dreadfuls?
Die Arbeit untersucht die Nachahmung der Penny Dreadfuls in der LOEG als gestalterische Aspekte der Nachahmung viktorianischer Literatur.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit ist gegliedert in eine Einleitung, Kapitel zur viktorianischen Literatur und Gesellschaft, zum Figurenuniversum der LOEG, zum Verhältnis der Protagonisten zu ihren Vorlagen und ein Fazit. Die Kapitelüberschriften und -zusammenfassungen bieten einen detaillierten Überblick über den Inhalt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: The League of Extraordinary Gentlemen, Alan Moore, Viktorianische Literatur, 19. Jahrhundert, Bildgeschichte, Comic, Allan Quatermain, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Mina Harker, Kapitän Nemo, Penny Dreadfuls, Industrialisierung, Urbanisierung, Gesellschaftliche Entwicklungen.
Kann man die LOEG als eigenständiges literarisches Werk betrachten?
Die Arbeit untersucht diese Frage, indem sie die Kombination bereits existierender Figuren und die eigenständige Interpretation und Weiterentwicklung dieser Figuren durch Moore und O'Neill analysiert.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewertet die Bedeutung der LOEG im Kontext der viktorianischen Literatur und der Entwicklung der Comicliteratur.
- Citar trabajo
- Bachelor of Arts Christoph Hurka (Autor), 2010, Alan Moores "The League of Extraordinary Gentlemen" als Reflektion der viktorianischen Literatur und des Mediums Bildgeschichte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198004