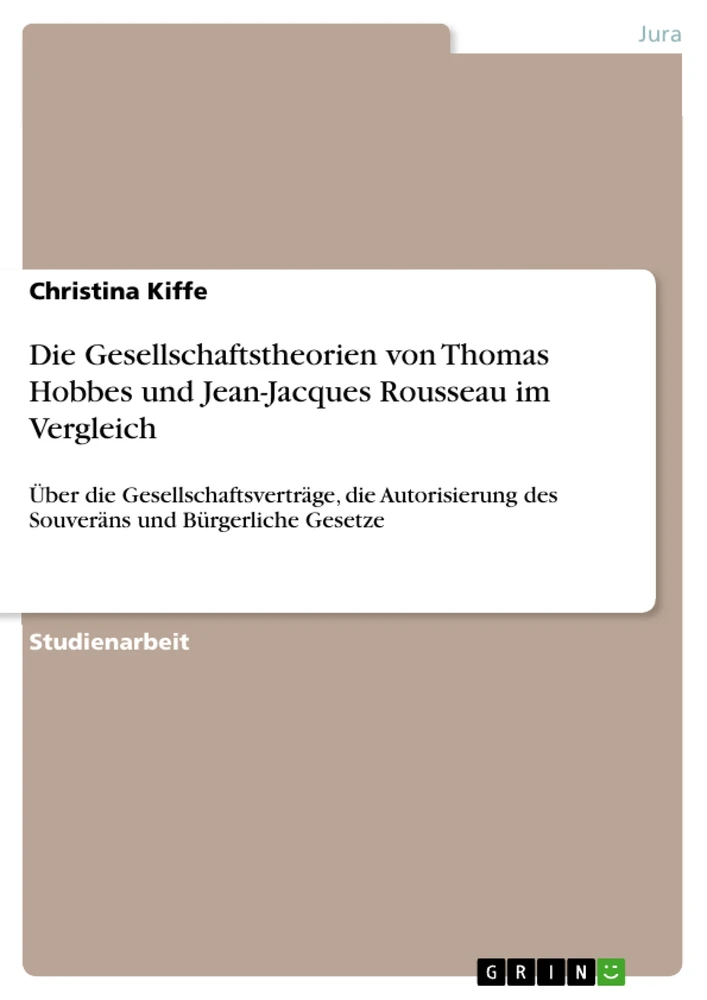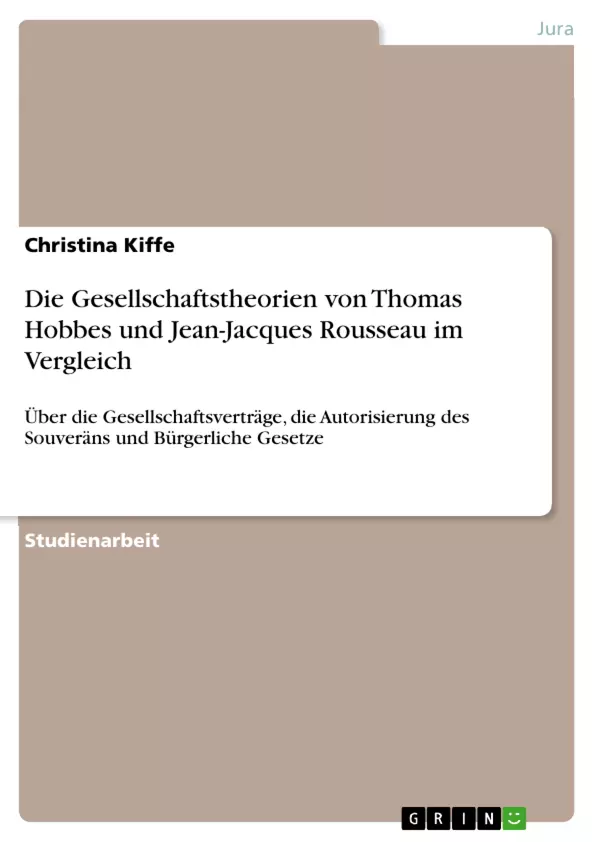Die Hausarbeit setzt sich mit den Wegbereitern der modernen Philosophie Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau auseinander, erläutert ihre Weltanschauung, ihr philosophisches Wirken und stellt biografische Bezüge her.
Die Arbeit erläutert ausführlich das Zustandekommen des Gesellschaftsvertrages nach Hobbes und Rousseau, die Elemente des Gesellschaftsvertrages sowie die Unterschiede der beiden Vertragskonstruktionen.
Weiterhin wird dargelegt, weshalb es für Hobbes wichtig ist, dass der Souverän durch die beiden vertragsschließenden Parteien "autorisiert" wird und ob zu dieser Ermächtigung eine Analogie bei Rousseau existent ist.
Im dritten und letzten Teil der Hausarbeit stehen die Anforderungen der beiden Theoretiker an ein vom Gesetzgeber erlassenes Gesetz im Mittelpunkt.
Die Hausarbeit endet mit einer Schlussbemerkung, welche die zentralen Aspekte der Gesellschaftstheorien in den historischen Kontext einordnet und weitere wichtige biografische Informationen enthält.
Inhaltsverzeichnis
- A. Der Gesellschaftsvertrag nach Hobbes und Rousseau
- I. Hobbes und Rousseau als Wegbereiter der modernen Philosophie
- II. Zustandekommen und Ursprung der Gesellschaftsverträge: Naturzustand und Menschenbild
- III. Elemente und Inhalte der Gesellschaftsverträge
- IV. Unterscheidungen der Vertragskonstruktionen
- B. Die Ermächtigung des Souveräns
- I. Die Autorisierung des Souveräns bei Hobbes
- II. Die Autorisierung des Souveräns bei Jean-Jacques Rousseau
- C. Anforderungen an ein vom Gesetzgeber erlassenes Gesetz und dessen Notwendigkeit
- I. Hobbes bürgerliche Gesetze
- II. Rousseaus bürgerliche Gesetze
- D. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Gesellschaftstheorien von Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau. Sie untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Konzeptionen des Gesellschaftsvertrages, der Ermächtigung des Souveräns und der Natur des bürgerlichen Rechts. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis der philosophischen Grundlegungen des modernen Staatswesens und der Rolle des Individuums in der Gesellschaft zu entwickeln.
- Der Gesellschaftsvertrag als Grundlage politischer Ordnung
- Das Menschenbild und der Naturzustand bei Hobbes und Rousseau
- Die Rolle des Souveräns in der Gesellschaftsordnung
- Die Bedeutung des bürgerlichen Rechts
- Die Spannungen zwischen individueller Freiheit und staatlicher Macht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Hobbes und Rousseau als Wegbereiter der modernen Philosophie und setzt ihre Theorien in den historischen Kontext des englischen Bürgerkriegs und der französischen Revolution. Es analysiert die verschiedenen Aspekte des Gesellschaftsvertrages bei beiden Denkern, einschließlich des Naturzustands, des Menschenbildes und der Elemente des Vertrages.
Im zweiten Kapitel werden die Mechanismen der Ermächtigung des Souveräns bei Hobbes und Rousseau untersucht. Es werden die Unterschiede in ihren Konzeptionen der Autorisierung des Souveräns und die Auswirkungen auf die Gestaltung der politischen Machtverhältnisse herausgearbeitet.
Das dritte Kapitel widmet sich der Frage nach den Anforderungen an ein vom Gesetzgeber erlassenes Gesetz und dessen Notwendigkeit. Es analysiert die Ansichten von Hobbes und Rousseau über das bürgerliche Recht, wobei die unterschiedlichen Schwerpunkte auf Sicherheit und Freiheit deutlich werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die zentralen Themen des Gesellschaftsvertrages, des Naturzustands, des Menschenbildes, der politischen Macht, des Souveräns, des bürgerlichen Rechts und der Spannungen zwischen individueller Freiheit und staatlicher Macht. Die Analyse der Werke von Hobbes und Rousseau ermöglicht ein tieferes Verständnis der Grundprinzipien des modernen Staatswesens und der philosophischen Debatte über die Legitimität von Macht und Herrschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptunterschiede zwischen Hobbes' und Rousseaus Gesellschaftsvertrag?
Während Hobbes den Vertrag als Unterwerfung unter einen absoluten Souverän zur Sicherheit sieht, versteht Rousseau ihn als Akt der Freiheit durch den "Gemeinwillen" (volonté générale).
Wie unterscheidet sich das Menschenbild bei Hobbes und Rousseau?
Hobbes sieht den Menschen im Naturzustand im "Krieg aller gegen alle", während Rousseau den Menschen als ursprünglich gut betrachtet, der erst durch die Gesellschaft korrumpiert wird.
Was bedeutet die "Autorisierung des Souveräns" bei Hobbes?
Bei Hobbes übertragen die Individuen all ihre Macht auf den Souverän (Leviathan), der fortan im Namen aller handelt, um Frieden und Ordnung zu gewährleisten.
Existiert eine Analogie zur Ermächtigung des Souveräns bei Rousseau?
Ja, bei Rousseau ist das Volk selbst der Souverän. Die Ermächtigung erfolgt durch die Identifikation des Einzelnen mit dem Gemeinwillen der Gemeinschaft.
Welche Anforderungen stellen beide an bürgerliche Gesetze?
Für Hobbes dienen Gesetze primär der Sicherheit und dem Schutz; für Rousseau müssen Gesetze Ausdruck des Volkswillens sein, um die Freiheit des Einzelnen zu wahren.
- Quote paper
- Christina Kiffe (Author), 2012, Die Gesellschaftstheorien von Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198035