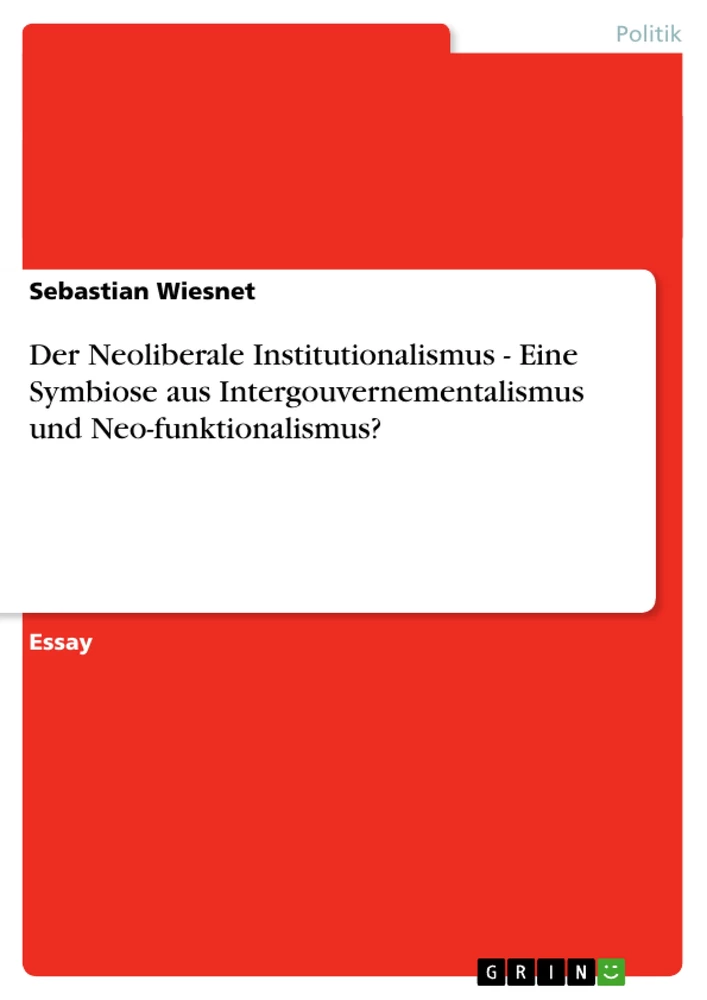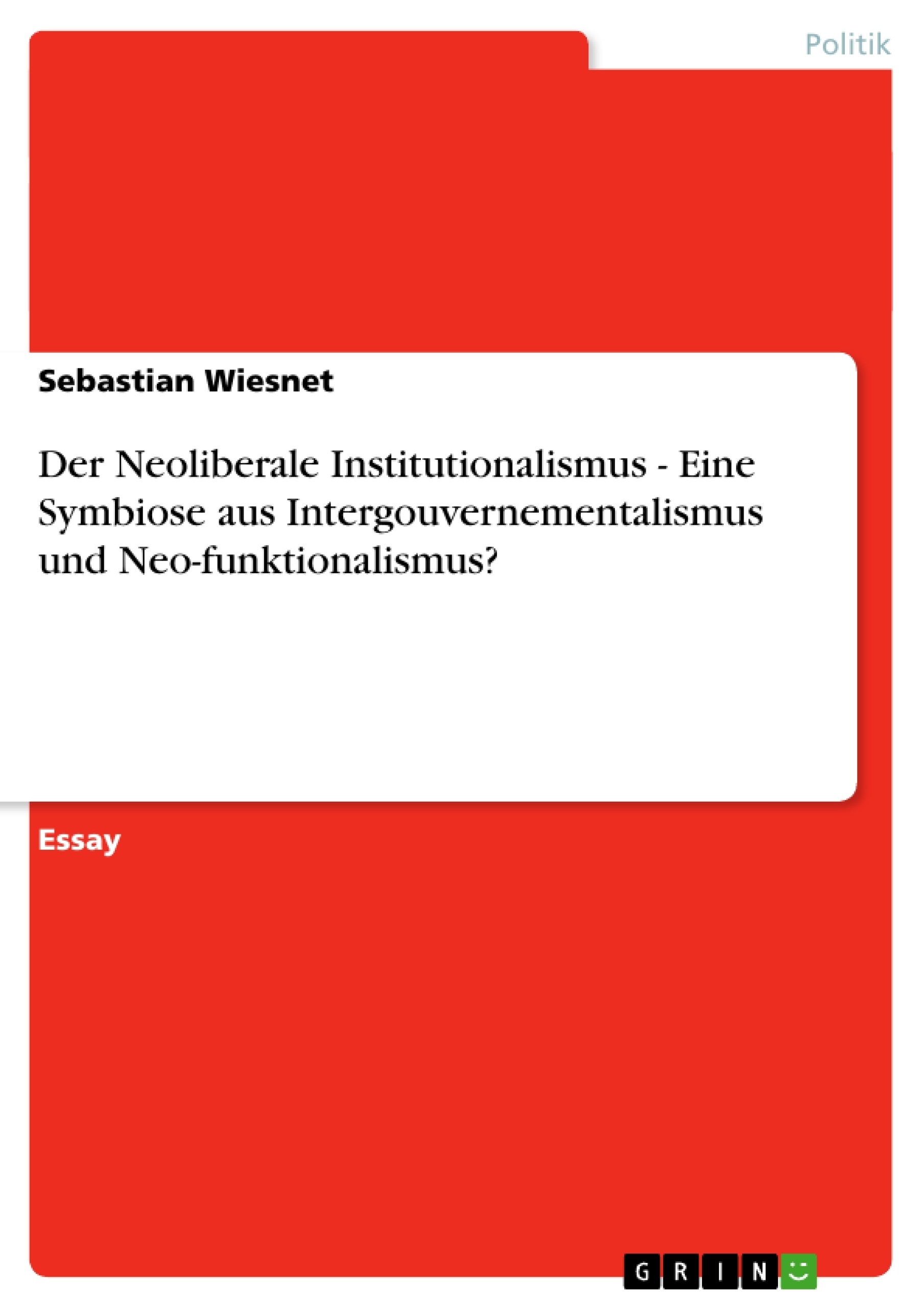Betrachtet man die einzelnen Argumentationsmuster der neoliberalen Integrationstheorie, so stellt man einige Parallelen zum Intergouvernementalismus einerseits und zum Neofunktionalismus andererseits fest. Möchte man Aufschluss über die spezifischen Vor- bzw. Nachteile des Neoinstitutionalismus erhalten, ist es unabdingbar, sowohl die Gemeinsamkeiten mit, als auch die Unterschiede zu den beiden anderen Theorien genauer zu beleuchten. Dabei sollen weniger die einzelnen Theorien detailliert vorgestellt, als vielmehr deren Überschneidungen im Neoinstitutionalismus untersucht werden, um mitunter eine Antwort auf die Frage zu finden, ob man den neoliberalen Institutionalismus als eine Symbiose aus Intergouvernementalismus und Neofunktionalismus auffassen kann.
Hierfür werden zunächst die Charakteristika (Akteure, Motive, Prozess und Milieu) des Neo-institutionalismus anhand der anderen beiden Integrationstheorien hergeleitet, um eine kritische Betrachtung zu ermöglichen.
Richten wir unseren Blick zunächst auf diejenigen Akteure, welche in den einzelnen Theorien als die wichtigsten aufgefasst werden: Der Intergouvernementalismus betont die Bedeutung von Nationalstaaten - genauer gesagt, deren Regierungen. Diese vertreten den jeweiligen nationalen politischen Willen, der sich in innerstaatlichen Willensbildungsprozessen herauskristallisiert hat. In zwischenstaatlichen Verhandlungen versuchen sie, die Sicherheit des jeweiligen Staates in einer anarchischen Staatenwelt zu gewährleisten und dessen Macht zu erhalten. Sind die einzelnen Staaten von politischen und/oder ökonomischen Problemen betroffen, die sich nicht durch unilaterales Handeln lösen lassen, so kann (in zwischen-staatlichen Verhandlungen) die Bildung von Institutionen beschlossen werden. Diese Institutionen erleichtern die zwischenstaatliche Kooperation insofern, da sie einerseits Transaktionskosten reduzieren und dadurch Kooperationsgewinne versprechen, und andererseits die staatlichen Handlungsmöglichkeiten bezüglich eines gemeinsamen Problems erhöhen.
Gleichwohl muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass der Intergouvernementalismus den Institutionen selbst keine große Bedeutung beimisst. Sie sind lediglich zu verstehen als "outcome" von Regierungskonferenzen, quasi als festes Verhandlungsergebnis, welches ausschließlich durch eine erneute Regierungskonferenz eine Veränderung erfahren könnte. Ebenso ist es aus intergouvernementaler Sicht möglich, dass die Institution selbst keine optimale Problemlösung darstellt, da sie von Staaten geschaffen wurde, die aufgrund unterschiedlicher Interessen und Zielen zu einer Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners neigen.
Inhaltsverzeichnis
- Der Neoliberale Institutionalismus - Eine Symbiose aus Intergouvernementalismus und Neofunktionalismus?
- Die Akteure
- Intergouvernementalismus
- Neofunktionalismus
- Neoinstitutionalismus
- Die Motive
- Intergouvernementalismus
- Neofunktionalismus
- Neoinstitutionalismus
- Der Prozess
- Intergouvernementalismus
- Neofunktionalismus
- Neoinstitutionalismus
- Das Milieu
- Intergouvernementalismus
- Neofunktionalismus
- Neoinstitutionalismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieses Essays ist es, den neoliberalen Institutionalismus als Integrationstheorie zu untersuchen und seine Verbindung zu den etablierten Theorien des Intergouvernementalismus und Neofunktionalismus zu beleuchten. Die Untersuchung soll aufzeigen, ob der neoliberale Institutionalismus als Symbiose aus diesen beiden Ansätzen verstanden werden kann.
- Charakteristika des neoliberalen Institutionalismus
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Intergouvernementalismus
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Neofunktionalismus
- Die Rolle von Institutionen im neoliberalen Institutionalismus
- Die Bedeutung strategisch-rationaler Akteure
Zusammenfassung der Kapitel
Dieser Essay untersucht die Eigenschaften des neoliberalen Institutionalismus und vergleicht ihn mit dem Intergouvernementalismus und Neofunktionalismus. Es wird gezeigt, dass der neoliberale Institutionalismus in Bezug auf Akteure, Motive und Prozesse Elemente aus beiden Theorien integriert. Insbesondere wird die Rolle von Institutionen und die Bedeutung strategisch-rationaler Akteure hervorgehoben, die den neoliberalen Institutionalismus von den anderen Theorien abheben.
Schlüsselwörter
Der Essay behandelt die Themen des neoliberalen Institutionalismus, Intergouvernementalismus, Neofunktionalismus, Institutionenbildung, strategisch-rationale Akteure, Integrationstheorien und Europäische Integration.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Neoliberale Institutionalismus eine Symbiose?
Die Arbeit untersucht, ob er als Verbindung aus den Akteuren des Intergouvernementalismus und den Prozessideen des Neofunktionalismus verstanden werden kann.
Was ist der Kern des Intergouvernementalismus?
Er sieht Nationalstaaten und deren Regierungen als Hauptakteure, die durch Verhandlungen ihre nationalen Interessen durchsetzen.
Welche Rolle spielen Institutionen im Neoinstitutionalismus?
Institutionen sind hier entscheidend, da sie Transaktionskosten senken, Kooperation erleichtern und die Erwartungssicherheit zwischen Staaten erhöhen.
Was besagt der Neofunktionalismus?
Er geht davon aus, dass Integration in einem Bereich (z. B. Wirtschaft) zwangsläufig zu Integration in anderen Bereichen führt (Spill-over-Effekt).
Was sind strategisch-rationale Akteure?
Akteure, die ihre Entscheidungen auf Basis von Kosten-Nutzen-Abwägungen treffen, um ihre eigenen Ziele in einer interdependenten Welt bestmöglich zu erreichen.
- Quote paper
- Sebastian Wiesnet (Author), 2003, Der Neoliberale Institutionalismus - Eine Symbiose aus Intergouvernementalismus und Neo-funktionalismus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19810