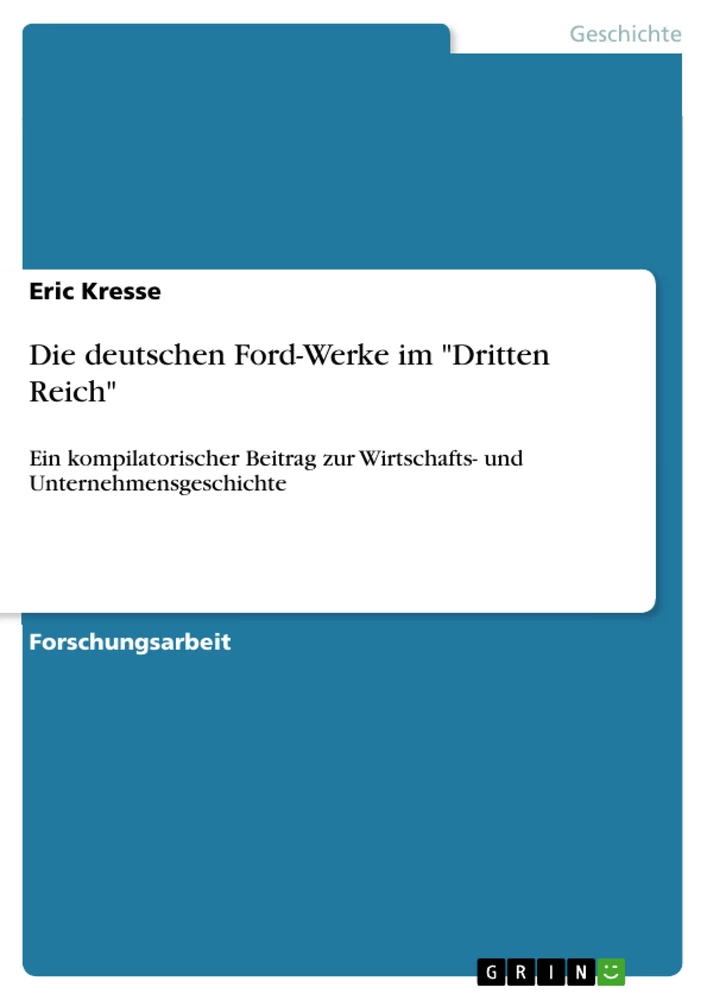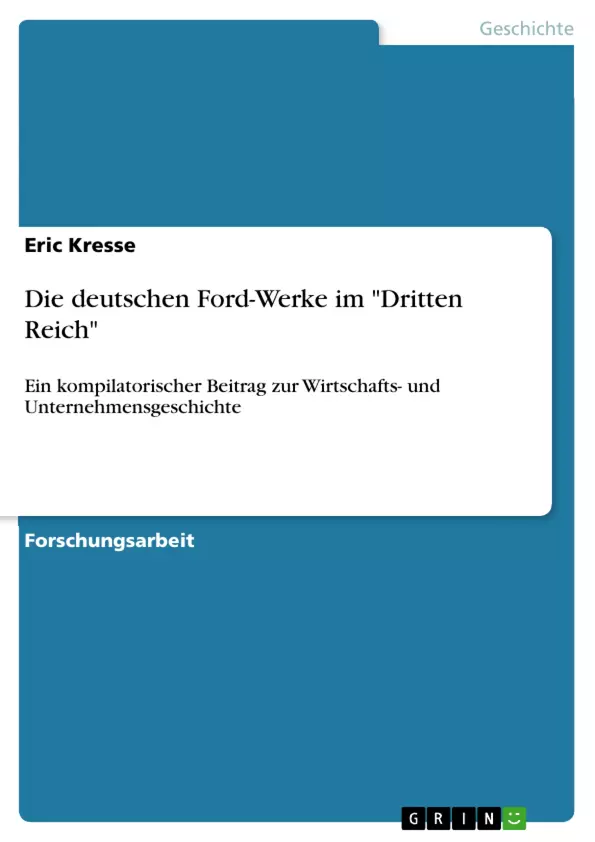Der international etablierte Automobilhersteller Ford Motor Company blickt seit seiner
Gründung in den USA 1903 durch den Ingenieur Henry Ford auf eine ereignis- und
kontrastreiche Firmengeschichte zurück. [...]
Im Nationalsozialismus konnte sich Ford schließlich im Oligopol der Autohersteller
behaupten und sich zu einem bedeutenden (kriegs-)wirtschaftlichen Pfeiler des „Reiches“
entwickeln. Wie eng die Firma dabei mit der Staatsführung verknüpft war, soll diese Arbeit
aufzeigen. Als kompilatorischer Beitrag zur Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte
betrachtet sie eine Epoche, über welche Weltkonzerne noch heute schweigen und die sich
somit nur über Zeitzeugenberichte und betriebswirtschaftliche Daten zusammenfügen lässt.
Dabei wird die Untersuchung von folgenden Fragen geleitet: Welche Motive veranlassten
das Werk, sich mit dem Regime zu arrangieren? Wieso behielt die Tochtergesellschaft eines
US-amerikanischen Konzerns nach dem Kriegseintritt der USA weitestgehend ihre personelle und unternehmerische Unabhängigkeit? Zu welchen Mitteln griff die nach Profit strebende
Geschäftsführung? Und nicht zuletzt: Wie geht Ford heute mit der eigenen Vergangenheit
um?
Bei weitgehend chronologischem Aufbau gliedert sich die Untersuchung in fünf Kapitel. Nach
diesem einleitenden ersten Kapitel folgt die Darstellung des Aufstiegs des deutschen
Unternehmens unter dem Nationalsozialismus bis zum Kriegsausbruch 1939. Wird bereits in
diesem zweiten Kapitel gezeigt, wie sehr sich das Werk in die NS-Industrie einspannen ließ,
verdeutlicht das dritte Kapitel diese Entwicklungstendenz zunächst weiter bis zum
Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 und zeichnet anschließend das Verhalten des
Konzerns sowie die auf Ford bezogene deutsche Politik bis zum Kriegsende nach. Thema des
vierten Kapitels ist die Betrachtung der profitorientierten amerikanischen Ford Motor
Company während des Krieges und nach dessen Ende als auch eine Darlegung deren
Umgangs mit der eigenen NS-Vergangenheit und eventueller Schuld. Schließlich sollen die
Ergebnisse dieser Arbeit im fünften Kapitel zusammengefasst und im Anhang
betriebswirtschaftliche Daten bis einschließlich 1945 abgebildet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Aufstieg während des Nationalsozialismus bis zum Kriegsausbruch 1939
- 3. Ford im Zweiten Weltkrieg
- 3.1. Die Entwicklung der Ford Werke AG, Köln, bis zum Kriegseintritt der USA
- 3.2. Ford Deutschland vom Dezember 1941 bis zum Kriegsende
- 4. Die Ford Motor Company zwischen Schuld und Profit
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verflechtung der deutschen Ford-Werke mit dem NS-Regime. Sie analysiert die Motive des Unternehmens, sich mit dem Regime zu arrangieren, die Aufrechterhaltung der unternehmerischen Unabhängigkeit trotz des Kriegseintritts der USA, die Methoden der Geschäftsführung und den heutigen Umgang Fords mit seiner NS-Vergangenheit. Die Arbeit stützt sich auf betriebswirtschaftliche Daten und Zeitzeugenberichte.
- Der Aufstieg der Ford-Werke im Nationalsozialismus
- Die Rolle der Ford-Werke im Zweiten Weltkrieg
- Die Verbindung zwischen Ford und dem NS-Regime
- Die wirtschaftlichen Strategien von Ford während des Krieges
- Der Umgang von Ford mit seiner NS-Vergangenheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den internationalen Automobilhersteller Ford Motor Company und seine Gründung 1903 vor. Sie beschreibt die Gründung der deutschen Tochtergesellschaft im Jahr 1925 und die anfänglichen Herausforderungen, wie das Einfuhrverbot ausländischer Automobile nach dem Ersten Weltkrieg. Die Einleitung führt die Forschungsfrage ein, die sich mit den Motiven des Werkes für die Zusammenarbeit mit dem NS-Regime, die Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit nach dem Kriegseintritt der USA, die angewandten Methoden der Geschäftsführung und den heutigen Umgang mit der Vergangenheit beschäftigt. Die methodische Herangehensweise, die sich auf betriebswirtschaftliche Daten und Zeitzeugenberichte stützt, wird ebenfalls erläutert, wobei die Aktensperre der Ford Motor Company und das Fehlen einer umfassenden Monografie erwähnt werden. Die Arbeit von Rosellen wird als Hauptquelle genannt, obwohl deren Behandlung sensibler Themen wie Zwangsarbeit als oberflächlich kritisiert wird. Die Bedeutung der Zeitzeugenberichte der Projektgruppe „Messelager“ und die Forschungsliteratur Lindners als Basiswerk werden hervorgehoben.
2. Der Aufstieg während des Nationalsozialismus bis zum Kriegsausbruch 1939: Dieses Kapitel beschreibt den Aufstieg der deutschen Ford-Werke unter dem Nationalsozialismus bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Es wird der Besuch Hitlers auf der Automobilausstellung 1933 und die anschließenden staatlichen Maßnahmen zur Förderung der Motorisierung erwähnt, die zu einem Absatzanstieg bei Automobilen führten. Das Kapitel betont den Wunsch Fords, als „Deutsches Fabrikat“ klassifiziert zu werden, was eine Umstellung auf deutsche Zulieferteile und eine „reinrassig-arische“ Führungsspitze erforderte. Die antisemitischen Ansichten Henry Fords und seine Unterstützung der NSDAP mit Parteispenden werden als wichtiger Kontext hervorgehoben, ebenso wie die Einstellung von Schwarzen, Polen und Ukrainern in den USA aufgrund des dortigen Absatzbooms, was einen Kontrast zu den ideologischen Ansprüchen in Deutschland darstellt. Das Kapitel illustriert, wie das Unternehmen sich strategisch in die NS-Industrie integrierte und von den politischen Maßnahmen profitierte.
Schlüsselwörter
Ford, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Wirtschaftsgeschichte, Unternehmensgeschichte, NS-Regime, Zwangsarbeit, Profit, Propaganda, Antisemitismus, betriebswirtschaftliche Daten, Zeitzeugenberichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Ford und den Nationalsozialismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Verflechtung der deutschen Ford-Werke mit dem NS-Regime. Sie analysiert die Motive des Unternehmens, sich mit dem Regime zu arrangieren, die Aufrechterhaltung der unternehmerischen Unabhängigkeit trotz des Kriegseintritts der USA, die Methoden der Geschäftsführung und den heutigen Umgang Fords mit seiner NS-Vergangenheit.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf betriebswirtschaftliche Daten und Zeitzeugenberichte. Als Hauptquelle wird die Arbeit von Rosellen genannt, deren Behandlung sensibler Themen wie Zwangsarbeit jedoch als oberflächlich kritisiert wird. Die Zeitzeugenberichte der Projektgruppe „Messelager“ und die Forschungsliteratur Lindners spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Der Aufstieg während des Nationalsozialismus bis zum Kriegsausbruch 1939, Ford im Zweiten Weltkrieg (unterteilt in die Entwicklung bis zum Kriegseintritt der USA und die Zeit vom Dezember 1941 bis Kriegsende), Die Ford Motor Company zwischen Schuld und Profit und Zusammenfassung.
Was wird im Kapitel "Der Aufstieg während des Nationalsozialismus bis zum Kriegsausbruch 1939" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den Aufstieg der Ford-Werke unter dem Nationalsozialismus. Es thematisiert Hitlers Besuch 1933, staatliche Fördermaßnahmen, den Wunsch Fords, als „Deutsches Fabrikat“ zu gelten (mit der Folge der Umstellung auf deutsche Zulieferteile und einer „reinrassig-arischen“ Führungsspitze), Henry Fords antisemitische Ansichten und Parteispenden an die NSDAP, sowie den Kontrast zur Einstellung von Schwarzen, Polen und Ukrainern in den USA. Das Kapitel zeigt, wie Ford sich strategisch in die NS-Industrie integrierte.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die Arbeit untersucht die Motive der Zusammenarbeit der Ford-Werke mit dem NS-Regime, die Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit nach dem Kriegseintritt der USA, die angewandten Geschäftsmethoden und den heutigen Umgang mit der NS-Vergangenheit.
Welche methodische Herangehensweise wurde gewählt?
Die Arbeit basiert auf betriebswirtschaftlichen Daten und Zeitzeugenberichten. Die Aktensperre der Ford Motor Company und das Fehlen einer umfassenden Monografie werden als Herausforderungen erwähnt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Ford, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Wirtschaftsgeschichte, Unternehmensgeschichte, NS-Regime, Zwangsarbeit, Profit, Propaganda, Antisemitismus, betriebswirtschaftliche Daten, Zeitzeugenberichte.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die Ford Motor Company und ihre deutsche Tochtergesellschaft vor, beschreibt anfängliche Herausforderungen (Einfuhrverbot nach dem Ersten Weltkrieg) und führt die Forschungsfrage ein. Sie erläutert die methodische Herangehensweise und erwähnt die Aktensperre von Ford und das Fehlen einer umfassenden Monografie, sowie die verwendeten Quellen (Rosellen, Projektgruppe „Messelager“, Lindner).
- Citar trabajo
- Eric Kresse (Autor), 2012, Die deutschen Ford-Werke im "Dritten Reich", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198172