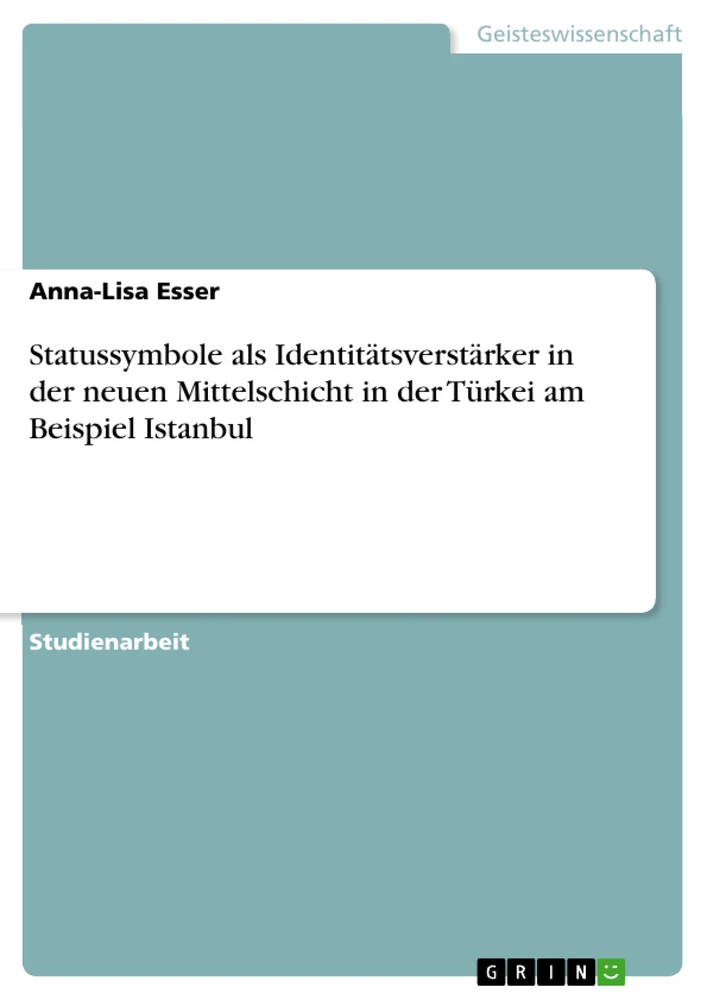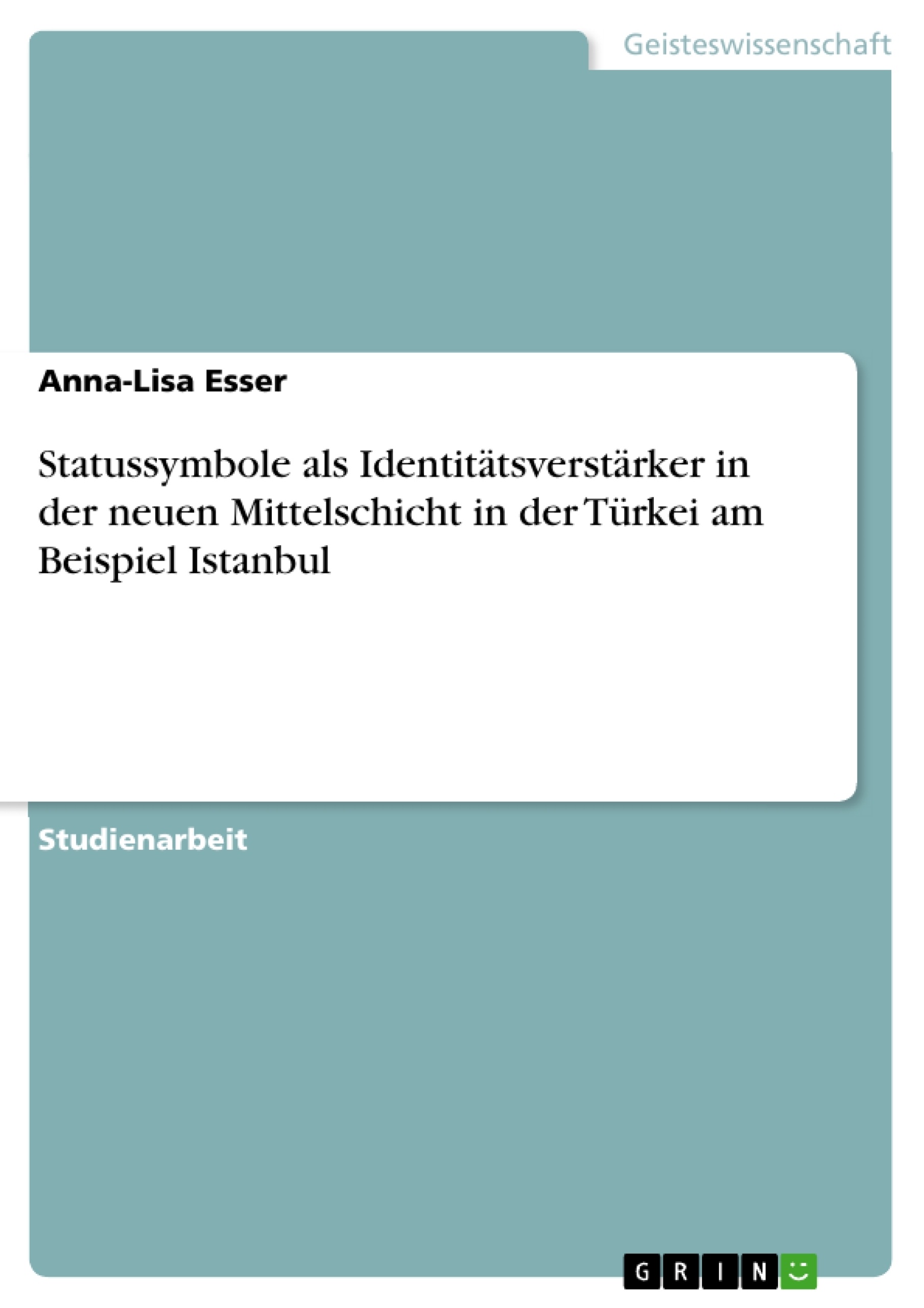In Istanbul fällt recht schnell eine breite sozio-ökonomische Ungleichheit ins Auge: westlich gekleidete, junge Menschen strömen in Konzertsäle, um europäische Musikbands zu sehen, davor verkaufen Migranten aus Anatolien Bier und Wasser. Schuhputzer bieten ihre Dienste in den belebten Einkaufsstraßen der Stadt an, in denen sich eine europäische bzw. amerikanische Markenkette an die andere reiht. Das Straßenbild der Stadt ist geprägt von solchen Gegensätzen.
War das türkische Gesellschaftsgefüge bis in die 90er Jahre vor allem durch die säkulare Elite in den Großstädten und der frommen Landbevölkerung geprägt, so scheint mittlerweile durch Abwanderung in die Großstädte, Öffnung der Märkte, Privatisierungen und den erweiterten Zugang zu Medien eine neue Mittelschicht entstanden zu sein, die westlich orientiert ist, eine bestimmte Geisteshaltung gemein hat, frei von religiösem und nationalistischem Gedankengut ist, also fern der alten Oberschicht und Peripherie. Diese neue gehobene Mittelschicht ist –ganz nach amerikanischem und europäischem Vorbild- in der globalisierten Welt zuhause und hat das mit der neoliberalen Wirtschaftsordnung entstandene Konsumverhalten und auch die dazugehörigen Wertvorstellungen übernommen. Ein Mikrokosmos, der besonders im Istanbuler Stadtteil Cihangir oder den europäisch orientierten Studenten der zahlreichen Privatuniversitäten zu beobachten ist.
In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, wie sich diese neue Mittelschicht herausgebildet hat, wie sich diese in Istanbul präsentiert, ihre Identität gestaltet und sich von den anderen Schichten abgrenzt. Der Fokus meiner Darstellung liegt auf dem Habitus, den Lebensstilen und Statussymbolen dieser Schicht und den Zusammenhängen zwischen diesen und der Identität der Akteure. Durch den begrenzten Umfang der Ausführung sollen die Konzepte des Habitus, Lebensstil und Identität lediglich umrissen und auf die soziale Schichtung in der Türkei im Allgemeinen nicht näher eingegangen werden.
Die Forschungslage zu vorliegendem Thema ist begrenzt, zur Mittelschicht in der Türkei überwiegen Studien, die sich der Problematik zwischen der breiten frommen Peripherie und der zentralen säkularen Elite widmen. In den letzten Jahren sind jedoch einige Arbeiten zur türkischen Gesellschaft im Zusammenhang mit den weltweiten Globalisierungstendenzen entstanden. Besonders hervorzuheben sind hier die Studien von Sencer Ayata, Rıfat N. Bali, Çaĝlar Keyder oder Henry J. Rutz und Erol M. Balkan.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Annäherungen
- Habitus und Lebensstile
- Statussymbole und Konsumverhalten
- Kollektive Identität
- Sozialstrukturelle Veränderungen in der Türkei nach 1980
- Statussymbole, Habitus und Konsumverhalten in der neuen Mittelschicht
- Freizeitverhalten und Umgang mit dem Körper
- Bildung
- Gebrauchsgüter und Wohnen
- Abgrenzung der neuen Mittelschicht durch Statussymbole
- Fazit
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Herausbildung einer neuen Mittelschicht in der Türkei, insbesondere in Istanbul, und untersucht, wie diese Schicht ihre Identität gestaltet und sich von anderen Schichten abgrenzt. Der Fokus liegt dabei auf dem Habitus, den Lebensstilen und Statussymbolen dieser Schicht und deren Zusammenhang mit der Identität der Akteure.
- Die Entstehung und Entwicklung einer neuen Mittelschicht in der Türkei im Kontext der globalen und wirtschaftlichen Veränderungen.
- Die Rolle von Habitus und Lebensstilen als Ausdruck sozialer Position und Identität.
- Die Bedeutung von Statussymbolen und Konsumverhalten für die Abgrenzung und Selbstdefinition der neuen Mittelschicht.
- Die Anwendung von Bourdieus Konzepten auf die türkische Gesellschaft und die Analyse der sozialen Schichtung.
- Die Frage, inwieweit Statussymbole und Konsumverhalten zur Identität der neuen Mittelschicht beitragen und als Identitätsverstärker dienen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Problematik der sozialen Schichtung in Istanbul dar und zeigt die Herausbildung einer neuen, westlich orientierten Mittelschicht im Kontext der Globalisierung. Die Arbeit soll untersuchen, wie diese Schicht sich von anderen Schichten abgrenzt und ihre Identität gestaltet.
- Begriffliche Annäherungen: Dieses Kapitel erläutert die Konzepte von Habitus, Lebensstilen und Statussymbolen nach Pierre Bourdieu. Der Habitus wird als ein System von Dispositionen beschrieben, das sowohl die Produktion von Praktiken als auch die Wahrnehmung und Anerkennung von Praktiken im sozialen Raum beeinflusst.
- Sozialstrukturelle Veränderungen in der Türkei nach 1980: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über die Entwicklung der türkischen Gesellschaft seit den 90er Jahren, die durch Abwanderung, Öffnung der Märkte, Privatisierungen und den erweiterten Zugang zu Medien geprägt war.
- Statussymbole, Habitus und Konsumverhalten in der neuen Mittelschicht: Dieses Kapitel beleuchtet Statussymbole, Lebensstile und das Konsumverhalten der neuen Mittelschicht in Istanbul anhand von Beispielen. Es wird untersucht, wie Bourdieus empirische Studie „Die feinen Unterschiede“ auf die türkische Gesellschaft angewandt werden kann.
- Abgrenzung der neuen Mittelschicht durch Statussymbole: Dieses Kapitel geht der Frage nach, inwieweit Statussymbole und Konsumverhalten zur Identität der neuen Mittelschicht beitragen und als Identitätsverstärker dienen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der vorliegenden Arbeit sind Habitus, Lebensstile, Statussymbole, Konsumverhalten, soziale Schichtung, neue Mittelschicht, Türkei, Istanbul, Bourdieu.
Häufig gestellte Fragen
Was charakterisiert die "neue Mittelschicht" in Istanbul?
Die neue Mittelschicht ist westlich orientiert, globalisiert, neoliberal geprägt und grenzt sich durch spezifisches Konsumverhalten von der traditionellen Elite und der religiösen Peripherie ab.
Welche Rolle spielen Statussymbole für diese Schicht?
Statussymbole dienen als Identitätsverstärker und Werkzeuge der sozialen Abgrenzung, um die Zugehörigkeit zur gehobenen, westlich geprägten Klasse zu demonstrieren.
Wie wird Bourdieus Konzept des Habitus in der Arbeit angewendet?
Der Habitus wird als System von Dispositionen genutzt, um zu erklären, wie Lebensstile und Konsumpräferenzen die soziale Position im Istanbuler Raum widerspiegeln.
Welche Stadtteile Istanbuls sind beispielhaft für diesen Mikrokosmos?
Besonders im Stadtteil Cihangir lässt sich die Lebensweise dieser neuen Schicht sowie der europäisch orientierten Studenten von Privatuniversitäten beobachten.
Welche sozio-ökonomischen Veränderungen gab es in der Türkei nach 1980?
Die Öffnung der Märkte, Privatisierungen und der erweiterte Medienzugang führten zur Entstehung dieser neuen Schicht fernab der alten säkularen Elite.
- Citation du texte
- Anna-Lisa Esser (Auteur), 2011, Statussymbole als Identitätsverstärker in der neuen Mittelschicht in der Türkei am Beispiel Istanbul, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198253