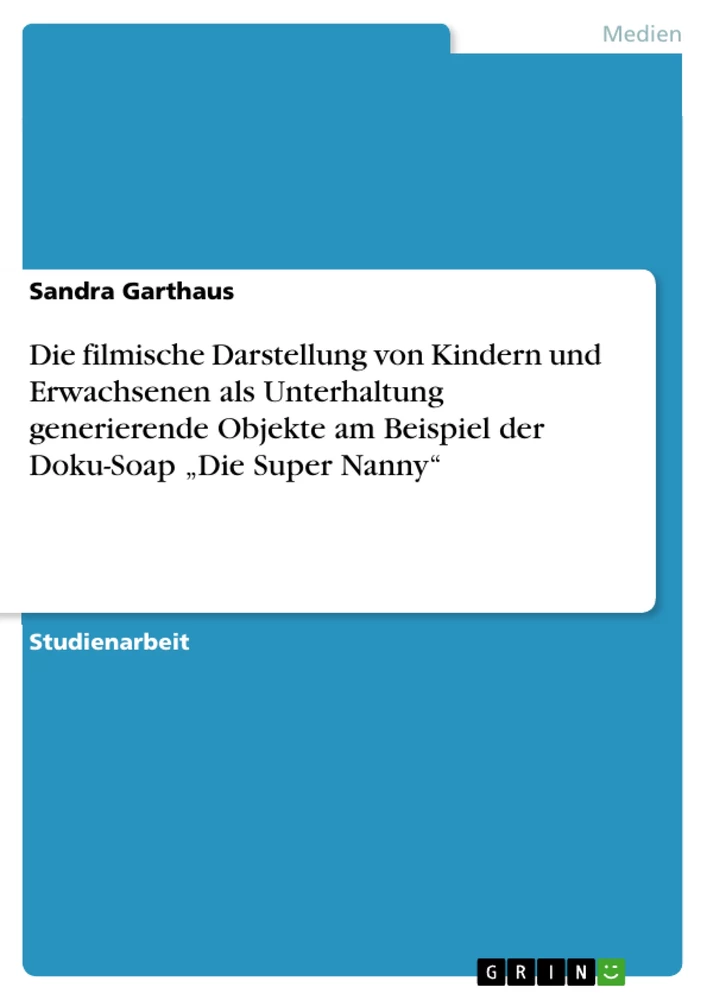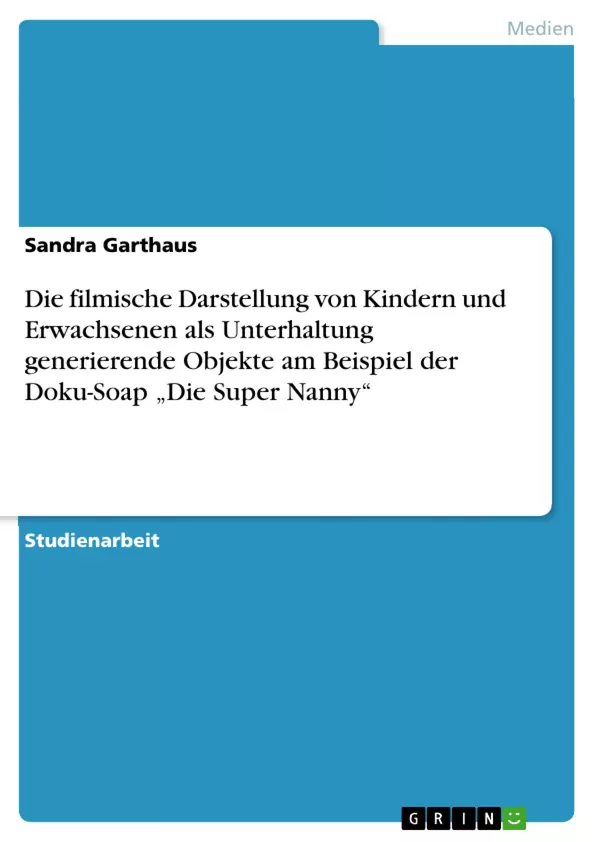1. Einleitung
Das Fernsehen, das einst das Fenster zur Welt darstellte, hat sich durch das Aufkommen des Reality TV zum Fenster in das Privatleben gewandelt. Ein Trend, der sich seit den 90er Jahren stetig fortsetzt und aus dem heutigen Fernsehprogramm nicht mehr wegzudenken ist. Privates und Intimes wird öffentlich gemacht.
Wie das nachfolgende Kapitel zeigen wird, handelt es sich bei dem Begriff „Reality TV“ um eine sehr vielschichtige Fernsehgattung, die Anlass für rege Diskussionen unter Medienwissenschaftlern gab. Die Darstellung der Menschen im Fernsehen gilt bei der Reality TV als zentrales Problem. Vor allem dann, wenn es sich wie bei dem Format
‚Die Super Nanny’ auch um Kinder handelt, bei denen die Zustimmung der Eltern reicht, sie im Fernsehen zu zeigen. Der bedeutendste Kritikpunkt ist bei Reality TV die Missachtung der Menschenwürde. Dem Grundgesetz zu Folge ist die Würde des Menschen unantastbar. Ein Mensch darf nicht als Sache, unmenschlich und entwürdigend behandelt werden (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung; Lexikon 2006). Die ‚Die Super Nanny’- Sendungen kann man jedoch als Menschenversuche
bezeichnen, denn die Menschen, die weder prominent noch Schauspieler sind, werden in ihrem Alltag von Kameras begleitet. Menschenversuche sind Experimente mit Freiwilligen. In diesen wird die Versuchsperson als Objekt betrachtet. Im Falle der zu untersuchenden Doku Soap ‚Die Super Nanny’ stellen die Familien, aber vor allem die Kinder, die Versuchspersonen dar. Es handelt sich um ein Erziehungsexperiment. ‚Die Super Nanny’ berät in Erziehungsfragen und gibt Tipps, die dann von der Familie umgesetzt werden sollen. Die Kinder nehmen in dieser Sendung eine besondere Rolle ein: Im Großen und Ganzen geht es um den Versuch, sie und ihr Umfeld zu erziehen.
In der vorliegenden Arbeit wird eine filmanalytische Untersuchung einer Folge von ‚Die Super Nanny’ durchgeführt. Das Erkenntnisinteresse dieser Untersuchung ist es herauszuarbeiten, wie die Kinder und Erwachsenen der jeweiligen Familie mit filmischen Mitteln als Unterhaltung-generierende Objekte dargestellt werden. Hierbei werden sowohl Inhalt und narrative Struktur, als auch die filmische Darstellung durch Einstellungsgrößen, -perspektiven und die Tonebene untersucht. Einen weiteren Aspekt stellt die Kamerapräsenz da, die für das Verhalten der Menschen eine wesentliche Rolle spielt. Ein Sequenzprotokoll soll die Dramaturgie der ‚Die Super Nanny’ - Folge verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Reality TV - eine Begriffsbestimmung
- Der Untersuchungsgegenstand: Die Super Nanny
- Das Sendekonzept
- Katharina Saalfrank
- Der Sendeablauf
- Filmanalytische Untersuchung
- Inhalt und narrative Struktur
- Die filmische Darstellungsweise
- Die Kamerapräsenz und das foucaultsche Panoptikum
- Bewertung der Gestaltung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die filmische Darstellung von Kindern und Erwachsenen in der Doku-Soap „Die Super Nanny“ und analysiert, wie diese als unterhaltungsgenerierende Objekte inszeniert werden. Ziel ist es, die filmischen Mittel aufzuzeigen, die zur Erzeugung von Unterhaltung eingesetzt werden und die ethischen Fragen im Kontext der Menschenwürde zu beleuchten.
- Definition und Charakteristika von Reality TV
- Analyse des Sendekonzepts von „Die Super Nanny“
- Filmanalytische Untersuchung der Darstellungsweise von Kindern und Erwachsenen
- Die Rolle der Kamerapräsenz und ihr Einfluss auf das Verhalten der Teilnehmer
- Ethische Bewertung der Sendung im Hinblick auf die Menschenwürde
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung vor: Wie werden Kinder und Erwachsene in der Doku-Soap „Die Super Nanny“ filmisch als unterhaltungsgenerierende Objekte dargestellt? Sie verortet Reality-TV als einen gesellschaftlichen Trend, der die Privatsphäre in den öffentlichen Raum verlagert und ethische Fragen aufwirft, insbesondere im Kontext der Menschenwürde, besonders wenn Kinder involviert sind. Die Arbeit kündigt eine filmanalytische Untersuchung einer Folge von „Die Super Nanny“ an, die sich auf Inhalt, narrative Struktur, filmische Darstellung und Kamerapräsenz konzentriert.
Reality TV - eine Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Reality TV“ und beschreibt ihn als eine vielschichtige Fernsehgattung des Unterhaltungsfernsehens, die sich durch die Vermischung von Fiktion und Dokumentation auszeichnet. Es beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen und den Wandel des Begriffs im Laufe der Zeit. Der Fokus liegt auf der Kritik an Reality-TV aufgrund ethischer und moralischer Bedenken hinsichtlich der Menschenwürde und der Verwendung von Affektstrategien zur Bindung des Publikums. Der Begriff wird im Kontext des Unterhaltungsfernsehens und im Gegensatz zum Bildungsfirnsehen erläutert.
Der Untersuchungsgegenstand: Die Super Nanny: Dieses Kapitel beschreibt die Doku-Soap „Die Super Nanny“ als Untersuchungsgegenstand. Es stellt das Sendekonzept, die Rolle von Katharina Saalfrank und den typischen Sendeablauf vor. Die Darstellung der Familien, insbesondere der Kinder, als „Versuchspersonen“ in einem Erziehungsexperiment wird hervorgehoben, und die damit verbundenen ethischen Fragen werden angedeutet. Die Bedeutung des Formats und sein Kontext innerhalb des Genres der Reality-TV-Sendungen wird erläutert.
Schlüsselwörter
Reality TV, Doku-Soap, Die Super Nanny, Filmanalyse, Kinder, Erwachsene, Unterhaltung, Inszenierung, Kamerapräsenz, Menschenwürde, Ethik, Affektfernsehen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von "Die Super Nanny"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die filmische Darstellung von Kindern und Erwachsenen in der Doku-Soap „Die Super Nanny“. Der Fokus liegt darauf, wie diese als unterhaltungsgenerierende Objekte inszeniert werden und welche filmischen Mittel dabei eingesetzt werden. Ethische Fragen im Kontext der Menschenwürde werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Charakteristika von Reality TV, Analyse des Sendekonzepts von „Die Super Nanny“, filmanalytische Untersuchung der Darstellungsweise von Kindern und Erwachsenen, die Rolle der Kamerapräsenz und ihr Einfluss auf das Verhalten der Teilnehmer sowie eine ethische Bewertung der Sendung im Hinblick auf die Menschenwürde.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Reality TV - eine Begriffsbestimmung, Der Untersuchungsgegenstand: Die Super Nanny (inkl. Sendekonzept, Katharina Saalfrank und Sendeablauf), Filmanalytische Untersuchung (inkl. Inhalt und narrative Struktur, filmische Darstellungsweise, Kamerapräsenz und das foucaultsche Panoptikum, Bewertung der Gestaltung) und Fazit.
Wie wird „Die Super Nanny“ in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht „Die Super Nanny“ mittels einer Filmanalyse. Diese konzentriert sich auf den Inhalt, die narrative Struktur, die filmische Darstellungsweise und die Kamerapräsenz. Die Analyse zielt darauf ab, die Inszenierung von Kindern und Erwachsenen als unterhaltungsgenerierende Objekte aufzuzeigen.
Welche Fragestellung steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Fragestellung lautet: Wie werden Kinder und Erwachsene in der Doku-Soap „Die Super Nanny“ filmisch als unterhaltungsgenerierende Objekte dargestellt?
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Reality TV, Doku-Soap, Die Super Nanny, Filmanalyse, Kinder, Erwachsene, Unterhaltung, Inszenierung, Kamerapräsenz, Menschenwürde, Ethik, Affektfernsehen.
Welche ethischen Aspekte werden berücksichtigt?
Die Arbeit beleuchtet die ethischen Fragen im Kontext der Menschenwürde, insbesondere in Bezug auf die Darstellung von Kindern in der Sendung. Die Verwendung von Affektstrategien zur Bindung des Publikums und die mögliche Beeinträchtigung der Privatsphäre der Teilnehmer werden kritisch betrachtet.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die filmischen Mittel aufzuzeigen, die zur Erzeugung von Unterhaltung in „Die Super Nanny“ eingesetzt werden, und die ethischen Fragen im Kontext der Menschenwürde zu beleuchten.
- Quote paper
- Sandra Garthaus (Author), 2009, Die filmische Darstellung von Kindern und Erwachsenen als Unterhaltung generierende Objekte am Beispiel der Doku-Soap „Die Super Nanny“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198282