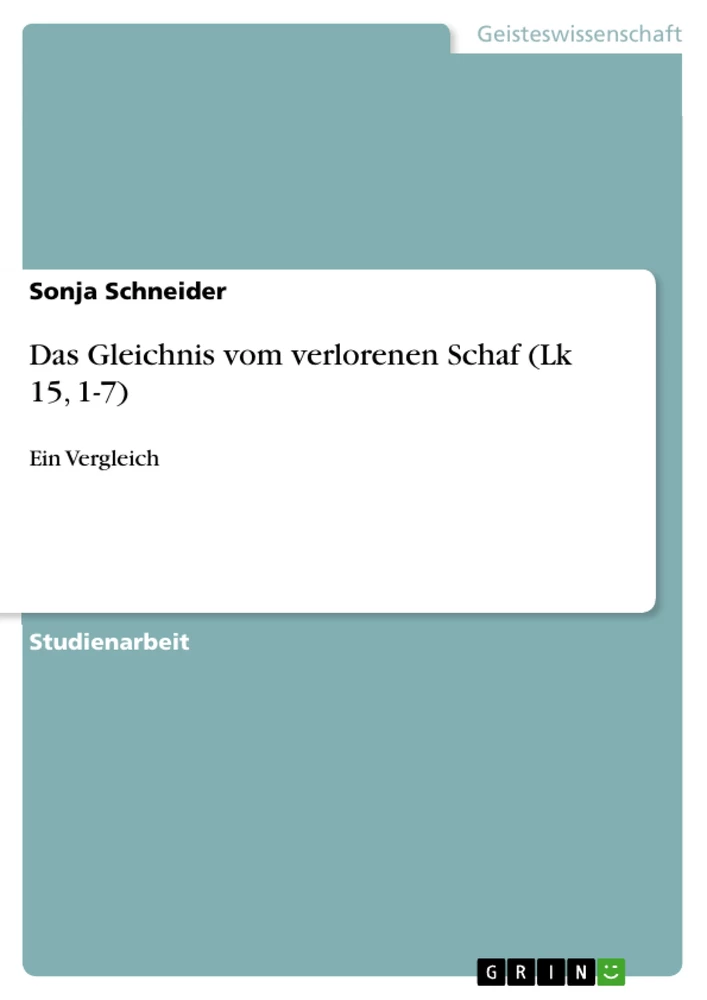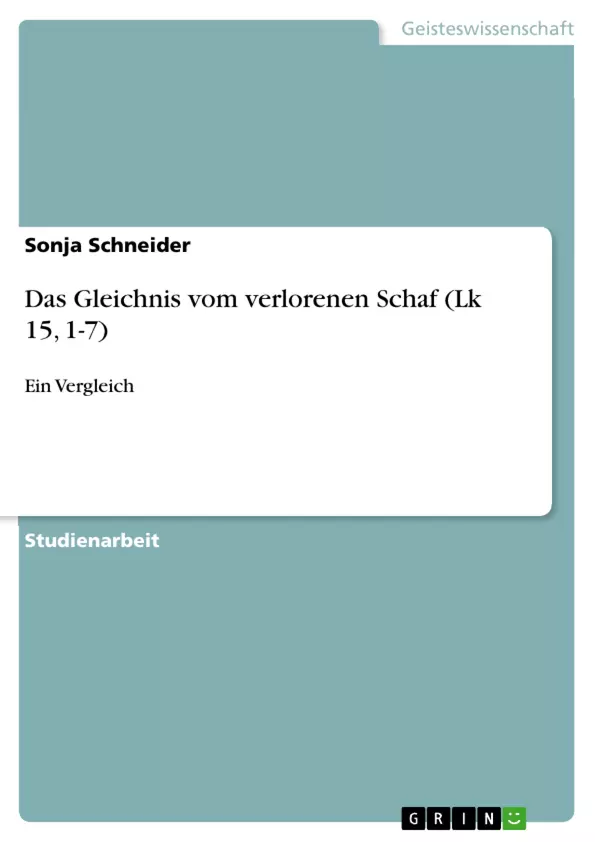Das Gleichnis vom verlorenen Schaf ist eine bei Kindern beliebte Bibelstelle. Diese Erfahrung habe ich persönlich sowohl bei der Gestaltung von Kindergottesdiensten als auch im Religionsunterricht in der Primar- und Sekundarstufe gemacht. Doch warum ist das so und was verbirgt sich genau hinter diesem Gleichnis?
Die vorliegende Arbeit soll das Gleichnis vom verlorenen Schaf nach Lukas durch Vergleiche mit anderen Bibelstellen genauer erläutern und die Intention des Gleichnisses in seinem jeweiligen Kontext darlegen.
Dazu werden zunächst die Grundlagen zum Thema geklärt und dargestellt. Dabei wird zuerst die Gattung „Gleichnis“ definiert, bzw. untersucht, wie sich diese Definition im Laufe der Zeit
weiterentwickelt hat. Darauf folgt die inhaltliche Gliederung des Gleichnisses vom verlorenen Schaf, also das Nachgehen der Frage „Um was geht es im Gleichnis überhaupt und welches Thema wird behandelt?“. Den Abschluss des ersten Abschnitts bildet die Realienabklärung, wodurch die Bedeutung der Begriffe „Schaf“ und „Hirte“ in ihrem Zusammenhang näher beleuchtet werden. Der nächste Teil der Arbeit besteht aus einem synoptischen Vergleich des
Gleichnisses bei Lukas und bei Matthäus und einer Gegenüberstellung vom Gleichnis vom verlorenen Schaf und dem von der verlorenen Drachme. Abschließend werden im letzten Punkt die Intention des Textes und die erwartete Wirkung auf den Zuhörer herausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen
2.1 Definition Gleichnis
2.2 Inhaltliche Gliederung
2.3 Realienabklärung
3. Vergleiche
3.1 Synoptischer Vergleich: Lk 15, 1-7 und Mt 18, 12-14
3.2 Gleichnis von der verlorenen Drachme (Lk 15, 8-10)
4. Intention
5. Schluss
6. Literaturverzeichnis
7. Anhang
- Quote paper
- Sonja Schneider (Author), 2012, Das Gleichnis vom verlorenen Schaf (Lk 15, 1-7), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198414