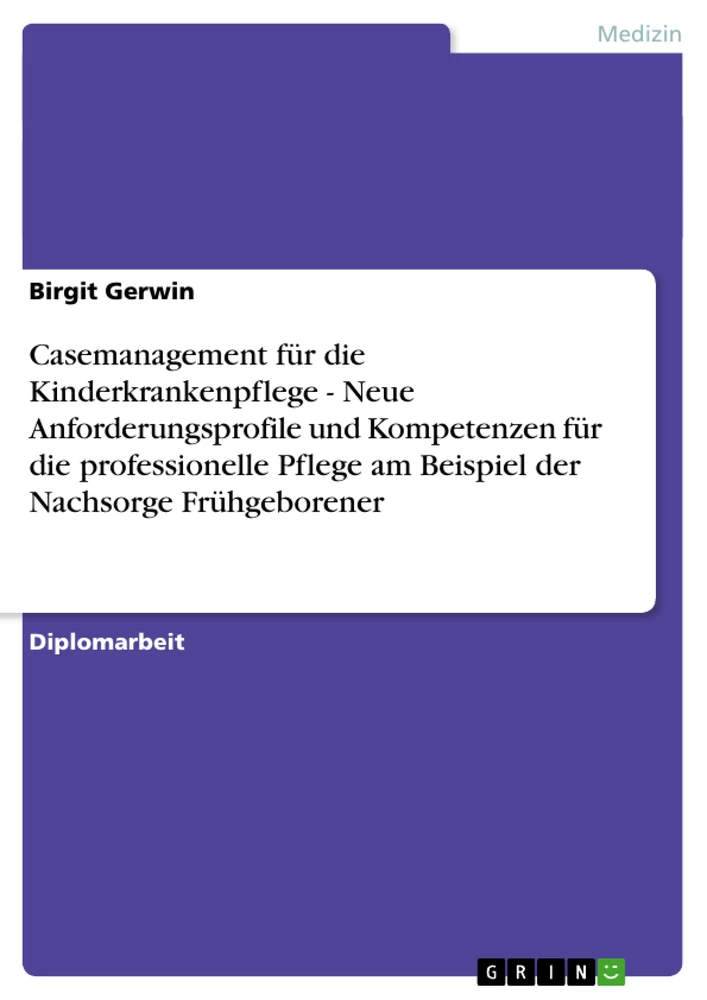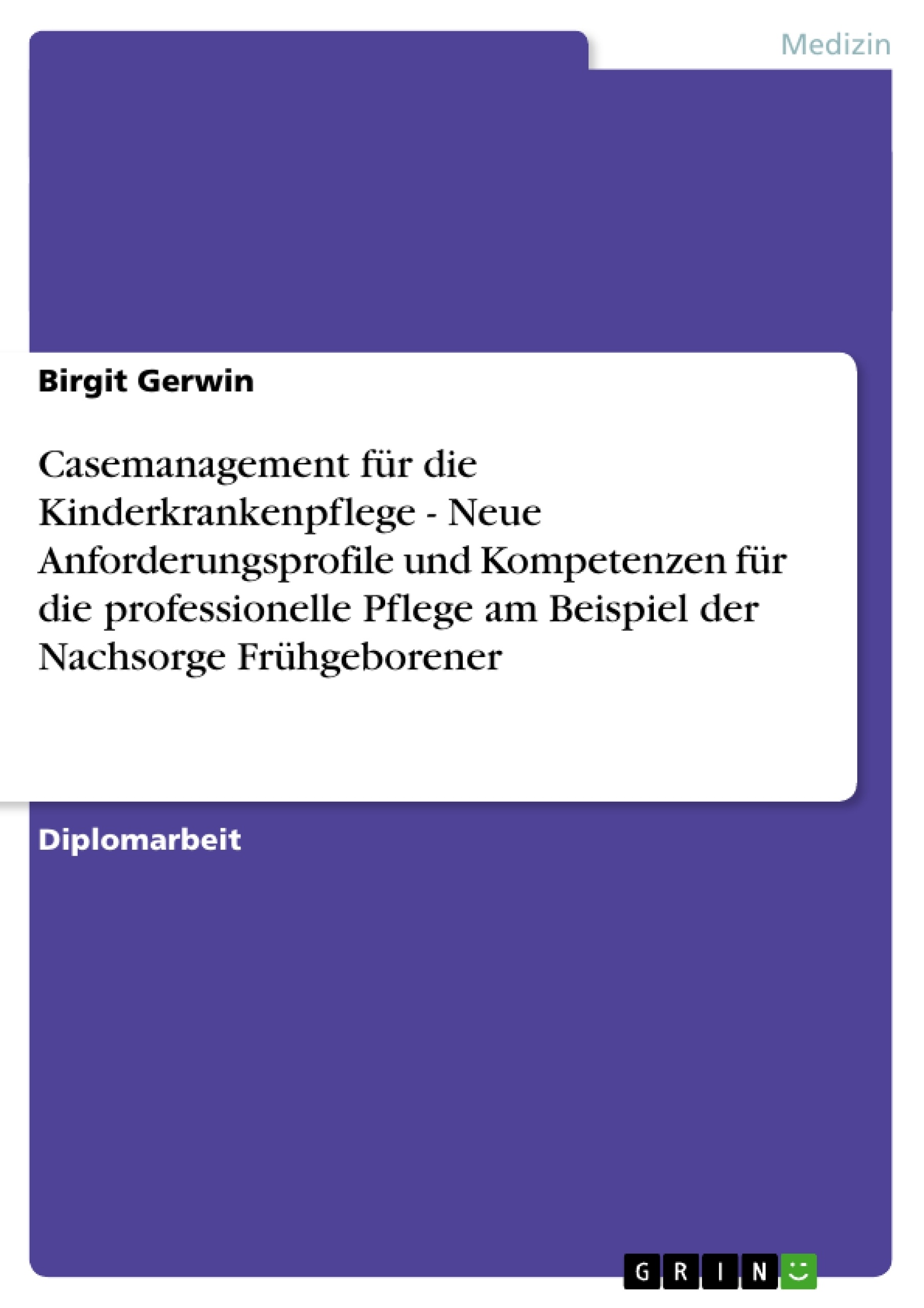Durch den im Moment viel diskutierten Kostendruck im Gesundheitswesen
und die immer im Raum stehenden Beitragserhöhungen in unsere
gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) wird es jedem interessierten
Mitbürger klar sein, dass unser Gesundheitssystem als solches krankt.
Es leidet an einer schleichenden Erkrankung mit vielen Symptomen, die es
nach ausreichender, grundlegender Diagnosestellung zu therapieren gilt.
Leider scheint es im Moment aber so, dass keiner der an der
Diagnosestellung beteiligten Professionals eine schlüssige Diagnose,
geschweige denn, einen von allen Angehörigen des therapeutischen Teams
akzeptierten Therapieplan aufstellen kann, der darüber hinaus auch noch
eine hohe Wahrscheinlichkeit zur Heilung des Patienten zulässt.
Ein gemeinsamer Nenner aller Professionals im therapeutischen Team
bezüglich der Maßnahmen zur Zielerreichung der Homöostase des
Patienten, unseres alternden Gesundheitswesens, ist jedoch zu finden: es
muss effizienter gearbeitet, rationalisiert werden. Gleichzeitig soll die Qualität
bestehen bleiben, bzw. erhöht werden und die Kostenschraube im Minimum
blockiert, besser noch heruntergeschraubt werden. Dieses umfassende,
globale Ziel können alle Beteiligten so und/ oder mit kleinen Abweichungen
formulieren. Schwierig wird es für die am Genesungsprozess des
Gesundheitswesens Beteiligten bei der Aufstellung des Maßnahmen- bzw.-
Therapieplans. Denn dieser verlangt mehr Zielgenauigkeit von den
Leistungserbringern. Um diese jedoch erbringen zu können, muss die
gesamte Arbeitsweise einer eingehenden Untersuchung unterzogen werden.
Eine Möglichkeit den Therapieplan unseres Patienten zu optimieren, liegt in
der Anwendung der fallbezogenen Steuerung der Behandlungspläne der
Leistungsnehmer/ Patienten. Mit dem Casemanagement (CM) steht dem
therapeutischen Team eine individuelle Unterstützungs- und
Handlungsmöglichkeit für den einzelnen Leistungsnehmer zur Verfügung.
Hierdurch ist es möglich, die Lebensqualität jedes einzelnen Patienten zu berücksichtigen, seine ureigensten Bedürfnisse und Interessen von einem
“Anwalt des Patienten“; dem Casemanager (CMer), zu vertreten und
gleichzeitig durch Vernetzung und Synergieeffekte mehr Effizienz in das
Versorgungssystem zu bringen. Da diese Funktion der Anwaltschaft schon
jeher zu dem Aufgabengebiet der Pflegenden gehört, ist diese
Therapiemaßnahme natürlich auch in dem Kompetenzbereich der Pflege zu
diskutieren und zu implementieren. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung der Arbeit
- Situationsanalyse
- Zur Situation des deutschen Gesundheitswesen
- Versorgungssituation von Kindern im dtsch. Gesundheitswesen
- Erwartung der Eltern /Angehörigen
- Beurteilung des Pflege -und Beratungsbedarfs betroffener Familien aus Sicht ambulanter Kinderkrankenpflegekräfte
- Entwicklungstrends wichtiger interner Einflussgrößen des Anwendungsgebietes
- Neonatologie
- Kinderkrankenpflege im Bereich der Neonatologie
- Ambulante Kinderkrankenpflege
- Fazit
- Theoretischer Rahmen
- Pflegemodell von Dorothea Orem
- 1. Die Selbstpflege/ Dependenzpflege
- 2. Das Selbstpflegedefizit/ Dependenzpflegedefizit
- 3. Die Pflegesysteme
- Trajektory Work Modell von Corbin und Strauss
- Konzept der sanften Pflege von Marina Marcovich
- Pflegemodell von Dorothea Orem
- Casemanagement
- Einführung
- Grundlagen
- Allgemeine Zielsetzung
- Entstehung von Casemanagement
- Stand der Entwicklung
- Methoden der integrativen Gesundheitsversorgung
- Casemanagement Konzepte
- Pflege Casemanagement innerhalb des Krankenhauses bzw. in der Akutversorgung
- Pflege- Casemanagement außerhalb des Krankenhauses bzw. in der Langzeitversorgung
- National
- USA
- Aufgabenbereiche des Casemanagement
- Konzept Casemanagement für die Kinderkrankenpflege
- Zielsetzung des Konzeptes
- Verbesserung der Versorgung von erkrankten Kindern
- Anwendung eines mehrdimensionalen pflegetheoretischen Rahmens
- Anwendung eines individuellen Unterstützungsmodells
- Interdisziplinäre Vernetzung
- Profil eines Casemanagers für erkrankte Kinder
- Kernkompetenzen
- Fort- und Weiterbildung des Casemanagers
- Einsatzort/ Anbindung des Casemanagers
- Hauptelemente von Casemanagement in der Kinderkrankenpflege
- Methodisches Vorgehen
- Erreichung der Kinder/ Zielgruppendefinition
- Zielvereinbarung und Maßnahmenplan
- Einschätzung und Bedarfsklärung
- Kontrollierte Durchführung / Qualitätsmanagement
- Evaluation
- Instrumente
- Etablierung und Handhabung von Netzwerken
- Gespräche
- Regelmäßiger „round table\" /Fallkonferenzen
- Pathways / Ablaufpläne
- Dokumentationsverfahren
- Allgemeine Verwaltungsdokumentation
- Patientenbezogene Dokumentation
- Leistungsbezogene Dokumentation
- Dokumentation des interdisziplinären Netzes
- Methodisches Vorgehen
- Konzept Casemanagement für die Kinderkrankenpflege am Beispiel der Nachsorge Frühgeborener
- Verbesserung der Nachsorge Frühgeborener
- Profil eines Casemanagers für die Nachsorge Frühgeborener
- Ansiedelung des Casemanagers
- Abstimmung der Vernetzung
- Rekrutierung der betroffenen Familien
- Ablaufsteuerung der einzelnen Fälle
- Zusammenfassung und Ausblick
- Qualität und Casemanagement
- Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit
- Casemanagement als Qualitätsprodukt
- Casemanagement und Rationalisierung
- Casemanagement und Politik
- Casemanagement und Professionalisierung
- Qualität und Casemanagement
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Casemanagement für die Kinderkrankenpflege am Beispiel der Nachsorge von Frühgeborenen. Ziel der Arbeit ist es, die neuen Anforderungsprofile und Kompetenzen für die professionelle Pflege im Kontext von Casemanagement zu untersuchen.
- Entwicklung des Casemanagement in der Kinderkrankenpflege
- Anforderungen an das Profil eines Casemanagers für erkrankte Kinder
- Methodisches Vorgehen im Casemanagement für die Kinderkrankenpflege
- Anwendung des Casemanagementkonzepts in der Nachsorge von Frühgeborenen
- Bedeutung von Qualität und Professionalisierung im Kontext von Casemanagement
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Hintergrund und die Relevanz des Themas Casemanagement für die Kinderkrankenpflege beleuchtet. Anschließend wird die Zielsetzung der Arbeit erläutert.
Kapitel 3 führt in die Situationsanalyse ein, die die Situation des deutschen Gesundheitswesens und die Versorgungssituation von Kindern im deutschen Gesundheitswesen beleuchtet. Im Weiteren werden die Erwartungen der Eltern und Angehörigen sowie die Beurteilung des Pflege- und Beratungsbedarfs aus Sicht ambulanter Kinderkrankenpflegekräfte dargestellt. Die Analyse umfasst auch die Entwicklungstrends wichtiger interner Einflussgrößen des Anwendungsgebietes, insbesondere in der Neonatologie und der Kinderkrankenpflege im Bereich der Neonatologie. Die Analyse schließt mit einem Fazit ab.
Kapitel 4 widmet sich dem theoretischen Rahmen der Arbeit. Es werden das Pflegemodell von Dorothea Orem, das Trajektory Work Modell von Corbin und Strauss sowie das Konzept der sanften Pflege von Marina Marcovich vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf den relevanten Aspekten für das Casemanagement in der Kinderkrankenpflege.
In Kapitel 5 wird das Konzept des Casemanagements ausführlich behandelt. Es werden die Grundlagen, die allgemeine Zielsetzung und die Entstehung von Casemanagement erläutert. Der Stand der Entwicklung von Casemanagement in Deutschland und den USA wird im Detail dargestellt.
Kapitel 6 präsentiert das Konzept des Casemanagements für die Kinderkrankenpflege. Es werden die Zielsetzung des Konzeptes, das Profil eines Casemanagers für erkrankte Kinder und die Hauptelemente des Casemanagement in der Kinderkrankenpflege erläutert.
Kapitel 7 beschäftigt sich mit der konkreten Anwendung des Casemanagementkonzepts in der Nachsorge von Frühgeborenen. Es werden die Verbesserung der Nachsorge von Frühgeborenen, das Profil eines Casemanagers für die Nachsorge Frühgeborener, die Ansiedelung des Casemanagers, die Abstimmung der Vernetzung, die Rekrutierung der betroffenen Familien und die Ablaufsteuerung der einzelnen Fälle diskutiert.
Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick, der die Bedeutung von Qualität und Casemanagement, die Rationalisierung, die Politik und die Professionalisierung im Kontext des Casemanagements beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schwerpunktthemen Casemanagement, Kinderkrankenpflege, Nachsorge Frühgeborener, Anforderungsprofile, Kompetenzen, professionelle Pflege, Gesundheitswesen, Versorgungssituation, interdisziplinäre Vernetzung, Qualitätsmanagement, Professionalisierung, Evaluation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Casemanagement in der Kinderkrankenpflege?
Es ist eine fallbezogene Steuerung der Behandlungspläne, die eine individuelle Unterstützung und Vernetzung für den Patienten und seine Familie sicherstellt.
Warum ist Casemanagement für Frühgeborene besonders wichtig?
Frühgeborene benötigen nach der Klinikentlassung eine komplexe Nachsorge, die durch Casemanagement koordiniert wird, um die Lebensqualität der Familie zu sichern.
Welche Kompetenzen benötigt ein Casemanager in diesem Bereich?
Neben pflegerischem Fachwissen sind Beratungskompetenz, Organisationsgeschick und Kenntnisse in der interdisziplinären Vernetzung erforderlich.
Was ist das "Trajektory Work Modell" von Corbin und Strauss?
Es beschreibt den Verlauf chronischer Krankheiten und hilft Pflegenden, die verschiedenen Phasen und Anforderungen der Krankheitsbewältigung zu steuern.
Wie trägt Casemanagement zur Kosteneffizienz im Gesundheitswesen bei?
Durch Synergieeffekte und die Vermeidung von Doppeluntersuchungen oder unnötigen Klinikaufenthalten können Kosten gesenkt und die Qualität gesteigert werden.
- Zielsetzung des Konzeptes
- Citar trabajo
- Birgit Gerwin (Autor), 2003, Casemanagement für die Kinderkrankenpflege - Neue Anforderungsprofile und Kompetenzen für die professionelle Pflege am Beispiel der Nachsorge Frühgeborener, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19849