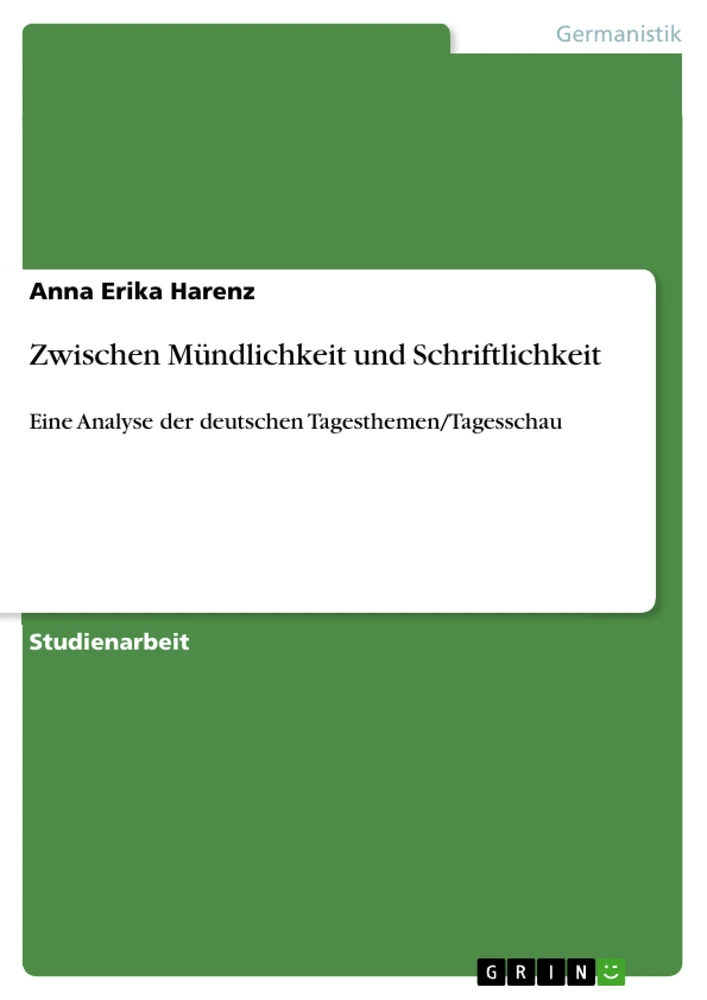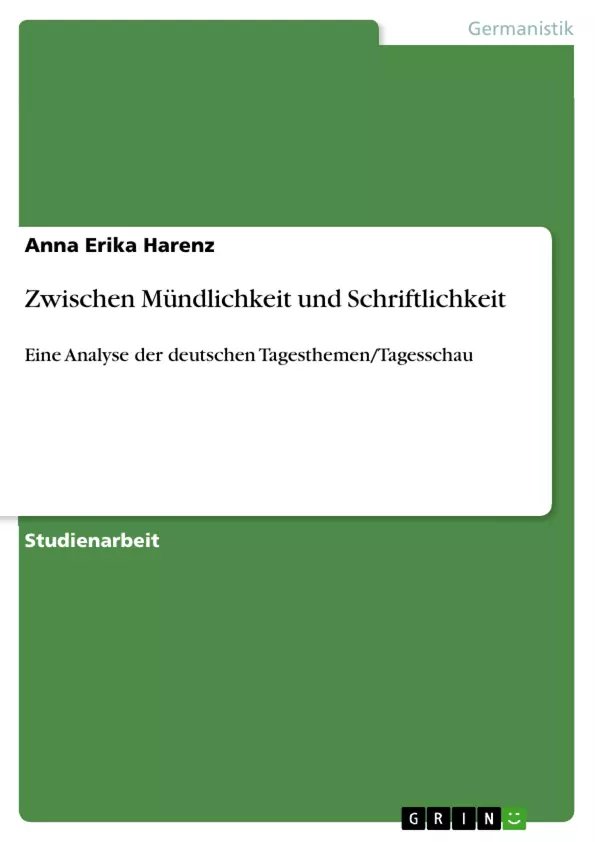Einleitung
Die Sprache ist das wichtigste Kommunikationsmittel der Menschen. Die
Realisierungsmöglichkeiten der menschlichen Sprache erscheinen in zwei verschiedenen medialen Ausprägungen. Einerseits als gesprochene, andererseits als geschriebene Sprache. Während Laute akustisch mit dem Ohr wahrgenommen werden, geschieht dies in Hinblick auf Schriftzeichen optisch mit dem Auge.
.
.
.
In der Sprachwissenschaft versteht man unter den Termmini ‚gesprochene'/'mündlich' und ‚geschriebene'/'schriftlich' vielfach einzig die Art der materiellen Realisierung sprachlicher Äußerungen. Dies bedeutet entweder eine Manifestation in Form von Lauten (phonisch), oder von Schriftzeichen (graphisch). Dieses Unterscheidungsmerkmal ist in der Praxis jedoch meist nicht ausreichend. Es kann durchaus sowohl zu einer phonisch realisierten Äußerung, die allgemein nicht der Vorstellung von ‚Mündlichkeit" entspricht (Nachrichten, Predigt etc.), als auch zu einer graphisch realisierten Äußerung kommen, die wiederum Vorstellung von geschriebener Sprache entspricht. Diese würde dann, wie im
Falle eines Liebesbriefs, nicht mehr unter den Begriff der ‚Schriftlichkeit" fallen.
Im Fokus dieser Arbeit steht eine Untersuchung der Tagesthemen sowie der Tagesschau bzgl. dieser Thematik. Die phonisch realisierten Äußerungen der Nachrichtensprecher werden auf nachweisbare schriftliche Merkmale untersucht. Dadurch soll verdeutlicht werden, dass diese mündlich vorgetragenen Nachrichten ihren Ursprung in der Schriftlichkeit haben. Zusätzlich für diese Arbeit von Relevanz wird sein, nachzuweisen, ob eine der beiden Nachrichtensendungen zur
Schriftlichkeit bzw. Mündlichkeit tendiert. Zunächst werden aber im Folgenden die Merkmale gesprochener und geschriebener Sprache erläutert. Des Weiteren sollen die theoretischen Modelle von Koch/Oesterreicher und Quasthoff beschrieben und anschaulich dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Spannungsfeld von Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- Allgemeine Merkmale gesprochener und geschriebener Sprache
- Einfachheit und „Unvollständigkeit“
- Thema-Rhema-/Rhema-Thema-Abfolge
- Subjektivität/Objektivität
- Spezifische Textkonstitutionen/Frequenzen
- Unterscheidung zwischen medialer und konzeptioneller Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- Das Modell von Koch/Oesterreicher (1985/95)
- Somatische Kommunikation nach Quasthoff (1997)
- Unterschiede zwischen Tagesthemen und Tagesschau
- Hypothese
- Eine Analyse der Tagesthemen und der Tagesschau
- Elemente von Schriftlichkeit in der Tagesschau
- Elemente von Schriftlichkeit in den Tagesthemen
- Elemente von Mündlichkeit in der Tagesschau
- Elemente von Mündlichkeit in den Tagesthemen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse der deutschen Nachrichtensendungen "Tagesschau" und "Tagesthemen" im Hinblick auf das Spannungsfeld zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Die Autorin untersucht, inwieweit sich die mündliche Präsentation der Nachrichten auf schriftliche Merkmale zurückführen lässt und welche Tendenzen zu Mündlichkeit oder Schriftlichkeit bei den beiden Sendungen erkennbar sind.
- Merkmale gesprochener und geschriebener Sprache
- Modelle von Koch/Oesterreicher und Quasthoff zur Unterscheidung von medialer und konzeptioneller Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- Analyse von Schriftlichkeits- und Mündlichkeitsmerkmalen in den Tagesthemen und der Tagesschau
- Vergleich der beiden Sendungen hinsichtlich ihrer Tendenz zu Mündlichkeit oder Schriftlichkeit
- Bedeutung der Schriftlichkeit als Ausgangspunkt für die mündliche Präsentation von Nachrichten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Mündlichkeit und Schriftlichkeit ein und skizziert die historische Entwicklung der beiden Konzepte. Sie stellt die Relevanz der Untersuchung der Tagesthemen und der Tagesschau heraus, um die Rolle der Schriftlichkeit in der mündlichen Nachrichtenpräsentation zu beleuchten.
Kapitel 2 widmet sich den grundlegenden Charakteristika von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Es werden die allgemeinen Merkmale gesprochener und geschriebener Sprache, wie Einfachheit, Thema-Rhema-Abfolge und Subjektivität, näher betrachtet. Darüber hinaus wird die Unterscheidung zwischen medialer und konzeptioneller Mündlichkeit und Schriftlichkeit anhand der Modelle von Koch/Oesterreicher und Quasthoff erläutert.
In Kapitel 3 werden die Unterschiede zwischen den Nachrichtensendungen Tagesthemen und Tagesschau im Hinblick auf die Mündlichkeit und Schriftlichkeit beleuchtet.
Kapitel 4 stellt die Hypothese der Arbeit vor und analysiert die Tagesthemen und die Tagesschau auf Merkmale von Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Es werden sowohl Elemente von Schriftlichkeit als auch von Mündlichkeit in beiden Sendungen identifiziert und untersucht.
Schlüsselwörter
Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Tagesthemen, Tagesschau, Nachrichtenpräsentation, mediale und konzeptionelle Mündlichkeit, Koch/Oesterreicher, Quasthoff, Schriftlichkeitsmerkmale, Mündlichkeitsmerkmale
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen medialer und konzeptioneller Mündlichkeit?
Medial bedeutet die Form der Äußerung (Laut oder Schrift), während konzeptionell den Stil beschreibt (z. B. ein geschriebener Text, der wie gesprochene Sprache wirkt).
Warum gelten Fernsehnachrichten als „schriftlich“, obwohl sie gesprochen werden?
Die Nachrichten basieren auf schriftlich fixierten Texten und weisen Merkmale der Schriftlichkeit wie komplexe Satzstrukturen und Objektivität auf.
Was analysiert die Arbeit bei Tagesschau und Tagesthemen?
Sie untersucht die phonisch realisierten Äußerungen der Sprecher auf schriftliche und mündliche Merkmale, um Tendenzen beider Sendungen zu vergleichen.
Welches Modell wird zur Unterscheidung verwendet?
Die Arbeit nutzt vor allem das Modell von Koch/Oesterreicher (1985/95) sowie Überlegungen von Quasthoff zur somatischen Kommunikation.
Was sind typische Merkmale geschriebener Sprache?
Dazu gehören Objektivität, komplexe Textkonstitutionen, Informationsdichte und eine bewusste Thema-Rhema-Abfolge.
Neigen die Tagesthemen eher zur Mündlichkeit als die Tagesschau?
Die Arbeit stellt die Hypothese auf und untersucht, ob die freiere Moderation in den Tagesthemen mehr Elemente konzeptioneller Mündlichkeit enthält.
- Citation du texte
- Anna Erika Harenz (Auteur), 2010, Zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198519