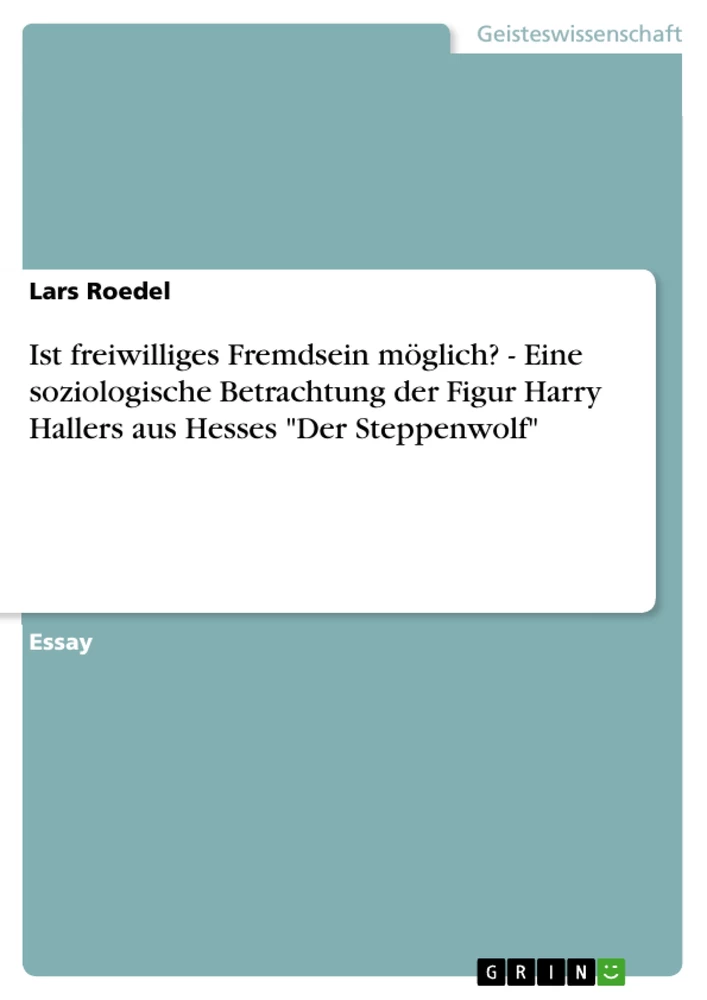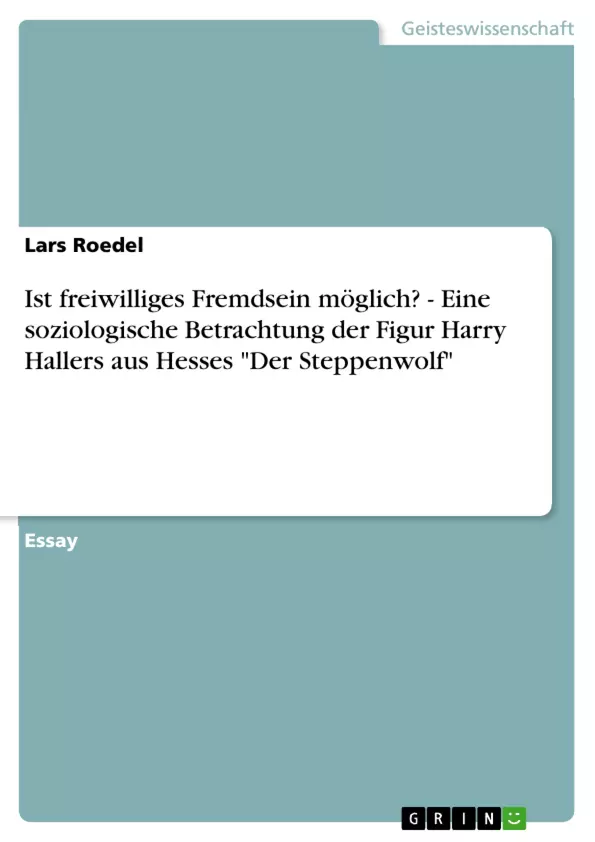Im folgenden Essay möchte ich der Frage nachgehen, ob die Annahmen von Georg Simmel und Alfred Schütz zur Figur des Fremden auch in Hermann Hesses Buch „Der Steppenwolf“ zu finden sind. Untersuchen möchte ich dies in Bezug auf den Protagonisten des Buches, Harry Haller. Ich werde dabei zunächst einen Vergleich zwischen der Figur Hallers und der simmelschen, dann zur schützschen Stilisierung des Fremden aufziehen. Basierend auf den erlangten Erkenntnissen der beiden Vergleiche möchte ich weiterführend aufzeigen, ob Haller sein ungeäußertes Vorhaben, sich bewusst selbst zum Fremden zu machen, gelingt. Zu beachten ist jedoch, dass ich so zu keiner verallgemeinernden Antwort gelange, sondern dass meine Beachtung nur auf die Figur Haller abzielt.
Vorgehensweise dieses Essays
Im folgenden Essay möchte ich der Frage nachgehen, ob die Annahmen von Georg Simmel und Alfred Schütz zur Figur des Fremden auch in Hermann Hesses Buch „Der Steppenwolf“ zu finden sind. Untersuchen möchte ich dies in Bezug auf den Protagonisten des Buches, Harry Haller. Ich werde dabei zunächst einen Vergleich zwischen der Figur Hallers und der simmelschen, dann zur schützschen Stilisierung des Fremden aufziehen. Basierend auf den erlangten Erkenntnissen der beiden Vergleiche möchte ich weiterführend aufzeigen, ob Haller sein ungeäußertes Vorhaben, sich bewusst selbst zum Fremden zu machen, gelingt. Zu beachten ist jedoch, dass ich so zu keiner verallgemeinernden Antwort gelange, sondern dass meine Beachtung nur auf die Figur Haller abzielt.
Die simmelsche Stilisierung des Fremden in Bezug auf Haller
Simmel grenzt in seinen Überlegungen zunächst den Fremden von einem Wanderer ab, da der Wanderer weiterzieht, der Fremde jedoch bleibt1. Diese These bestätigt sich bei der Betrachtung der Figur Hallers, welcher sich in einer Mansardenwohnung einmietet und auch längere Zeit dort wohnen bleibt; Es ist keine Absicht zu erkennen, in kurzer Zeit wieder weiterzuziehen2. Dem Fremden wird aller Regel nach eine gewisse Unvoreingenommenheit zugeschrieben. Dies ist bei Haller jedoch nur bedingt der Fall, da seine Meinung schon vor dem Einzug in die Mansardenwohnung, verbunden mit dem Kennenlernen der neuen Leute, stark von seinem vorherigen einsamen, asketisch-geistigen Lebens geprägt ist. Da Haller die bürgerliche Gesellschaft an sich mit all ihren Regeln, Rollen und Funktionen verabscheut steht er auch den Menschen, die er trifft sehr unvertraut und distanziert gegenüber. Er könnte in seiner Erscheinung also nicht in der Rolle des Schiedsrichters auftreten, die Soziologen dem Idealtypus des Fremden auf Grund seiner Objektivität und Werturteilsfreiheit zudenken. Dennoch schafft er es durch sein Auftreten die Menschen, mit denen er im Laufe des Buches in Kontakt tritt, in eine produktive Krise zu stürzen. Jedoch wird Haller von seinen Mitmenschen nicht radikalisiert; Seine menschlichen Merkmale werden ihm nicht abgesprochen, wodurch er nicht außerhalb der Gemeinschaft steht. Weitere von Simmel angebrachte Merkmale des Fremden sind dessen Beweglichkeit und Bindungslosigkeit. Hier ist im Laufe des Buches eine Änderung festzustellen. Zunächst tritt Haller wie jeder andere als neuer, als fremder Mensch mit seiner Umwelt in Kontakt. Bei diesen Interaktionen ist natürlich auch das Moment der Fremdheit als wesentlicher Teil des Individualisierungsdranges vorzufinden. Jedoch ist dieses Moment immer kleiner und Haller wird immer weniger fremd für seine Mitmenschen. Er schafft es also nicht, diese ‚Fassade‘ aufrechtzuerhalten, worauf ich aber später noch genauer eingehen möchte. Ein weiteres Kriterium Simmels, welches Haller als Stilisierung des Fremden erfüllt, ist der nötige Kontakt zu anderen. Er ist Teil der Umwelt und tritt mit dieser wie oben bereits erwähnt auch in Interaktionen.
Die schützsche Stilisierung des Fremden in Bezug auf Haller
Alfred Schütz stellt als zentrale verantwortliche Punkte des Fremdseins die Inkohärenz der Leitkultur, sowie die Inkonsistenz des Wissens heraus.3 Die Leitkultur sieht er als eine Konstruktion ohne Gesetzmäßigkeiten. Auf das Buch bezogen ist Haller nicht in der Lage, die Welt in die er sich begibt, zu verstehen, da keine lexikalische Erlernbarkeit möglich ist und somit das Moment der Erfahrung bei der Integration eine wichtige Rolle spielt. Ebenso das inkonsistente Wissen ist ein Problem, wodurch ein Fremder nicht von einem auf einen anderen Sachverhalt schließen kann. „Als Vater, als Betrüger, als Angestellter und als Mitglied einer Kirche kann er [der Mensch, d. Verf.] die verschiedensten und überhaupt nicht kongruenten Meinungen über Moral, Politik oder wissenschaftliche Angelegenheiten haben.“4 Bezieht man dies auf die Figur Haller, so stellt man fest, dass er zwar ein Kapitalismusgegner ist, jedoch von den Zinsen seiner Wertpapiere industrieller Unternehmen lebt, oder dass er zwar gegen den Krieg predigt, jedoch ohne die nötigen Konsequenzen daraus zu ziehen sich weitestgehend anpasst.5 Für Schütz ist eine Integration nur möglich, sofern der Fremde die neuen Kultur- und Zivilisationsmuster untersucht und in Handlungen übersetzt. Allerdings will Haller genau dies vermeiden und ein Fremder sein.
Ein weiterer Aspekt des Fremdseins ist für Schütz die Gefahr, individuelle Handlungen als allgemein gültige zu interpretieren und vice versa. Dies ist ebenfalls eine Stilisierung die nicht auf Haller zutrifft; Er ist intelligent und welterfahren genug diese Unterscheidung zu treffen.
[...]
1 Vgl. Simmel, Georg (1992): „ Exkursüber den Fremden “. In: ders.: Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Simmel Gesamtausgabe Bd. 11. Frankfurt am Main: Suhrkamp: S. 764 f.
2 Vgl. Hermann Hesse (2007): „ Der Steppenwolf “, 1. Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp: S. 9: Haller bietet eine Vorauszahlung auf die Miete für die Mansardenwohnung an
3 Schütz, Alfred (2002): „ Der Fremde, ein sozialpsychologischer Versuch “. In: Merz-Benz, Peter-Ulrich / Wagner, Gerhard: Der Fremde als sozialer Typus. Klassische soziale Texte zu einem aktuellen Phänomen. Konstanz: Utb: S. 76-78
4 Ebd., S. 77
5 Vgl. Hermann Hesse (2007): „ Der Steppenwolf “, 1. Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp: S. 140
Häufig gestellte Fragen
Welche soziologische Frage wird in Bezug auf den „Steppenwolf“ untersucht?
Der Essay untersucht, ob die Figur Harry Haller die theoretischen Merkmale des „Fremden“ nach Georg Simmel und Alfred Schütz erfüllt.
Wie definiert Georg Simmel den „Fremden“ im Vergleich zum Wanderer?
Für Simmel zieht der Wanderer weiter, während der Fremde kommt und bleibt, ohne jedoch vollständig Teil der Gemeinschaft zu werden.
Inwiefern erfüllt Harry Haller die Kriterien von Alfred Schütz?
Schütz betont die Inkohärenz der Leitkultur und das inkonsistente Wissen des Fremden; Haller zeigt diese Merkmale durch seine Distanz zur bürgerlichen Gesellschaft.
Gelingt es Harry Haller, bewusst „fremd“ zu bleiben?
Der Essay analysiert, ob Hallers Vorhaben, sich selbst zum Fremden zu machen, erfolgreich ist oder ob er letztlich doch Bindungen eingeht.
Warum wird Haller nicht als klassischer „Schiedsrichter“ gesehen?
Obwohl Fremden oft Objektivität zugeschrieben wird, ist Haller durch sein asketisch-geistiges Vorleben zu voreingenommen gegenüber der bürgerlichen Welt.
Welche Rolle spielt die bürgerliche Gesellschaft für Hallers Fremdsein?
Haller verabscheut die Regeln und Rollen der Bürgerwelt, was ihn in eine Position der Isolation und Distanz drängt.
- Arbeit zitieren
- Lars Roedel (Autor:in), 2011, Ist freiwilliges Fremdsein möglich? - Eine soziologische Betrachtung der Figur Harry Hallers aus Hesses "Der Steppenwolf", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198545