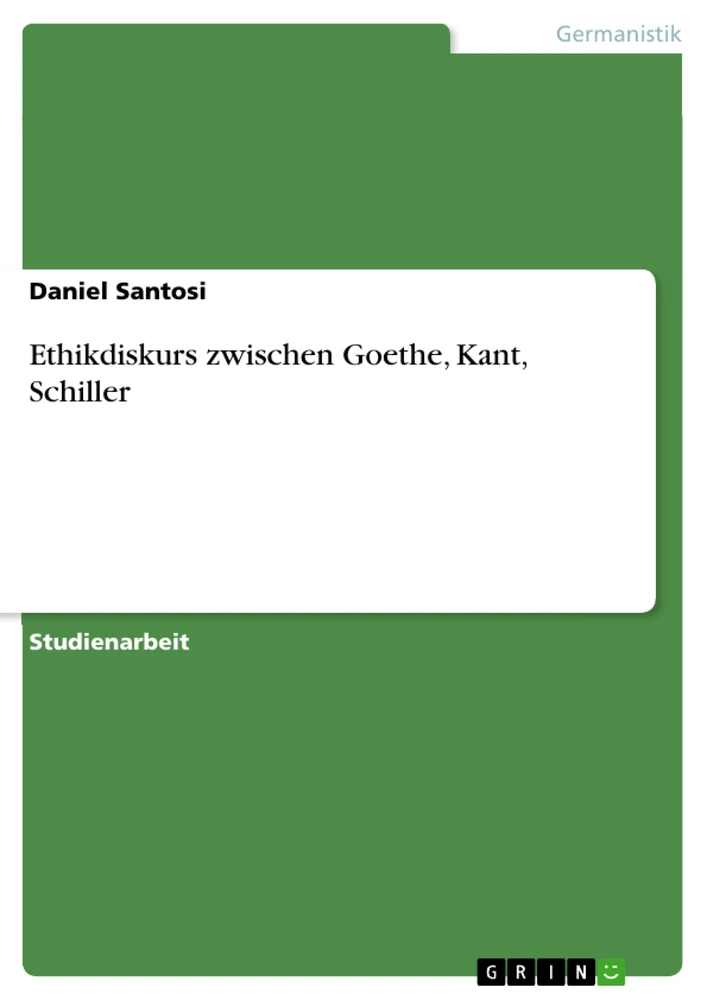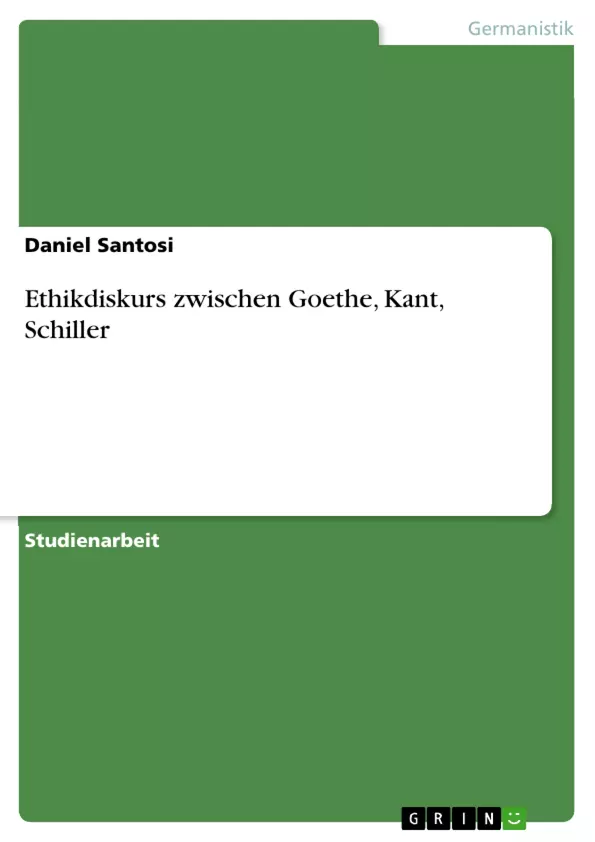Goethe kritisiert in seinen 'Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten' Kants Moralphilosophie. In dieser Seminararbeit wird der ethische Diskurs zwischen Goethe und Kant dargestellt und bewertet, an dem sich auch Schiller beteiligt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kants Moralphilosophie
- Konsequenzen und Probleme der Moralphilosophie
- Goethes Unterhaltungen
- Goethes Unterhaltungen
- Schillers Beteiligung
- Fazit aus dem Diskurs
- Ist die Kritik berechtigt?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem ethischen Diskurs zwischen Immanuel Kant, Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich von Schiller. Das Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick über diesen Diskurs zu verschaffen und bestimmte Positionen zu hinterfragen. Die Arbeit analysiert Goethes Novelle „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“, in der er auf die Moralvorstellung Kants anspielt. Der Fokus liegt auf der Darstellung des ethik-philosophischen Konflikts und der Beteiligung Schillers an der Diskussion.
- Kants Moralphilosophie und der kategorische Imperativ
- Die Beziehung zwischen Vernunft und Neigung in der Ethik
- Goethes Kritik an Kants Moralphilosophie in „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“
- Schillers Beitrag zum ethischen Diskurs
- Die Frage der Berechtigung der Kritik an Kant
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Frage der Hausarbeit vor: Ist es moralisch verwerflich, Gutes zu tun, wenn man nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern aus Neigung handelt? Sie führt in die Unterscheidung zwischen Gesinnungsethik und konsequentialistischer Ethik ein und erläutert die hermeneutische Methode, die in der Arbeit angewandt wird.
Kapitel 2.1. beleuchtet Kants Moralphilosophie als Gesinnungsethik, die im Gegensatz zu konsequentialistischen Ethiken den Schwerpunkt auf die Gesinnung und Absicht einer Handlung legt. Es werden wichtige Konzepte wie der gute Wille, Handlungen aus Pflicht und Maximen eingeführt, die den Rahmen für den kategorischen Imperativ bilden.
Kapitel 2.2. beleuchtet die Konsequenzen und Probleme, die aus Kants Moralphilosophie resultieren. Es wird auf den Konflikt zwischen Vernunft und Neigung eingegangen, der in der kantischen Ethik eine zentrale Rolle spielt.
Kapitel 3.1. analysiert Goethes Novelle „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ und die darin enthaltenen Anspielungen auf Kants Moralphilosophie. Goethes Kritik an Kants Gesinnungsethik wird näher beleuchtet.
Kapitel 3.2. beleuchtet Schillers Beteiligung am ethischen Diskurs und seine Positionierung in Bezug auf Kant und Goethes Ansichten.
Kapitel 3.3. fasst die Ergebnisse des Diskussions und zieht ein Fazit.
Kapitel 4. diskutiert, inwiefern die Kritik an Kant berechtigt ist.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Gesinnungsethik, konsequentialistische Ethik, kategorischer Imperativ, guter Wille, Handlung aus Pflicht, Maxime, Vernunft, Neigung, Goethe, Kant, Schiller, „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“, hermeneutische Methode, Ethikdiskurs.
Häufig gestellte Fragen
Worauf basiert Kants Moralphilosophie?
Kants Ethik ist eine Gesinnungsethik, die auf dem kategorischen Imperativ und dem Handeln aus Pflicht basiert. Entscheidend ist nicht die Folge einer Tat, sondern die Absicht und die Übereinstimmung mit allgemeingültigen Maximen.
Wie kritisiert Goethe Kants Ethik in seinen Werken?
In „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ problematisiert Goethe die strikte Trennung von Vernunft und Neigung. Er hinterfragt, ob eine moralische Handlung weniger wert ist, wenn sie aus natürlicher Zuneigung statt aus reinem Pflichtgefühl geschieht.
Welche Rolle spielt Schiller im Ethikdiskurs?
Schiller vermittelt zwischen den Positionen. Er schätzt Kants Strenge, plädiert aber für die „schöne Seele“, bei der Pflicht und Neigung im Einklang stehen, statt sich feindlich gegenüberzustehen.
Was ist der Unterschied zwischen Gesinnungsethik und konsequentialistischer Ethik?
Die Gesinnungsethik (Kant) bewertet die moralische Qualität nach der Absicht des Handelnden. Die konsequentialistische Ethik hingegen beurteilt eine Handlung primär nach ihren Folgen und Ergebnissen.
Was versteht Kant unter dem „kategorischen Imperativ“?
Es ist das Prinzip, nur nach denjenigen Maximen zu handeln, von denen man zugleich wollen kann, dass sie ein allgemeines Gesetz werden.
- Citar trabajo
- Daniel Santosi (Autor), 2012, Ethikdiskurs zwischen Goethe, Kant, Schiller, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198627