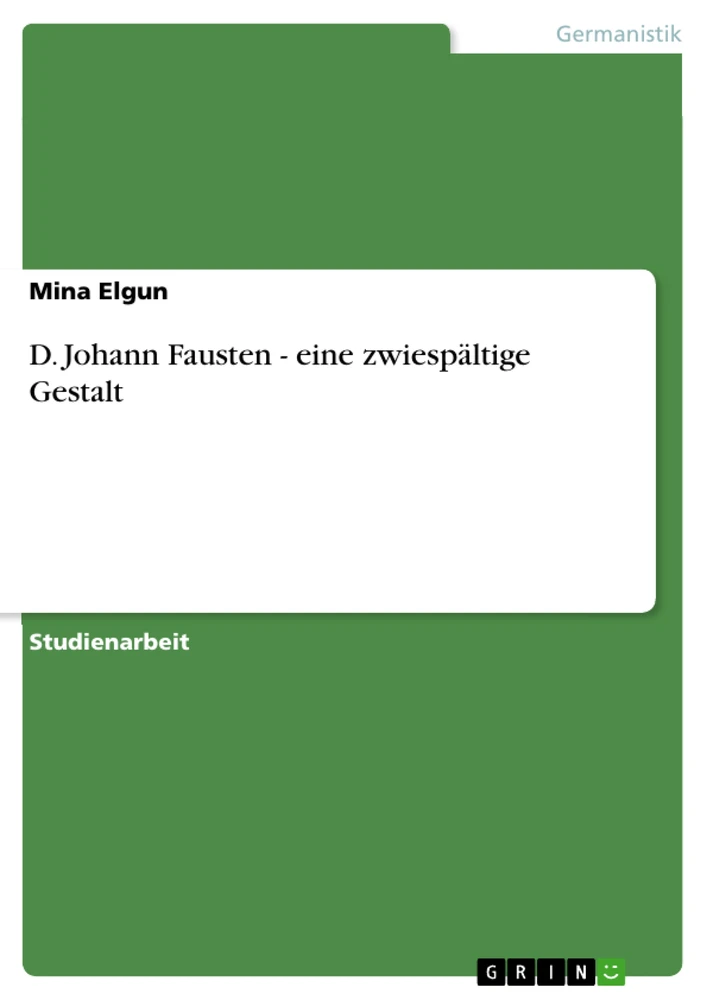Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung________________________________________1
2. Dr. Johann Fausten_________________________________2
3. Die Vorrede_______________________________________2
4. Der Teufelspakt____________________________________3
5. Faust und Mephistopheles___________________________5
6. Fausts Forschungsreisen_____________________________9
7. Der Faust des Schwankteils__________________________10
8. Fausts Tod_______________________________________11
9. Fazit – Faust als zwiespältige Figur____________________13
10. Literaturverzeichnis________________________________15
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Dr. Johann Fausten
- Die Vorrede
- Der Teufelspakt
- Faust und Mephistopheles
- Fausts Forschungsreisen
- Der Faust des Schwankteils
- Fausts Tod
- Fazit - Faust als zwiespältige Figur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Darstellung des Protagonisten Dr. Johann Faust in der „Historia von D. Johann Fausten“ von 1587 und untersucht, wie Faust an verschiedenen Stellen des Volksbuches charakterisiert wird. Die Arbeit zielt darauf ab, Widersprüche und Ambivalenzen in der Darstellung der Faust-Figur zu beleuchten und ein komplexes Bild des Protagonisten zu zeichnen.
- Fausts Abwendung vom Christentum und der Teufelspakt
- Die Ambivalenz in Fausts Charakter: Wissensdurst, Stolz und „Sündenverfallenheit“
- Die Rolle des Mephistopheles und die Frage der Willensfreiheit
- Fausts Lebensweg zwischen Paktabschluss und Tod
- Die Darstellung von Fausts Tod im Kontext des Gesamtwerks
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Volksbuch „Historia von D. Johann Fausten“ vor, seinen historischen Kontext und die Bedeutung der Figur Fausts in der Literatur.
- Dr. Johann Fausten: Dieses Kapitel beschreibt Fausts Lebensgeschichte bis zum Teufelspakt, seine Ausbildung und seinen Wissensdurst.
- Die Vorrede: Die Vorrede des Erzählers wird analysiert und ihre Bedeutung für die Bewertung der Figur Fausts herausgestellt.
- Der Teufelspakt: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Paktabschluss zwischen Faust und dem Teufel und analysiert die Ursachen und Folgen dieses Schritts.
- Faust und Mephistopheles: Hier werden die Beziehung zwischen Faust und Mephistopheles sowie die Frage nach Fausts Willensfreiheit im Kontext des Paktes beleuchtet.
- Fausts Forschungsreisen: Dieses Kapitel untersucht Fausts Lebensweg zwischen dem Paktabschluss und seinem Tod, seine Taten und seine Verdammnis.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Hausarbeit sind: Dr. Johann Faust, Volksbuch, Historia von D. Johann Fausten, Teufelspakt, Mephistopheles, Wissensdurst, Stolz, Sünde, Verdammnis, Ambivalenz, Willensfreiheit, Reformation, Protestantismus.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Dr. Faust als zwiespältige Gestalt bezeichnet?
Faust verkörpert einerseits den modernen Wissensdurst und den Stolz des Individuums, andererseits wird er im Volksbuch als sündhafter Ketzer dargestellt, der sich von Gott abwendet.
Was beinhaltet der Teufelspakt im Volksbuch von 1587?
Faust verschreibt seine Seele dem Teufel im Austausch für 24 Jahre voller Wissen, Macht und Sinnesgenüsse, was letztlich zu seiner ewigen Verdammnis führt.
Welche Rolle spielt Mephistopheles?
Mephistopheles ist der Diener des Teufels, der Faust auf seinen Reisen begleitet, ihm Wünsche erfüllt, ihn aber auch in seiner Sündhaftigkeit bestärkt und seine Willensfreiheit einschränkt.
Wie wird Fausts Tod dargestellt?
Sein Tod ist schrecklich und dient als mahnendes Exempel für die Leser, den Weg des Glaubens nicht zu verlassen, da am Ende die unausweichliche Verdammnis steht.
In welchem historischen Kontext steht die "Historia von D. Johann Fausten"?
Das Werk entstand zur Zeit der Reformation und des Protestantismus und spiegelt die religiösen Ängste und moralischen Vorstellungen des 16. Jahrhunderts wider.
- Arbeit zitieren
- Mina Elgun (Autor:in), 2010, D. Johann Fausten - eine zwiespältige Gestalt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198885