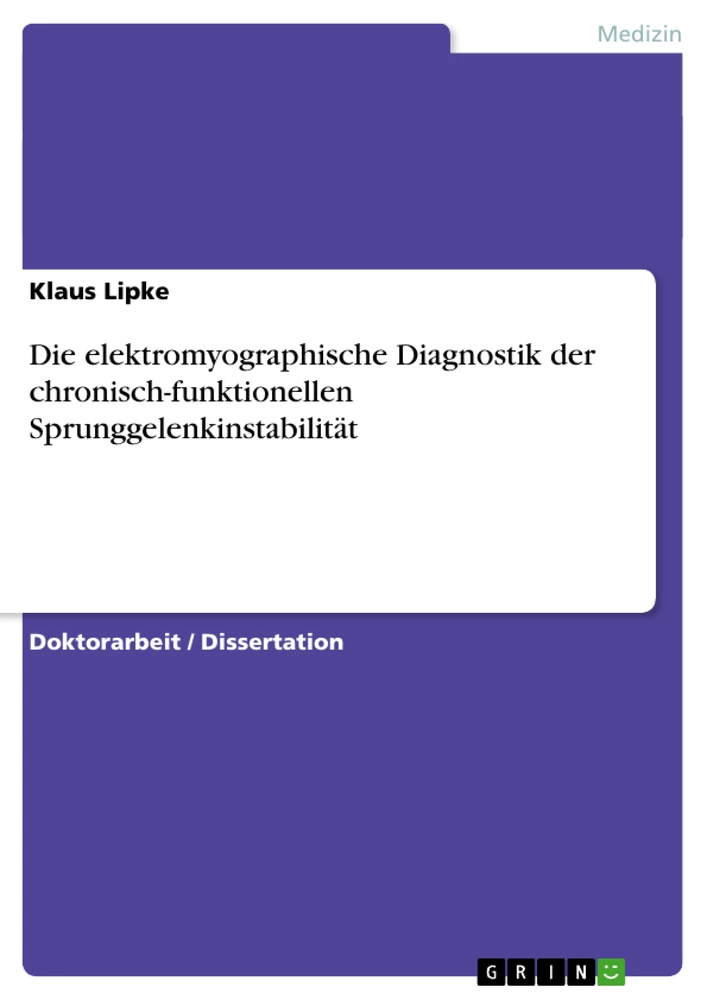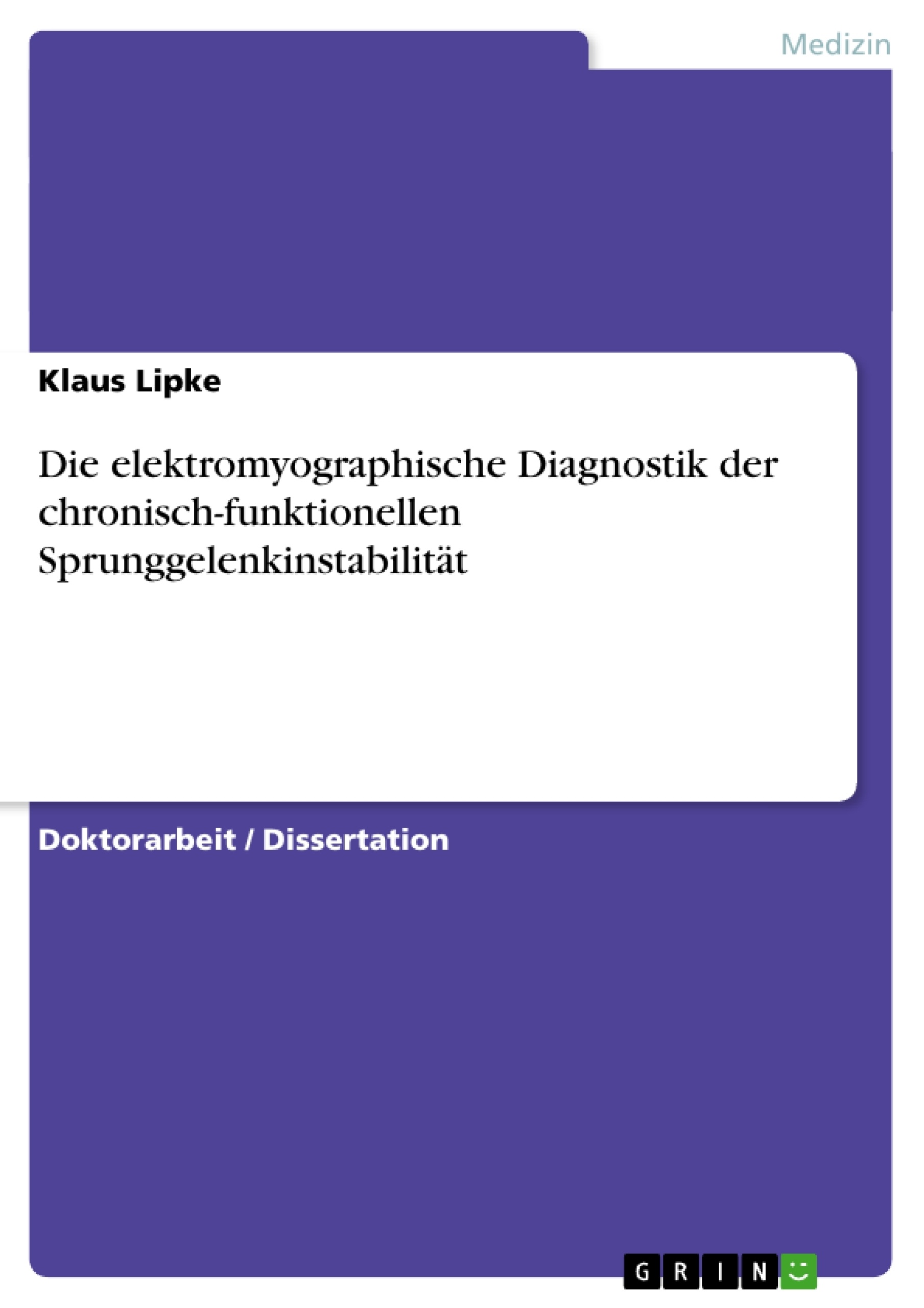Die Läsion des Kapsel-Band-Apparates am oberen Sprunggelenk ist die häufigste Verletzung in der Sportmedizin [21, 24, 89]. Gründe hierfür liegen sowohl in den anatomischen Gegebenheiten des Sprunggelenkes als auch in den Unfallmechanismen. Eine besondere Gefährdung besteht bei sprungbetonten Ballsportarten wie Badminton, Basketball, Fußball und Squash [90]. Aufgrund der hohen Inzidenz der Verletzung des lateralen Bandapparates am Sprunggelenk würde in der Vergangenheit vielfach über geeignete Diagnosemöglichkeiten und über suffiziente Therapierstrategien zur Behandlung des akuten Supinationstraumas diskutiert. Unabhängig von der durchgeführten Primärtherapie klagen jedoch 40 % der Patienten nach einem akuten Inversionstrauma später über eine chronische Instabilität [102]. Erstaunlicherweise ist die Inzidenz in den letzten 45 Jahren nahezu konstant geblieben. Die bereits 1955 von Bosien [11] und 1964 von Freeman [19] publizierten Untersuchungen über den Residualzustand nach akutem Umknicktrauma wurden in einer aktuellen Untersuchung von Verhaben bestätigt [102]. Symptome sind vor allem eine vermehrte Schwellneigung, Bewegungseinschränkungen, Schmerz und ein Unsicherheitsgefühl besonders beim Laufen auf unebenem Gelände [13, 41, 48, 95]. Als Spätkomplikation der hieraus resultierenen rezidivierenden Distorsionen müssen besonders arthrotische Veränderungen am Sprunggelenk angesehen werden [28, 48, 92, 101, 104]. Deshalb muss der Diagnostik und Therapie der chronischen Instabilität eine entscheidende Bedeutung für die Vermeidung von Residualbeschwerden im Rahmen der Behandlung und Nachsorge der akuten fibularen Bandläsion beigemessen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Verzeichnis der Abkürzungen
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Literaturübersicht
- 1.3 Fragestellung
- 1.4 Anatomie und Biomechanik
- 1.5 Pathogenese der chronischen Instabilität
- 2. Material und Methoden
- 2.1 Literaturanalyse
- 2.1.1 Studiendesign
- 2.2 Experimenteller Studienabschnitt
- 2.2.1 Studiendesign und Studienteilnehmer
- 2.2.2 Untersuchungsmethoden und Messapparaturen
- 2.2.3 EMG-Auswertung
- 2.3 Statistik
- 3. Ergebnisse
- 3.1 Literaturanalyse
- 3.2 Experimenteller Studienabschnitt
- 3.2.1 Allgemeine Bemerkungen
- 3.2.2 Deskriptive Statistik
- 3.2.3 Links-Rechts-Vergleich
- 3.2.4 Vergleich verschiedener Aufwärmzustände
- 3.2.5 Einfluss der Beindominanz auf die PRT
- 3.2.6 Einfluss der anthropometrischen Daten auf die PRT
- 3.2.7 Einfluss der Sporthäufigkeit auf die PRT
- 3.2.8 Einfluss des Alters auf die PRT
- 3.2.9 Altersdifferenzierte Beurteilung der PRT
- 3.2.10 Vergleich der Gruppen „FG“ und „CI“
- 3.2.11 Beurteilungskriterien der neuromuskulären Instabilität
- 3.2.12 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 4. Diskussion
- 4.1 Studienpopulation
- 4.2 Versuchsaufbau
- 4.3 Ermittlung der PRT
- 4.4 Die Peroneale Reaktionszeit im Normalkollektiv
- 4.5 Der Einfluss verschiedener Störgrößen
- 4.6 Vergleich der Gruppen „FG\" und „CI“
- 4.7 Neue Parameter in der EMG-Beurteilung
- 4.8 Klinische Bedeutung
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation befasst sich mit der elektromyographischen Diagnostik der chronisch-funktionellen Sprunggelenkinstabilität. Sie zielt darauf ab, das Verständnis der zugrundeliegenden physiologischen Mechanismen zu verbessern und die diagnostische Bedeutung der elektromyographischen Untersuchung zu evaluieren.
- Analyse der elektromyographischen Aktivität der peronealen Muskeln bei Patienten mit chronisch-funktioneller Sprunggelenkinstabilität
- Bewertung der diagnostischen Aussagekraft der elektromyographischen Untersuchung
- Entwicklung neuer Parameter zur Beurteilung der neuromuskulären Instabilität
- Untersuchung des Einflusses verschiedener Störgrößen auf die elektromyographischen Ergebnisse
- Klinische Relevanz der elektromyographischen Diagnostik für die Behandlung der chronisch-funktionellen Sprunggelenkinstabilität
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel stellt die Problemstellung der chronisch-funktionellen Sprunggelenkinstabilität vor, gibt einen Überblick über die relevanten Literaturquellen und formuliert die Forschungsfragen der Dissertation. Des Weiteren werden die Anatomie und Biomechanik des Sprunggelenks sowie die Pathogenese der Instabilität beschrieben.
- Kapitel 2: Material und Methoden
Kapitel 2 erläutert die angewandten Methoden der Literaturanalyse und des experimentellen Studienabschnitts. Es beschreibt das Studiendesign, die Studienteilnehmer, die Untersuchungsmethoden, die Messapparaturen, die EMG-Auswertung und die statistischen Verfahren.
- Kapitel 3: Ergebnisse
Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Literaturanalyse und des experimentellen Studienabschnitts. Es umfasst deskriptive statistische Analysen, Vergleiche zwischen verschiedenen Gruppen und die Beurteilung des Einflusses verschiedener Faktoren auf die elektromyographischen Ergebnisse.
- Kapitel 4: Diskussion
Kapitel 4 diskutiert die Ergebnisse der Studie im Kontext der relevanten Literatur. Es betrachtet die Limitationen der Studie, die klinische Bedeutung der Ergebnisse und die Implikationen für die Diagnostik und Behandlung der chronisch-funktionellen Sprunggelenkinstabilität.
Schlüsselwörter
Chronisch-funktionelle Sprunggelenkinstabilität, Elektromyographie, Peroneale Muskeln, Peroneale Reaktionszeit, Neuromuskuläre Instabilität, Diagnostik, Behandlung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine chronisch-funktionelle Sprunggelenkinstabilität?
Dabei handelt es sich um ein verbleibendes Unsicherheitsgefühl und häufiges Umknicken nach einer akuten Bandverletzung, oft verursacht durch eine gestörte neuromuskuläre Kontrolle.
Wie hilft die Elektromyographie (EMG) bei der Diagnose?
Das EMG misst die elektrische Aktivität der Muskeln. Bei Instabilität lässt sich so feststellen, ob die stabilisierenden Muskeln (Peronealmuskeln) zu langsam oder zu schwach auf Reize reagieren.
Was bedeutet „Peroneale Reaktionszeit“ (PRT)?
Die PRT ist die Zeitspanne zwischen einem Umknickreiz und der schützenden Muskelaktivierung. Eine verlängerte PRT gilt als Indikator für eine funktionelle Instabilität.
Warum ist die Diagnose der Instabilität so wichtig?
Unbehandelte chronische Instabilität kann zu rezidivierenden Distorsionen und langfristig zu schweren arthrotischen Veränderungen am Sprunggelenk führen.
Welche Sportarten sind besonders riskant für Sprunggelenkverletzungen?
Besonders sprungbetonte Ballsportarten wie Basketball, Fußball, Badminton und Squash weisen hohe Verletzungsraten am lateralen Bandapparat auf.
- Citation du texte
- Klaus Lipke (Auteur), 2001, Die elektromyographische Diagnostik der chronisch-funktionellen Sprunggelenkinstabilität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19897