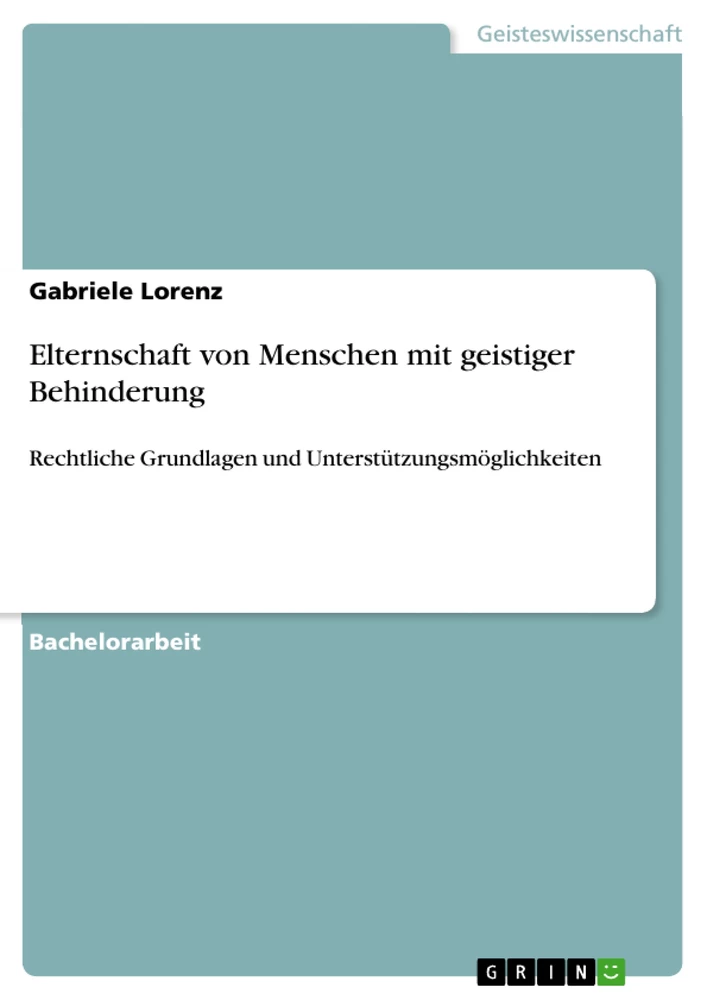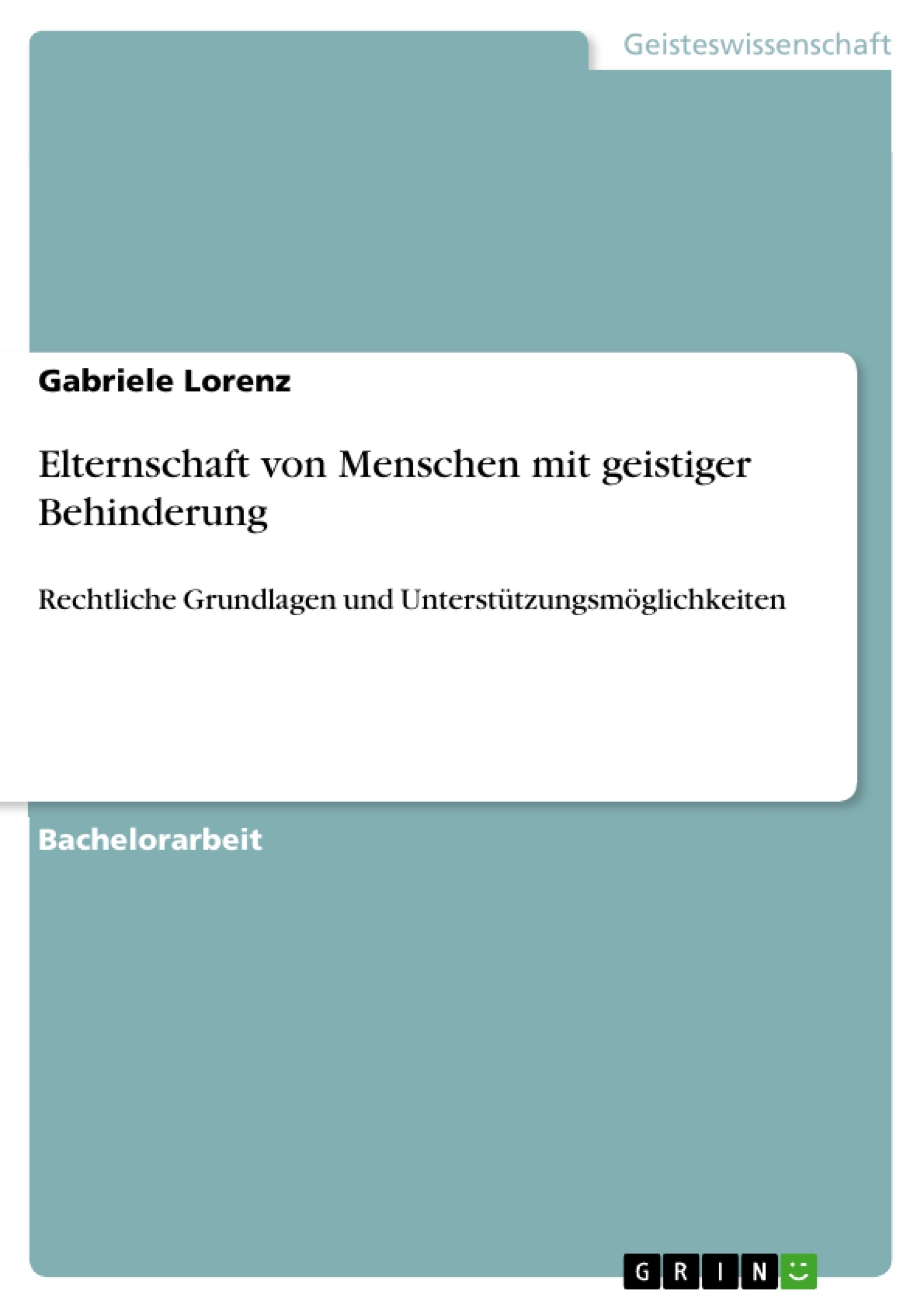„Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein umso mehr". Wenn zu dieser großen Herausforderung eine weitere hinzu kommt, zum Beispiel in Form einer geistigen Behinderung eines oder beider Elternteile, gilt es eine Vielzahl von Fragen zu klären.
Indessen wird eine Elternschaft geistig behinderter Menschen als Tabu-Thema beschrieben und kaum jemand weiß etwas darüber. Dies geht soweit, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung im Bereich der Familiengründung zahlreiche Einschränkungen ihrer Menschenrechte ertragen müssen. Während im Normalfall einer Frau zu ihrer Schwangerschaft gratuliert wird, löst die Schwangerschaft einer Frau, die als „geistig behindert“ eingestuft wird, in der Regel eher eine ablehnende Haltung aus. In vielen Fällen einer Elternschaft von Menschen mit speziellem Förderbedarf trennt das Jugendamt sofort nach der Geburt die Mütter von ihren oft gesunden Kindern. „Nur selten erhalten geistige behinderte Mütter die Chance, ihre Elternschaft auszuüben.“4 Erst in den letzten Jahren wurden neue Studien eruiert und es entstanden Einrichtungen und Methodensammlungen zur Bearbeitung dieses Themas. Grund dafür ist der Wandel durch den Normalisierungsgedanken, die Selbstbestimmung und die Integrationsdiskussion.
Unter Betrachtung dieser Aspekte, ist es das Ziel dieser Bachelor-Arbeit die folgenden beiden Fragestellungen zu klären:
1. Welche rechtlichen Grundlagen gibt es im Zusammenhang mit einer Elternschaft von Menschen mit einer geistigen Behinderung?
2. Welche Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern mit geistiger Behinderung gibt es? Erläuterungen am Beispiel der Bundesarbeitsgemeinschaft ‚Begleitete Elternschaft‘.
Das Ergebnis dieser Bachelor-Arbeit soll ein Leitfaden sein, der sowohl Professionellen in Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung, MitarebeiterInnen in Beratungsstellen, sowie Eltern und Angehörigen einen guten Überblick über die Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung gibt. Dabei befasst sich diese Zusammenstellung mit Unterstützungsmöglichkeiten im Falle eines Kinderwunsches, der Schwangerschaft und des Eltern-Seins. Im Anhang werden ausgewählte Methoden zur Bearbeitung des Themas in Gesprächen oder Seminaren zusammengetragen. Außerdem werden die rechtlichen Grundlagen für eine Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung aufgeführt.
[...]
4 www.eltern.t-online.de, 23.05.2012
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definitionen
- 2.1 Behinderung
- 2.2 Geistige Behinderung - der Versuch einer Begriffsbestimmung
- 3 Zahlen über Elternschaften bei Menschen mit geistiger Behinderung
- 4 Rechtliche Fragen im Zusammenhang der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung
- 4.1 Das Normalisierungsprinzip
- 4.2 Übergeordnete gesetzliche Regelungen
- 4.3 Das Betreuungsgesetz
- 4.4 Rechtsstellung von Menschen mit geistiger Behinderung
- 4.5 Elterliche Sorge
- 4.6 Rechtliche Fragen hinsichtlich der professionellen Begleitung von Eltern mit geistiger Behinderung
- 5 Vorbereitung auf die Elternschaft und Hilfestellung während der Elternschaft
- 5.1 Methoden, Materialien und Werkzeuge
- 5.2 Unterstützungsnetzwerke als Hilfen bei der Ausübung der Elternschaft
- 5.3 Hilfen bei der Ausübung der Elternschaft durch die Bundesarbeitsgemeinschaft ‚Begleitete Elternschaft‘
- 5.3.1 Die Bundesarbeitsgemeinschaft ‚Begleitete Elternschaft‘
- 5.3.2 Ziele und Aufnahmebedingungen
- 5.3.3 Räumliche Ausstattung
- 5.3.4 Aufgaben und Qualifikation der BegleiterInnen
- 5.3.5 Rechtliche Grundlagen und Finanzierung
- 5.3.6 Arbeitsweisen/ Methoden
- 5.3.7 Schlussbemerkung
- 6 Schlussfolgerungen für die Soziale Arbeit
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die rechtlichen Grundlagen und Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern mit geistiger Behinderung in Deutschland. Ziel ist es, einen Leitfaden für professionelle Betreuer, Beratungsstellen und betroffene Familien zu erstellen. Die Arbeit beleuchtet die rechtliche Situation dieser Eltern, den Umgang mit dem Kinderwunsch und die notwendigen Unterstützungsstrukturen während Schwangerschaft und Elternschaft.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Elternschaft für Menschen mit geistiger Behinderung
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „geistige Behinderung“
- Vorbereitung auf die Elternschaft und verschiedene Unterstützungsangebote
- Die Rolle von Unterstützungsnetzwerken und deren Bedeutung
- Das Modell der „Begleiteten Elternschaft“ als Beispiel für gelingende Unterstützung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit untersucht die rechtlichen Grundlagen und Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern mit geistiger Behinderung, ein oft tabuisiertes Thema, das mit zahlreichen Menschenrechtsverletzungen verbunden ist. Ziel ist die Erstellung eines Leitfadens zur Verbesserung der Situation.
2 Definitionen: Dieses Kapitel befasst sich mit der komplexen Definition von „Behinderung“ und „geistige Behinderung“, unter Berücksichtigung medizinischer, psychologischer, pädagogischer und soziologischer Perspektiven. Es werden verschiedene Definitionen und Klassifizierungssysteme vorgestellt und kritisch hinterfragt, mit dem Fokus auf den Wandel von Defizit- hin zu Ressourcenorientierung.
3 Zahlen über Elternschaften bei Menschen mit geistiger Behinderung: Dieses Kapitel analysiert die wenigen vorhandenen Studien zur Anzahl von Elternschaften bei Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland. Es wird eine zunehmende Tendenz festgestellt und die Bedeutung weiterer Forschungsarbeit betont.
4 Rechtliche Fragen im Zusammenhang der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung: Dieses Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Aspekten der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung, beginnend mit dem Normalisierungsprinzip und der Betrachtung von Grundgesetz, UN-Kinderrechtskonvention und UN-Behindertenrechtskonvention. Es werden das Betreuungsgesetz, die Geschäftsfähigkeit und die elterliche Sorge detailliert erläutert und die oft irrigen Annahmen über die Unvereinbarkeit von Betreuung und Sorgerecht widerlegt.
5 Vorbereitung auf die Elternschaft und Hilfestellung während der Elternschaft: Das Kapitel beleuchtet die praktische Unterstützung von Eltern mit geistiger Behinderung. Es werden Methoden und Materialien der sexualpädagogischen Arbeit vorgestellt, wie das Kinderwunschspiel, Elternpraktika mit Babysimulatoren, und die Wichtigkeit der Begleitung während der Schwangerschaft hervorgehoben. Der Aufbau von Unterstützungsnetzwerken und die Rolle der Bundesarbeitsgemeinschaft „Begleitete Elternschaft“ werden detailliert beschrieben.
6 Schlussfolgerungen für die Soziale Arbeit: Der letzte Abschnitt vor der Zusammenfassung betont die Rolle der Sozialen Arbeit in der Begleitung von Eltern mit geistiger Behinderung und deren Kindern. Es werden die notwendigen Qualifikationen und Kompetenzen von Fachkräften aufgezeigt und die Bedeutung von bedarfsgerechten Angeboten in der Schwangerschaftsberatung und Familienbegleitung hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Elternschaft, Rechtliche Grundlagen, Unterstützungsmöglichkeiten, Begleitete Elternschaft, Betreuungsgesetz, UN-Konventionen, Inklusion, Selbstbestimmung, Sozialarbeit, Ressourcenorientierung, Sexualpädagogik, Kindeswohl.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die rechtlichen Grundlagen und Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern mit geistiger Behinderung in Deutschland. Ziel ist die Erstellung eines Leitfadens für professionelle Betreuer, Beratungsstellen und betroffene Familien, der die rechtliche Situation dieser Eltern beleuchtet und den Umgang mit dem Kinderwunsch sowie die notwendigen Unterstützungsstrukturen während Schwangerschaft und Elternschaft beschreibt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Rechtliche Rahmenbedingungen der Elternschaft für Menschen mit geistiger Behinderung, Definition und Abgrenzung des Begriffs „geistige Behinderung“, Vorbereitung auf die Elternschaft und verschiedene Unterstützungsangebote, die Rolle von Unterstützungsnetzwerken und deren Bedeutung, sowie das Modell der „Begleiteten Elternschaft“ als Beispiel für gelingende Unterstützung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Definitionen (Behinderung und geistige Behinderung), Zahlen über Elternschaften bei Menschen mit geistiger Behinderung, Rechtliche Fragen im Zusammenhang der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung (inkl. Normalisierungsprinzip, Betreuungsgesetz, elterliche Sorge), Vorbereitung auf die Elternschaft und Hilfestellung während der Elternschaft (inkl. Methoden, Materialien, Unterstützungsnetzwerke und die Bundesarbeitsgemeinschaft „Begleitete Elternschaft“), Schlussfolgerungen für die Soziale Arbeit und Zusammenfassung.
Welche Definitionen von Behinderung und geistiger Behinderung werden verwendet?
Das Kapitel „Definitionen“ befasst sich kritisch mit verschiedenen Definitionen und Klassifizierungssystemen von „Behinderung“ und „geistiger Behinderung“, unter Berücksichtigung medizinischer, psychologischer, pädagogischer und soziologischer Perspektiven. Der Fokus liegt auf dem Wandel von Defizit- hin zu Ressourcenorientierung.
Welche rechtlichen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit analysiert detailliert die rechtlichen Aspekte der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung, einschließlich des Normalisierungsprinzips, des Grundgesetzes, der UN-Kinderrechtskonvention und der UN-Behindertenrechtskonvention. Das Betreuungsgesetz, die Geschäftsfähigkeit und die elterliche Sorge werden erläutert, und oft irrige Annahmen über die Unvereinbarkeit von Betreuung und Sorgerecht werden widerlegt.
Welche Unterstützungsangebote für Eltern mit geistiger Behinderung werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Unterstützungsangebote, darunter Methoden und Materialien der sexualpädagogischen Arbeit (z.B. Kinderwunschspiel, Elternpraktika mit Babysimulatoren), den Aufbau von Unterstützungsnetzwerken und die Bundesarbeitsgemeinschaft „Begleitete Elternschaft“ mit detaillierten Informationen zu Zielen, Aufnahmebedingungen, Aufgaben der BegleiterInnen, rechtlichen Grundlagen und Finanzierung.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit?
Der Schlussabschnitt betont die wichtige Rolle der Sozialen Arbeit in der Begleitung von Eltern mit geistiger Behinderung und deren Kindern. Es werden die notwendigen Qualifikationen und Kompetenzen von Fachkräften hervorgehoben und die Bedeutung von bedarfsgerechten Angeboten in der Schwangerschaftsberatung und Familienbegleitung unterstrichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geistige Behinderung, Elternschaft, Rechtliche Grundlagen, Unterstützungsmöglichkeiten, Begleitete Elternschaft, Betreuungsgesetz, UN-Konventionen, Inklusion, Selbstbestimmung, Sozialarbeit, Ressourcenorientierung, Sexualpädagogik, Kindeswohl.
Gibt es Zahlen zu Elternschaften bei Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland?
Die Arbeit analysiert die wenigen vorhandenen Studien zur Anzahl von Elternschaften bei Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland. Es wird eine zunehmende Tendenz festgestellt und die Bedeutung weiterer Forschungsarbeit betont.
- Quote paper
- Gabriele Lorenz (Author), 2012, Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198989