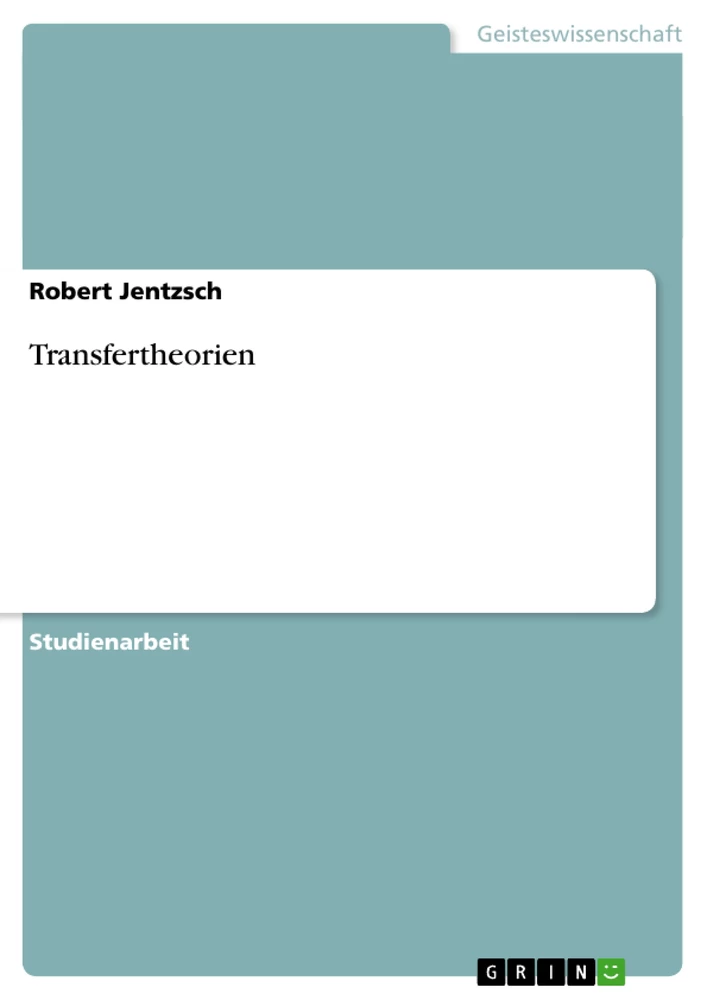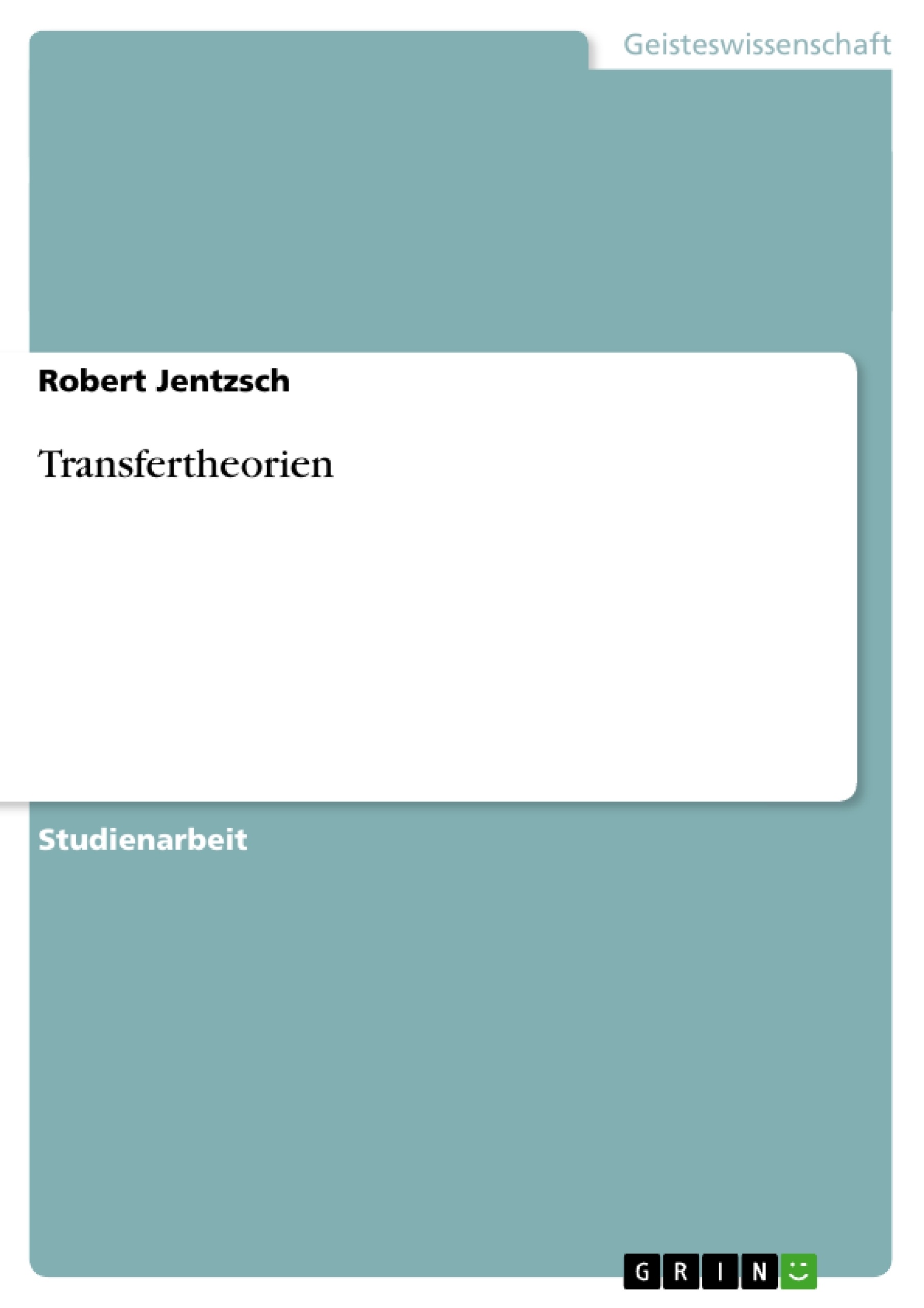Die vorliegende Seminararbeit soll einen Überblick über die existierenden Theorien
geben, die das Phänomen des Transfers von einer Lernsituation in eine
Anwendungssituation zu erklären versuchen.
Die Lernsituation kann auch als Lernfeld oder Source, die Anwendungssituation auch
als Anwendungsfeld oder Target bezeichnet werden.
Bezogen auf den Arbeitskontext entspräche eine Weiterbildungsmaßnahme der
Lernsituation und der Arbeitsplatz der Anwendungssituation.
Da in der heutigen Arbeitswelt Weiterbildungsmaßnahmen als wichtiger Teil der
Mitarbeiterentwicklung angesehen werden und für Unternehmen eine beträchtliche
finanzielle Investition darstellen, ist es von außerordentlicher Bedeutung, dass die
Mitarbeiter die Inhalte eines solchen Seminars in möglichst hohem Umfang dann
auch am Arbeitsplatz anwenden und zwar über einen möglichst langen Zeitraum. Es
ist also wünschenswert, dass die Trainingsinhalte erfolgreich transferiert werden
können.
In der Literatur gibt es eine Vielzahl an Definitionen für Transfer.
Allgemein versteht man darunter „wenn etwas, das in einem Zusammenhang gelernt
wurde, auf einen anderen Zusammenhang übertragen wird“ (Mandl, Prenzel &
Gräsel, 1992).
Speziell auf den Arbeitskontext bezogen kann man Transfer als Prozess der
Übertragung und Aufrechterhaltung von, in einem Seminar erworbenen, Fähigkeiten,
Wissen oder Einstellungen auf den Arbeitsplatz beschreiben.
Da die einem Trainingsprogramm zugrundeliegende Transfertheorie zu einem
großen Teil zum Erfolg oder Misserfolg des Trainings beitragen kann, soll die
Grundidee, sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Theorien im folgenden
beleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Erläuterung des Themas
- Transferarten
- Transfertheorien
- Klassische Transfertheorien
- Prinzipientransfer
- Theorie der identischen Elemente
- Neuere Theorien
- Transfer durch metakognitive Kontrolle
- Transfer als ganzheitlicher Prozess
- Klassische Transfertheorien
- Praxisorientierte Bewertung und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über verschiedene Theorien zu geben, die das Phänomen des Transfers von Lern- zu Anwendungssituationen erklären. Sie analysiert die verschiedenen Arten von Transfer und beleuchtet die wichtigsten Transfertheorien, sowohl klassische als auch neuere Ansätze.
- Definition und Arten von Transfer
- Klassische Transfertheorien (Prinzipientransfer, Theorie der identischen Elemente)
- Neuere Transfertheorien (metakognitive Kontrolle, ganzheitlicher Transferprozess)
- Bewertung und Zusammenfassung der Transfertheorien
- Praxisbezogene Anwendung von Transfertheorien im Arbeitskontext
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Seminararbeit erläutert das Thema Transfer, indem es die Lernsituation und die Anwendungssituation im Kontext von Weiterbildungsmaßnahmen definiert. Es befasst sich mit der Bedeutung von Transfer für Unternehmen und die Relevanz von Transfertheorien für den Erfolg von Trainings. Das zweite Kapitel untersucht verschiedene Transferarten, darunter positiver, negativer und Nulltransfer, und differenziert zwischen horizontalem und vertikalem sowie literalem und figuralem Transfer. Es führt den Begriff des proximalen und distalen Transfers ein und beleuchtet den „low-road“- und „high-road“-Transfer. Das dritte Kapitel stellt die wichtigsten Transfertheorien vor, beginnend mit den klassischen Theorien des Prinzipientransfers und der Theorie der identischen Elemente. Es erörtert dann neuere Ansätze wie Transfer durch metakognitive Kontrolle und Transfer als ganzheitlicher Prozess.
Schlüsselwörter
Transfer, Lernsituation, Anwendungssituation, Weiterbildungsmaßnahmen, positivem Transfer, Nulltransfer, negativem Transfer, horizontaler Transfer, vertikaler Transfer, literaler Transfer, figuraler Transfer, proximaler Transfer, distaler Transfer, „low-road“-Transfer, „high-road“-Transfer, Prinzipientransfer, Theorie der identischen Elemente, metakognitive Kontrolle, ganzheitlicher Transferprozess.
- Quote paper
- Robert Jentzsch (Author), 2003, Transfertheorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19901