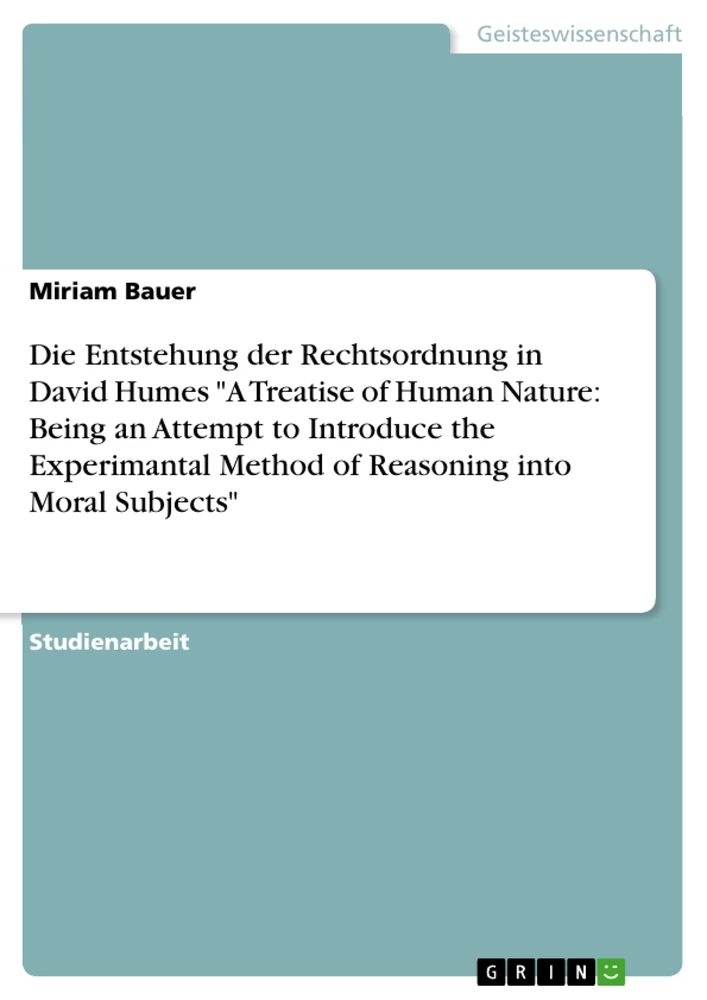In dieser Hausarbeit wird neben der Entstehung der Rechtsordnung und ihr Bezug zum Eigentum, auch das Wohlwollen (Sympathie) und die Selbstsucht (Egoismus) untersucht.
Inhalt
1. Einleitung
2. Der Rechtssinn – eine natürliche oder künstliche Tugend
2.1 Die natürlichen Tugenden
2.2 Die künstlichen Tugenden
2.3 Der Rechtssinn als künstliche Tugend
3. Die Rechtsordnung
3.1 Die Entstehung der Rechtsordnung
3.1.1 Der Ursprung der Gesellschaft
3.1.2 Das Eigentum
3.1.3 Egoismus vs. Sympathie
3.1.4 Ein kurzer Rückblick an Hand von drei Sätzen
3.1.5 Unterscheidung von sittlich schönen und sittlichen Seite hässlichen Normen
4. Fazit: Der Mensch und die Gesellschaft
5. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Hausarbeit zu David Hume?
Die Arbeit untersucht die Entstehung der Rechtsordnung, den Begriff des Eigentums sowie die Konzepte von Sympathie (Wohlwollen) und Egoismus (Selbstsucht) in Humes Werk.
Ist der Rechtssinn nach Hume eine natürliche oder künstliche Tugend?
Hume unterscheidet zwischen natürlichen und künstlichen Tugenden; die Arbeit legt dar, warum der Rechtssinn als künstliche Tugend eingestuft wird.
Wie entsteht laut Hume die Gesellschaft?
Die Untersuchung beleuchtet den Ursprung der Gesellschaft aus der Notwendigkeit heraus, Egoismus durch soziale Normen und Rechtsordnungen zu bändigen.
Welche Rolle spielt das Eigentum in Humes Theorie?
Das Eigentum ist eng mit der Entstehung der Rechtsordnung verknüpft und wird als zentraler Bestandteil der gesellschaftlichen Stabilität analysiert.
Was bedeutet „Sympathie“ im philosophischen Kontext Humes?
Sympathie bezeichnet das menschliche Vermögen, Gefühle anderer nachzuempfinden, was als Gegenpol zum reinen Egoismus in der Rechtsordnung fungiert.
- Arbeit zitieren
- M.A. Miriam Bauer (Autor:in), 2008, Die Entstehung der Rechtsordnung in David Humes "A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to Introduce the Experimantal Method of Reasoning into Moral Subjects", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199032