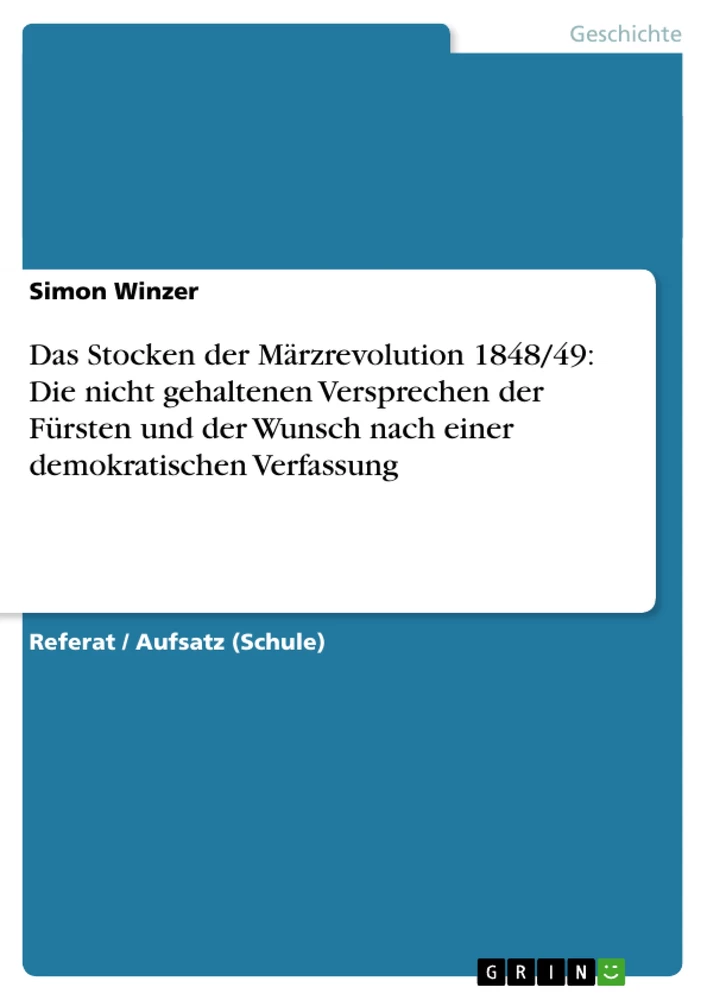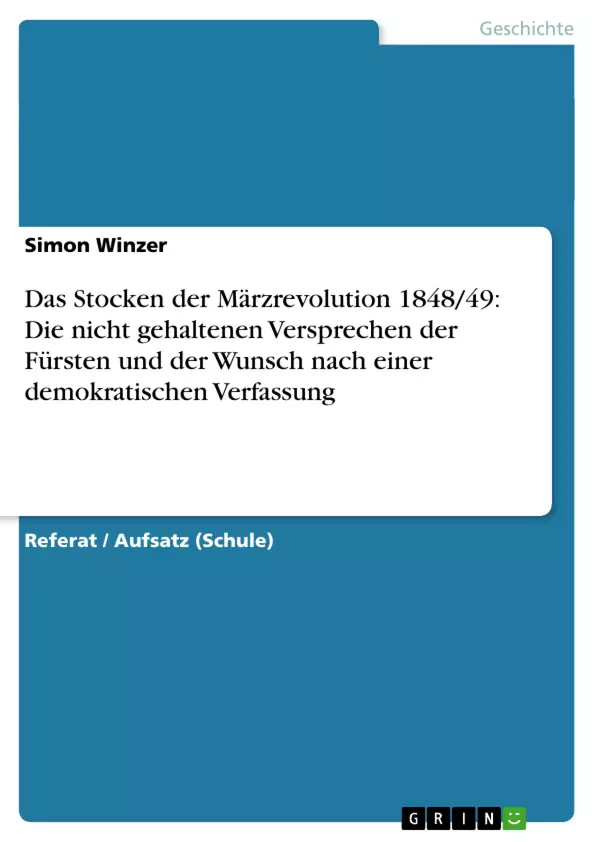Diese Arbeit thematisiert das Stocken der Märzrevolution im Herzogtum Oldenburg. In ihr kommt es zu einer Quellenanalyse eines anonym eingereichten Zeitungsartikels, einer Primärquelle aus dem Jahr 1849, in der der Autor die Leser ermutigt, die Revolution fortzuführen. Schließlich befasst sich die Arbeit mit dem historischen Kontext der Quelle. Hierbei wird am Ende der Befreiungskriege angefangen, wo die Herrscher den Untertanen Besserungen versprachen, die nie eintraten. Auch erläutert die Quelle vom Autor genannte historische Sachverhalte aus einem Abschnitt der Quelle.
Zum Ende befasst sich die Arbeit mit den Gedanken zur konstitutionellen Monarchie, die sich der Verfasser gemacht hat und vergleicht eine Verfassungsvorstellung des Autors mit der Verfassungsentwicklung in Deutschland bis 1918.
Einleitung
Diese Arbeit thematisiert das Stocken der Märzrevolution im Herzogtum Oldenburg. In ihr kommt es zu einer Quellenanalyse eines anonym eingereichten Zeitungsartikels, einer Primärquelle aus dem Jahr 1849, in der der Autor die Leser ermutigt, die Revolution fortzuführen. Schließlich befasst sich die Arbeit mit dem historischen Kontext der Quelle. Hierbei wird am Ende der Befreiungskriege angefangen, wo die Herrscher den Untertanen Besserungen versprachen, die nie eintraten. Auch erläutert die Quelle vom Autor genannte historische Sachverhalte aus einem Abschnitt der Quelle. Zum Ende befasst sich die Arbeit mit den Gedanken zur konstitutionellen Monarchie, die sich der Verfasser gemacht hat und vergleicht eine Verfassungsvorstellung des Autors mit der Verfassungsentwicklung in Deutschland bis 1918.
Das Stocken der MÄrzrevolution
Bei der Primärquelle „Was lehrt uns die jüngste Vergangenheit“1, abgedruckt in der Zeitung „Freie Blätter für das freie Volk“ handelt es sich um einen anonym eingereichten Zeitungsartikel. Anlass der Quelle, die darüber berichtet, dass die Märzrevolution ins Stocken geraten ist, ist das einjährige Jubiläum der ersten Märzaufstände. Die Absicht des Verfassers ist es, das Volk zum Weitermachen in den Revolutionsjahren zu ermutigen.
Insgesamt besteht die Quelle aus zwei Teilen und wurde in zwei Ausgaben abgedruckt, sodass der Entstehungsort zwar Jever (Herzogtum Oldenburg) ist, die Quelle aber am 5. und 8. Februar 1849 erstmals veröffentlicht wurde. Das Thema der Quelle ist die Fragestellung des Autors, warum die Revolution 1848 verkümmerte und die Probleme, die eine konstitutionelle Monarchie mit sich bringt. Als Adressaten lassen sich die politisch interessierten Einwohner des Bezugskreises der Zeitung nennen, die lesen können. Aufgrund der Anonymität ist über den Verfasser nichts bekannt.
Inhaltlich lässt sich die Quelle in mehrere Sinnabschnitte einteilen. Der erste Absatz des am 5. Februar erschienenen Teils ist eine Einleitung für den weiteren Verlauf des Textes. Hier berichtet der Verfasser über die Märzrevolution 1848, die ihm die Hoffnung gebracht habe, dass die Zeit der absolutistisch regierenden Fürsten vorbei sei und das Volk nun frei sein könne (vgl. Z. 1-10).
Doch dieser Wunsch sei nicht in Erfüllung gegangen, da die Bevölkerung sich vom Fürsten habe ruhig stellen lassen anstatt weiter zu revoltieren (vgl. Z. 11 ff.).
Zu Beginn des zweiten Sinnabschnitts stellt der Unbekannt die rhetorische Frage was das Volk bei der Revolution gebremst habe und wie sie ins Stocken geraten sei (vgl. Z. 14 f.). Diese beantwortet er mit der Aussage, dass das Volk „Angst vor [sich] selber und eine kindische selbstsüchtige Furcht“ (Z. 17 f.) gehabt habe. Als weitere Ursache sieht er die Bürger an, die vor den Stadtgrenzen lebten und zumeist etwas mehr Einfluss hatten. Doch auch der konstitutionellen Monarchie, die „Das Grab der Freiheit“ (Z. 27) sei, gibt er eine Schuld, da diese den Menschen an der Basis keine Souveränität verabreiche und nichts verändere. Dies hätten die sogenannten „Pfahlbürger“ eingebrockt (vgl. Z. 25-29).
Im dritten Teil der Quelle erklärt der Einsender des Artikels, dass es falsch sei, dass in einem Land jemand [der Fürst] Exekutive und Legislative zugleich habe und somit außerhalb des Gesetzes stehe. Da er zudem durch die ausführende Gewalt die Macht über das Heer habe, teilt der Verfasser die Angst, der Herrscher könnte das Volk unterdrücken (vgl. Z. 30-37).
Zum Schluss des ersten in der Zeitung veröffentlichten Teils führt der Autor die Antwort auf seine rhetorische Frage weiter aus. So habe die Furcht, bei der Revolution eine Anarchie durch das Volk zu erschaffen dazu beigetragen, dass nun Gesetzlosigkeit durch den König herrscht (vgl. Z. 38-46).
Der zweite Teil des Artikels beginnt mit einer zweiten Antwort auf die rhetorische Frage. So käme es zum Stillstand der Revolution, da die Bevölkerung den Fürsten noch vertraue, obwohl dieses bereits wiederholt getäuscht worden sei, obwohl es die Monarchie gerettet habe (vgl. Z. 49-58). Des Weiteren geht der Verfasser auf die Karlsbader Beschlüsse ein, die die Fürsten direkt nach dem Sieg gegen Frankreich in den Befreiungskriegen erlassen haben. Nun trage er Sorge, dass es nach dem Vormärz erneut zu einer ähnlichen Situation käme. So müsse die Lehre gezogen werden mit der Monarchie keine Verbindungen mehr einzugehen.
Im nächsten Absatz schimpft der anonyme Schreiber auf die Frankfurter Nationalversammlung, die seiner Ansicht nach von einer freien Legislative zu Lakaien der Hohenzollern und Habsburger geworden sei (vgl. Z. 71 ff.). Zum Schluss konkludiert er mit den Worten, dass man nicht mehr mit den Fürsten verhandeln dürfte und die konstitutionelle Monarchie der falsche Weg sei und das Volk deshalb kämpfen solle. Dies ist auch die Hauptaussage des Textes.
Der Sprachstil des Autors ist appellativ, da er seine Mitmenschen davon überzeugen möchte, sich nicht auf die Worte des Fürsten zu verlassen.
Ebenfalls verwendet er viele rhetorische Stilmittel (beispielsweise Metaphern, Allegorien, rhetorische Fragen), durch die er die Leser mitreißen will.
Eingeordnet in den historischen Kontext hat die Quelle etwas mit den Märzrevolutionen 1848 und der daraus entstandenen Bewegung bis Mitte 1949 zu tun.
„Deutschland zu einem Gefängniß und jedes freie Wort zu einem todtwürdigen Verbrechen“ (Z. 61).
Der historische Kontext der Quelle beginnt mit den Karlsbader Beschlüssen im Jahr 1819, die bei Nichteinhaltung zu den im Zitat genannten Folgen geführt hätten.
Vorausgegangen waren den Beschlüssen der Sieg gegen Frankreich während der Befreiungskriege 1813, während denen zum ersten Mal in der Geschichte ein deutsches National- und Zusammenhaltsgefühl ausgelöst wurde und wo man es schaffte, die Besatzungsmacht Frankreich zu vertreiben. „Als sie [die Fürsten] […] flehten um Erlösung von der Herrschaft der Franzosen [...]“ (Z. 55 f.).
[...]
1 Anonymer Verfasser: Was lehrt uns die jüngste Vergangenheit, Jever 1849
Häufig gestellte Fragen
Warum geriet die Märzrevolution 1848 ins Stocken?
Laut der untersuchten Quelle lag dies an der "kindischen Furcht" des Volkes, der Beruhigungstaktik der Fürsten und den Problemen der konstitutionellen Monarchie.
Welche Rolle spielte das Herzogtum Oldenburg in der Revolution?
Die Arbeit analysiert einen in Jever veröffentlichten Zeitungsartikel von 1849, der die Bürger ermutigte, die Revolution trotz des Stillstands fortzuführen.
Was kritisierte der anonyme Autor an der konstitutionellen Monarchie?
Er bezeichnete sie als "Grab der Freiheit", da sie dem Volk keine echte Souveränität gewährte und der Fürst weiterhin zu viel Macht über Heer und Gesetze behielt.
Was waren die "Karlsbader Beschlüsse"?
Repressive Maßnahmen der Fürsten ab 1819, um liberale und nationale Bewegungen zu unterdrücken, worauf der Autor der Quelle warnend Bezug nimmt.
Wie beurteilte der Autor die Frankfurter Nationalversammlung?
Er sah sie kritisch als "Lakaien der Hohenzollern und Habsburger", die ihre ursprüngliche legislative Freiheit aufgegeben hätten.
- Quote paper
- Simon Winzer (Author), 2012, Das Stocken der Märzrevolution 1848/49: Die nicht gehaltenen Versprechen der Fürsten und der Wunsch nach einer demokratischen Verfassung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199069