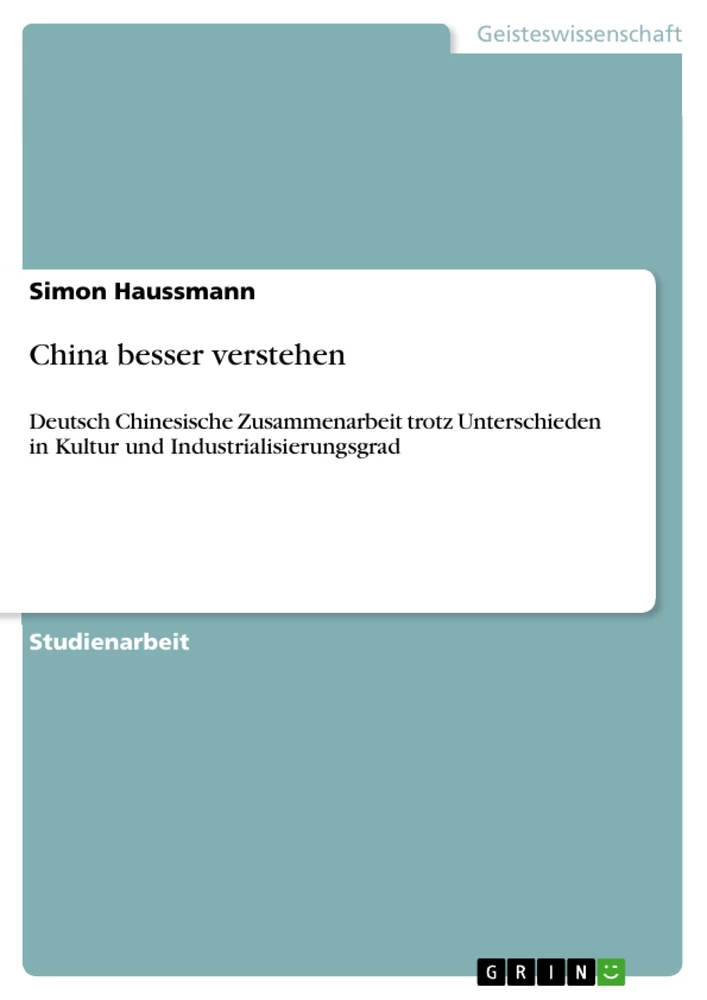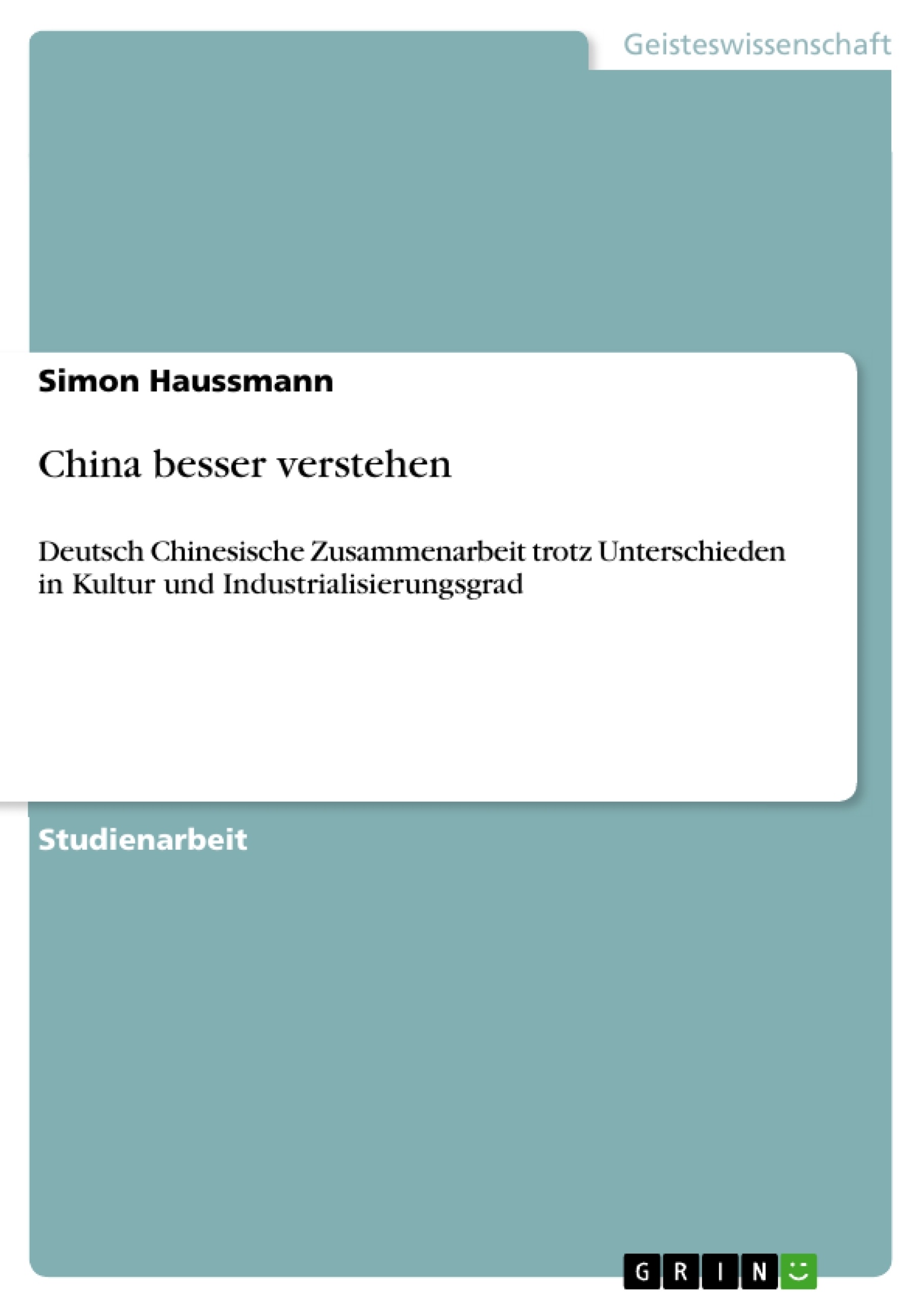In der heutigen globalisierten Welt wird immer mehr eine interkulturelle Zusammenarbeit gefordert. Verschiedene Kulturen treffen aufeinander und lösen unterschiedliche Reaktionen aus. So wird China in den deutschen Medien häufig mit schlechter Presse belegt. Berichte über Umweltsünden, schlechte Arbeitsbedingungen oder auch über das Kopieren von Produkten sind regelmäßig in den deutschen Medien zu sehen und zu lesen.
Es wird dabei aber häufig vergessen, dass China sich erst vor kurzem der Welt geöffnet hat und es innerhalb weniger Jahre zur „Werkbank der Welt“ geschafft hat. Was hat aber dieser rasche Aufstieg für die Menschen zu bedeuten? Was ändert sich? Und obwohl aus deutscher Sicht die Chinesen häufig ein Rätsel bleiben, gibt es eventuell auch Gemeinsamkeiten?
Die Zahl Chinesischer Studenten und Arbeitnehmer in Deutschland wächst ständig. Gleichzeit erhöht sich aber auch die Zahl Deutscher Entsendeter im Reich der Mitte. Der Beschaffungs- und Absatzmarkt China wird für die deutsche Volkswirtschaft ein ganz entscheidender Faktor darstellen. Daher soll untersucht und verglichen werden, wie industrialisiert China und Deutschland momentan sind, wie sehr sich die beiden Völker in ihrer Mentalität und Kultur unterscheiden, und wie sich dies auf eine Zusammenarbeit auswirken kann.
Sicherlich können hier keine allgemeingültigen Regeln aufgestellt werden. Jeder Mensch ist unterschiedlich und kann unter Umständen andere Charakteristika an den Tag legen als hier angenommen wird. Für eine wissenschaftliche Betrachtung müssen empirische Daten herangezogen werden. Werden nachfolgend die Deutschen und auch die Chinesen charakterisiert, so ist dies auf den Durchschnittsdeutschen und den Durchschnittschinesen bezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Interkulturelle Unterschiede
- 2.1 Wurzeln der Kultur
- 2.2 Die Hofstede Studie
- 2.3 Mentalität der Deutschen
- 2.4 Mentalität der Chinesen
- 3. Unterschiedlicher Industrialisierungsgrad
- 3.1 Industrielle Revolutionen in Deutschland und Europa
- 3.2 Veränderungen für die Menschen durch die Industrialisierung
- 3.3 Zuordnung der Länder zu ihrem Entwicklungsstand
- 3.4 Generelle Theorie nach Maslow
- 3.5 Bedeutung für die deutschen Arbeitnehmer
- 3.6 Bedeutung für die chinesischen Arbeitnehmer
- 4. Mögliche Kollisionspunkte
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht und vergleicht den Industrialisierungsgrad Deutschlands und Chinas, analysiert kulturelle und mentale Unterschiede beider Völker und deren Auswirkungen auf die Zusammenarbeit. Der Fokus liegt auf dem Verständnis interkultureller Dynamiken im Kontext der wachsenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern.
- Kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und China
- Der Einfluss der Industrialisierung auf die Mentalität der Arbeitnehmer
- Anwendung der Hofstede-Studie zum Vergleich der Kulturen
- Mögliche Konfliktpunkte in der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit
- Der Aufstieg Chinas zur „Werkbank der Welt“ und dessen Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der zunehmenden interkulturellen Zusammenarbeit im globalisierten Umfeld, insbesondere im Hinblick auf die Beziehungen zwischen Deutschland und China. Sie hebt die Herausforderungen hervor, die sich aus den kulturellen Unterschieden ergeben, und begründet die Notwendigkeit eines Vergleichs des Industrialisierungsgrades und der Mentalitäten beider Länder. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des chinesischen Marktes für die deutsche Wirtschaft und dem wachsenden Austausch von Studenten und Arbeitnehmern.
2. Interkulturelle Unterschiede: Dieses Kapitel untersucht die kulturellen Wurzeln Deutschlands und Chinas, indem es den Einfluss des Christentums, Humanismus und der Aufklärung in Deutschland mit dem Konfuzianismus, Buddhismus, Taoismus und Kommunismus in China vergleicht. Die unterschiedliche sprachliche Struktur und die daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der Übersetzung neuer Technologien werden analysiert. Des Weiteren wird der Unterschied in der Herangehensweise an medizinische Probleme und die Bedeutung der Frage „Warum“ im europäischen Kontext im Gegensatz zum Fokus auf die Heilmethode in der chinesischen Medizin beleuchtet.
3. Unterschiedlicher Industrialisierungsgrad: Dieses Kapitel befasst sich mit dem unterschiedlichen Industrialisierungsgrad Deutschlands und Chinas. Es analysiert die industriellen Revolutionen in Deutschland und Europa, die Veränderungen durch die Industrialisierung, die Zuordnung der Länder zu ihrem Entwicklungsstand und die Bedeutung der Maslowschen Bedürfnispyramide im Kontext der deutschen und chinesischen Arbeitnehmer. Der Vergleich soll Aufschluss über die jeweiligen Entwicklungsphasen und ihre Auswirkungen auf die Mentalitäten geben.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Zusammenarbeit, Deutschland, China, Industrialisierung, Kulturvergleich, Hofstede-Studie, Mentalität, Wirtschaftsbeziehungen, Konfuzianismus, Christentum, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich des Industrialisierungsgrades und der Mentalitäten Deutschlands und Chinas
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht und vergleicht den Industrialisierungsgrad Deutschlands und Chinas, analysiert kulturelle und mentale Unterschiede beider Völker und deren Auswirkungen auf die Zusammenarbeit. Der Fokus liegt auf dem Verständnis interkultureller Dynamiken im Kontext der wachsenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und China, den Einfluss der Industrialisierung auf die Mentalität der Arbeitnehmer, die Anwendung der Hofstede-Studie zum Kulturvergleich, mögliche Konfliktpunkte in der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit und den Aufstieg Chinas zur „Werkbank der Welt“ und dessen Auswirkungen.
Wie werden kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und China analysiert?
Die Analyse der kulturellen Unterschiede umfasst einen Vergleich der kulturellen Wurzeln (Christentum, Humanismus, Aufklärung in Deutschland vs. Konfuzianismus, Buddhismus, Taoismus und Kommunismus in China), sprachlicher Strukturen und deren Einfluss auf die Übersetzung neuer Technologien sowie unterschiedliche Herangehensweisen an medizinische Probleme.
Welche Rolle spielt die Hofstede-Studie?
Die Hofstede-Studie wird angewendet, um die Kulturen Deutschlands und Chinas zu vergleichen und kulturelle Unterschiede zu quantifizieren und zu verstehen.
Wie wird der unterschiedliche Industrialisierungsgrad behandelt?
Das Kapitel zum Industrialisierungsgrad analysiert die industriellen Revolutionen in Deutschland und Europa, die daraus resultierenden Veränderungen für die Menschen, die Zuordnung der Länder zu ihrem Entwicklungsstand und die Bedeutung der Maslowschen Bedürfnispyramide für deutsche und chinesische Arbeitnehmer.
Welche möglichen Konfliktpunkte in der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit werden angesprochen?
Die Arbeit identifiziert potentielle Konfliktpunkte, die aus den unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, dem unterschiedlichen Industrialisierungsgrad und den daraus resultierenden mentalen Unterschieden der Arbeitnehmer resultieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Interkulturelle Zusammenarbeit, Deutschland, China, Industrialisierung, Kulturvergleich, Hofstede-Studie, Mentalität, Wirtschaftsbeziehungen, Konfuzianismus, Christentum, Globalisierung.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit beinhaltet Zusammenfassungen der Einleitung (Kontext der zunehmenden interkulturellen Zusammenarbeit), des Kapitels zu interkulturellen Unterschieden (Vergleich der kulturellen Wurzeln und Mentalitäten), und des Kapitels zum unterschiedlichen Industrialisierungsgrad (Analyse der industriellen Revolutionen und deren Auswirkungen).
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit interkultureller Zusammenarbeit, insbesondere zwischen Deutschland und China, beschäftigen, z.B. Wirtschaftswissenschaftler, Soziologen, Studenten und Mitarbeiter in multinationalen Unternehmen.
- Arbeit zitieren
- Simon Haussmann (Autor:in), 2011, China besser verstehen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199170