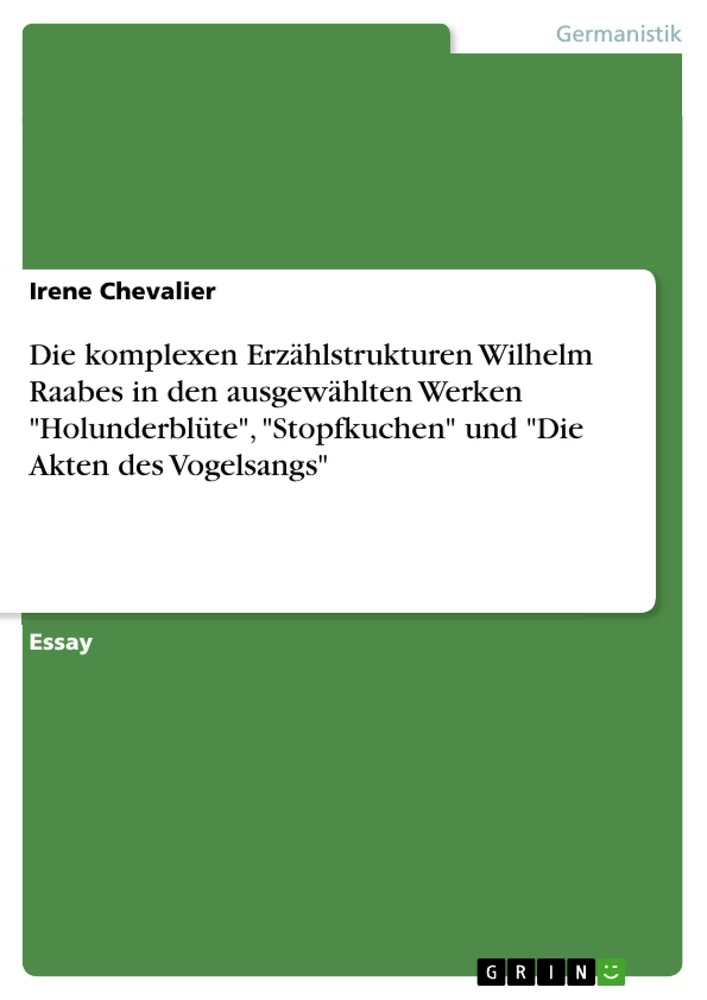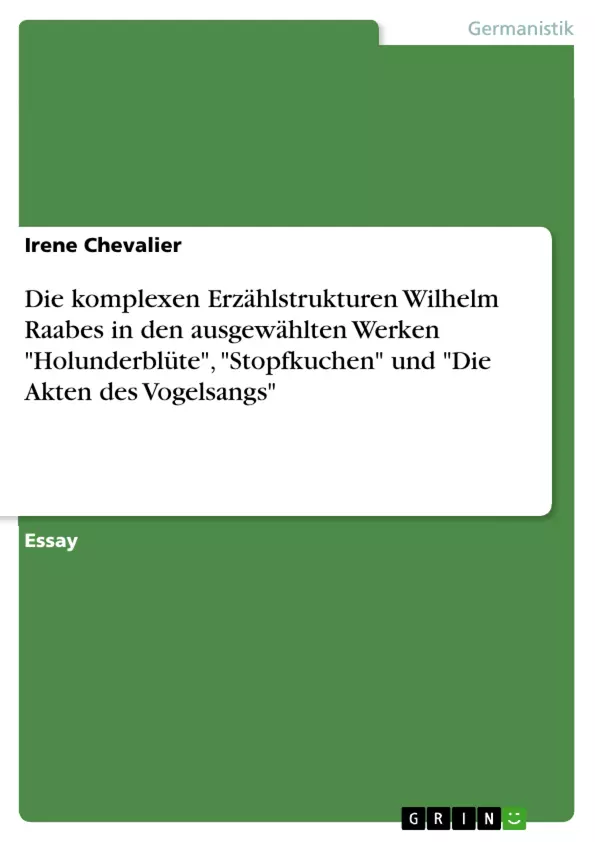Wenn man sich den Erzählungen Wilhelm Raabes widmet, bleibt es wohl kaum aus, dass seine doppelte Erzählstruktur bemerkt wird. Immer wieder fällt in seinen Werken die Trennung von realem Autor und fiktivem Erzähler auf. Das Auftreten einer Erzählerfigur innerhalb der Novellen und Romane Raabes scheint eines der charakteristischen Elemente seines Schreibstils zu sein. Diese Arbeit versucht dies nun anhand einiger Beispiele aus seinen Werken „Holunderblüte“, „Stopfkuchen“ und „Die Akten des Vogelsangs“ zu verdeutlichen.
Wenn man sich den Erzählungen Wilhelm Raabes widmet, bleibt es wohl kaum aus, dass in diesen mehrfache Erzählrahmen und -strukturen bemerkt werden. Zudem fällt in seinen Werken immer wieder die Trennung von realem Autor und fiktivem Ich-Erzähler auf. Das Auftreten einer Erzählerfigur innerhalb der Novellen und Romane Raabes scheint eines der charakteristischen Elemente seines Schreibstils zu sein. Ich werde dieses Zusammenspiel von Erzählerfigur und Erzählrahmen nun anhand einiger Beispiele aus seinen Werken Ho lunderblüte, Stopfkuchen und Die Akten des Vogelsangs verdeutlichen.
Eine Erinnerungsnovelle ist ein Erzähltypus, der sich auf das erinnerte Geschehen einer unerhörten Begebenheit fokussiert1. Eben solch eine Erinnerungsnovelle ist auch Raabes Holunderblüte (1863). Dort löst ein bestimmtes Symbol den Erinnerungsprozess des Ich- Erzählers Hermann aus und leitet damit eine doppelte Erzählstruktur ein2. Der Arzt Her- mann erinnert sich aufgrund des Anblickes eines geflochtenen Kranzes aus künstlichen Holunderblüten im Hause einer kürzlich verstorbenen Patientin an seine ungefähr vierzig Jahre zurückliegende Studienzeit in Prag. In jener Zeit machte er die Bekanntschaft mit dem jüdischen Mädchen Jemima, die mit ihm über den von Holunderbüschen umsäumten Judenfriedhof Beth-Chaim zwischen den Gräbern spazierte. Die beiden verbindet eine Art Liebesbeziehung, jedoch reist Hermann wieder aus Prag ab und Jemima stirbt in der Zwi- schenzeit an einer Herzkrankheit. Daraufhin spezialisiert sich der Medizinstudent auf die Kardiologie.
Die Rahmenhandlung der Novelle setzt damit ein, dass der sich erinnernde Ich-Erzähler3 die Mutter einer verstorbenen Patientin von ihm besucht. Beim Eintreten in das Haus pas- siert er einen Abguss einer Muse, kurz darauf fällt sein Blick im Zimmer der Toten auf ein Notenblatt und einen geflochtenen Ballkranz aus künstlichen Holunderblüten: „ Mit diesem Liede kam mir die erste Mahnung aus langvergangener Zeit; aber ein Zweites [der Ball- kranz aus Holunder] mußte dazukommen, ehe sich die Gedanken- und Bilderreihe ent- spann, welche ich diesen Papieren jetzt anvertraue. “ 4. Damit wird Hermanns Erinnerung affektiv in Gang gesetzt, denn bestimmte Bilder („images“) lösen seinen Akt der Erinne- rung aus5. Bei diesem Erinnerungsprozess spielt besonders der Holunderkranz die Rolle eines „aufschließenden Symbols“ und Bilder aus seiner Vergangenheit, die weit vor seiner eigentlichen Gegenwart zurückliegen, können abgerufen werden6.
Dadurch funktioniert diese Novelle Raabes über die Mnemonik, eine Kombination aus Gedächtnistheorie und Gedächtniskunst7. Die Holunderblüte ist mit individueller Erinne- rung8 aufgeladen und verbindet den Erzähler wieder mit den unbewältigten Erlebnissen in Prag9. Die Holunderblüte ist das aufschließende Symbol der Anagnorisis. Der direkte Wie- dererkennungseffekt zwischen dem künstlichen Holunderkranz und den Ereignissen um Jemima liegt in deren damaliger Aufforderung „ Gedenke der Holunderblüte “ 10 . Hermann hat zwar während der über vierzig Jahre, die zwischen der letzten Unterredung mit Jemima und dem Eintritt in das Haus der verstorbenen Patientin vergangen sind, die Prager Ereig- nisse nicht vergessen11, jedoch braucht es die Komposition aus dem Lied auf dem Noten- blatt, dem Tod der Patientin an einer Herzschwäche und schließlich im Besonderen dem Kranz aus Holunder um die Erinnerungsreihe in ihren reflexiven Gang zu setzen. Darüber hinaus wird somit das gesamte Haus, in welchem das Mädchen verstorben ist, als affekti- ver Erinnerungsort von Raabe konzipiert12.
Letztlich verschriftlicht der Ich-Erzähler seine Erinnerungen; somit kommt es zu einer Evokation von Poesie und das Erlebte verwandelt sich in (Dicht-) Kunst13. Dies wird auch durch ein wiederholtes Vorübergehen an der eingangs erwähnten Musenstatue verdeutlicht. Zunächst wird die Fähigkeit zur Reflexion, die Voraussetzung für die Dichtkunst durch den Blick auf den Holunderkranz ausgelöst. Den Rahmen für diesen Erinnerungs- und Ref- lexionsprozess bilden in diesem Zusammenhang dann die Musenplastik und das Vorbeige- hen an dieser zu Beginn und am Ende der Erzählung14. Die Muse in ihrer anderen Bedeu- tung als „die Erinnernde“ ist damit einerseits ein Verweis auf die Lehre der Mnemonik und andererseits eingangs direkt ein weiterer Schlüssel für den Leser, dass es sich im Folgen- den um eine Erinnerungsnovelle handeln wird15.
Insgesamt werden zwei Erzählebenen aufgespannt: Raabes Verschriftlichung des fiktiven sich erinnernden Ich-Erzählers bildet den äußeren Rahmen, das vom Ich-Erzähler verfasste erinnerte Geschehen den inneren Rahmen. Allerdings kann sogar noch ein dritter Erzähl- rahmen ausgemacht werden, wenn man Jemimas Bericht über die vierzig Jahre vor ihr verstorbene Mahalath miteinbezieht16.
Das Auffällige an dieser Erinnerungsnovelle ist jedoch auch, dass der Autor an keiner Stel- le direkt zu Tage tritt, stattdessen lässt er seinen fiktiven sich erinnernden Ich-Erzähler die Ereignisse berichten. Strukturell bildet der Erzähler Hermann damit die äußere Fiktion, wohingegen seine Erinnerung die innere Fiktion kennzeichnet. Damit wird keine neutrale Rückschau dargestellt, sondern es kommt zu einer Selbstreflexion des Erzählers. Die Erin- nerung wird immer aus Sicht des Arztes Hermann konstruiert, d. h. der Leser muss sich auf dessen Wirklichkeitsgenerierung einlassen. Jene Trennung zwischen realem Autor und fiktivem Ich-Erzähler zeichnet wiederum auch die doppelte Erzählstruktur Raabes in dieser Novelle aus und wird auch im weiteren Verlauf der Untersuchung noch eine zentrale Rolle spielen.
Nun zu den Romanen Stopfkuchen und Die Akten des Vogelsangs, die zu Raabes Spätwerk zählen und Teile seiner Braunschweiger Trilogie sind. Betrachtet man diese beiden, fallen zunächst einige Parallelen bezüglich ihrer Form ins Auge. In beiden Romanen schreibt ein Ich-Erzähler Erinnerungen an einen bestimmten (Jugend-) Freund aus Schule oder Nach- barschaft und dessen Werdegang nieder. Dabei tritt nicht so ein aufschließendes Symbol wie in Holunderblüte, wo die Gesamtkomposition des Besuches im Haus der Toten und die explizite Betrachtung des künstlichen Kranzes einen Erinnerung auslösenden Rahmen bil- den, auf. Beide Erzähler, Eduard und Karl Krumhardt sind innerhalb des jeweiligen Ro- mans auf ihre Chronistentätigkeit beschränkt und erscheinen daneben als erlebendes Ich im Kontrast zum beschriebenen Helden17. Somit besitzen sowohl Eduard als auch Karl einen persönlichen Bezug zu Heinrich bzw. Velten, dem Helden der entsprechenden erinnerten Erzählung. Zusammen bilden sie einen bipolaren Kern des jeweiligen Romans. Damit geht es in der Niederschrift nicht nur um die Darstellung Heinrichs oder Veltens, sondern auch um das allgemeine Verstehen der eigenen Person des Erzählers im Lichte dieses Kontras- tes18. Mit der Wahl der Perspektive eines sich erinnernden Ich-Erzählers, der vornehmlich eine Person im Rahmen seiner Niederschriften in den Fokus nehmen will, stellt Raabe eine Bipolarität zwischen Romanheld und Erzähler dar.
[...]
1 Ralf Georg Czapla: „Gedenke der Holunderblüte“ oder Schreiben wider das Vergessen, Erinnerte Ge- schichte bei Wilhelm Raabe und Johannes Bobrowski. In: Jahrbuch der Raabe-Gesellschaft (1999), S. 33-59, hier: S. 36.
2 Ebd., S. 37.
3 Gabriele Varo: Feindlichkeit des Lebens und Lebensbewältigung in den Romanen Wilhelm Raabes. Pfaffenweiler: Centaurus 1994. S. 103.
4 Wilhelm Raabe: Holunderblüte. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2006, S. 8.
5 Czapla: Schreiben wider das Vergessen (Anm. 1), S. 35.
6 Czapla: Schreiben wider das Vergessen (Anm. 1), S. 43.
7 Ebd., S. 39.
8 Ebd., S. 56.
9 Ebd., S. 44.
10 Raabe: Holunderblüte (Anm. 4), S. 29.
11 Vgl. Ebd., S. 40.
12 Czapla: Schreiben wider das Vergessen (Anm. 1), S. 42.
13 Vgl. Ebd., S. 58 f.
14 Vgl. Raabe: Holunderblüte (Anm. 4), S. 4 & S. 41.
15 Vgl. Czapla: Schreiben wider das Vergessen (Anm. 1), S. 40f.
16 Vgl. Raabe: Holunderblüte (Anm. 4), S. 23-26.
17 Rolf-Dieter Koll: Raumgestaltung bei Wilhelm Raabe. Bonn: Bouvier 1977, S. 96.
18 Hermann Helmers: Die bildenden Mächte in den Romanen Wilhelm Raabes. Weinheim: Julius Beltz 1960, S. 55 & S. 58.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet die Erzählstruktur von Wilhelm Raabe aus?
Charakteristisch ist die doppelte Erzählstruktur mit einer klaren Trennung zwischen dem realen Autor und einem fiktiven Ich-Erzähler.
Was ist eine 'Erinnerungsnovelle' bei Raabe?
Ein Typus, bei dem ein Symbol (wie die Holunderblüte) einen tiefgreifenden Erinnerungsprozess auslöst, der die eigentliche Geschichte einleitet.
Welche Rolle spielt die Mnemonik in 'Holunderblüte'?
Die Mnemonik (Gedächtniskunst) wird genutzt, um durch 'aufschließende Symbole' unbewältigte Erlebnisse der Vergangenheit in der Gegenwart wieder präsent zu machen.
Was ist die 'Bipolarität' in Raabes Romanen?
In Werken wie 'Stopfkuchen' gibt es einen Kontrast zwischen dem passiven Chronisten (Erzähler) und dem aktiven Helden der Geschichte.
Warum nutzt Raabe fiktive Ich-Erzähler?
Dadurch wird keine neutrale Rückschau geboten, sondern eine subjektive Selbstreflexion, die den Leser zwingt, sich auf die spezifische Wirklichkeit des Erzählers einzulassen.
- Quote paper
- Irene Chevalier (Author), 2010, Die komplexen Erzählstrukturen Wilhelm Raabes in den ausgewählten Werken "Holunderblüte", "Stopfkuchen" und "Die Akten des Vogelsangs", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199324