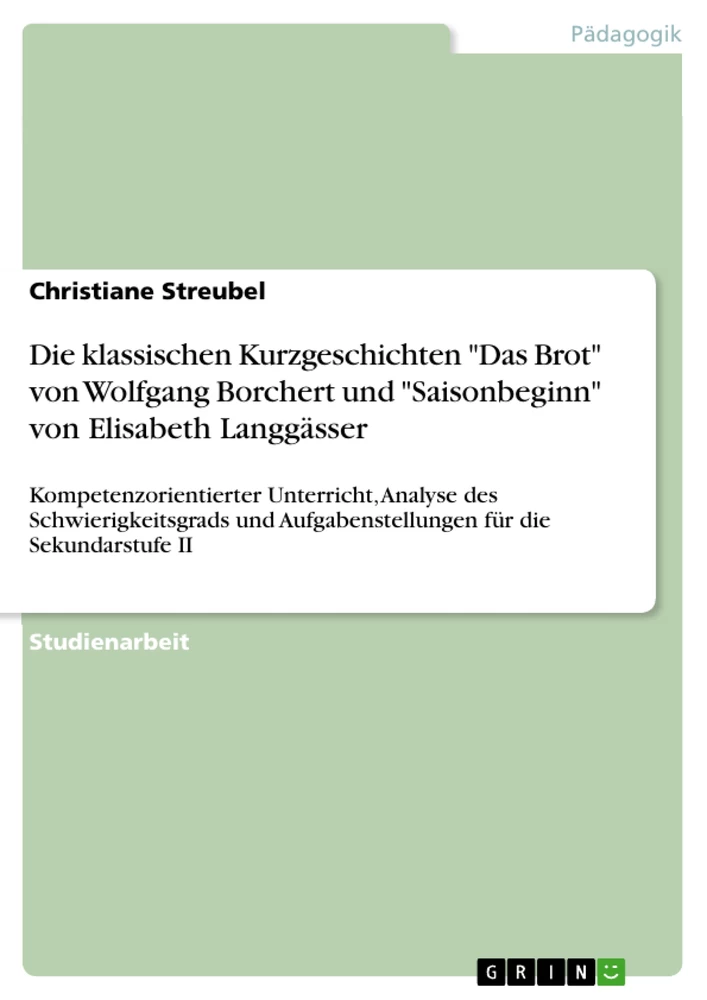Der Beitrag diskutiert angelehnt an Vorschläge von Kaspar Spinner und Clemens Kammler die Grundprobleme literarischen Lernens und literarischer Kompetenzen. Vor diesem Hintergrund analysiert er ausführlich den Schwierigkeitsgrad der beiden klassischen Kurzgeschichten "Das Brot" von Wolfgang Borchert und "Saisonbeginn" von Elisabeth Langgässer. Abschließend werden jeweils konkrete Vorschläge für kompetenzorientierte Aufgabenstellungen formuliert.
Aus der Einleitung:
Das Umgehen mit literarischen Texten im Unterricht ist nach dem aktuellen didaktischen Diskussionsstand im Vergleich zum Gegenstand der Sachtexte mit besonderen Zielen verbunden. Dazu zählen die Kenntnis literarischer Genres, die Fähigkeit zu kontextueller Lektüre in literaturgeschichtlicher Perspektive und die Partizipation am kulturellen Leben auf der Grundlage literarischer Bildung. Als spezifische Merkmale literarischer Texte werden Unbestimmtheit und Erwartungsbruch, Vorherrschen von Mehrdeutigkeit und Symbolik hervorgehoben. Für die Interpretation eines literarischen Textes sind somit spezielle Kompetenzen erforderlich, die die Spielregeln literarischer Kommunikation beachten. Insbesondere sind Inferenzbildungsprozesse nötig, um mit Unbestimmtheitsstellen, symbolischer Verdichtung und Erwartungsbrüchen adäquat umgehen zu können. Die (Schülerinnen und Schüler (SuS) müssen dafür sensibilisiert sein, dass die Sprachgestaltung in literarischen Texten mit einer bestimmten Wirkungsintention verbunden ist. Sie sollen im Unterricht die Erfahrung machen, dass die Untersuchung der Wortwahl, der Syntax der stilistischen Mittel und der Steuerungsfunktion des Erzählers sich im Sinne des Textverständnisses auszahlen kann.
Lehrende sollen auf dem Weg zu einem kompetenzorientiertem Unterricht die Anforderungen von Lern- und Leistungsaufgaben exakter einschätzen können. Für Kurzgeschichten ist für die Analyse des jeweiligen Schwierigkeitsgrads eine Unterteilung in sechs zentrale Dimensionen erfolgt:
1. Sprachliche Mittel/Form, 2. Handlungslogik, 3. Figuren, 4. Bildlichkeit, 5. Gattung und 6.Wissensimplikationen, die von den übrigen Kategorien nicht abgedeckt sind.
Aufgabenstellungen, die literarische Kompetenzen fördern sollen, lassen sich grundsätzlich in rezeptive (Verständnis, Interpretationen, Umgang mit Literatur als Kunst) und produktive (Verfassen literarischer Texte) Kompetenzen unterteilen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Wolfgang Borchert: Das Brot (1946)
2.1 Analyse des Schwierigkeitsgrads
2.1.1 Sprachliche Mittel/Form
2.1.2 Handlungslogik
2.1.3 Figuren
2.1.4 Bildlichkeit
2.1.5 Gattung
2.1.6 Wissensimplikationen
2.1.7. Schwierigkeitsprofil der Kurzgeschichte Das Brot
2.2 Vorschläge für kompetenzorientierte Aufgabenstellungen
3. Elisabeth Langgässer: Saisonbeginn (1947)
3.1 Analyse des Schwierigkeitsgrads
3.1.1 Sprachliche Mittel/Form
3.1.2 Handlungslogik
3.1.3 Figuren
3.1.4 Bildlichkeit
3.1.5 Gattung
3.1.6 Wissensimplikationen
3.1.7. Schwierigkeitsprofil der Kurzgeschichte Saisonbeginn
3.2 Vorschläge für kompetenzorientierte Aufgabenstellungen
4. Schlussbemerkung
Literatur
- Quote paper
- Dr. Christiane Streubel (Author), 2010, Die klassischen Kurzgeschichten "Das Brot" von Wolfgang Borchert und "Saisonbeginn" von Elisabeth Langgässer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199328